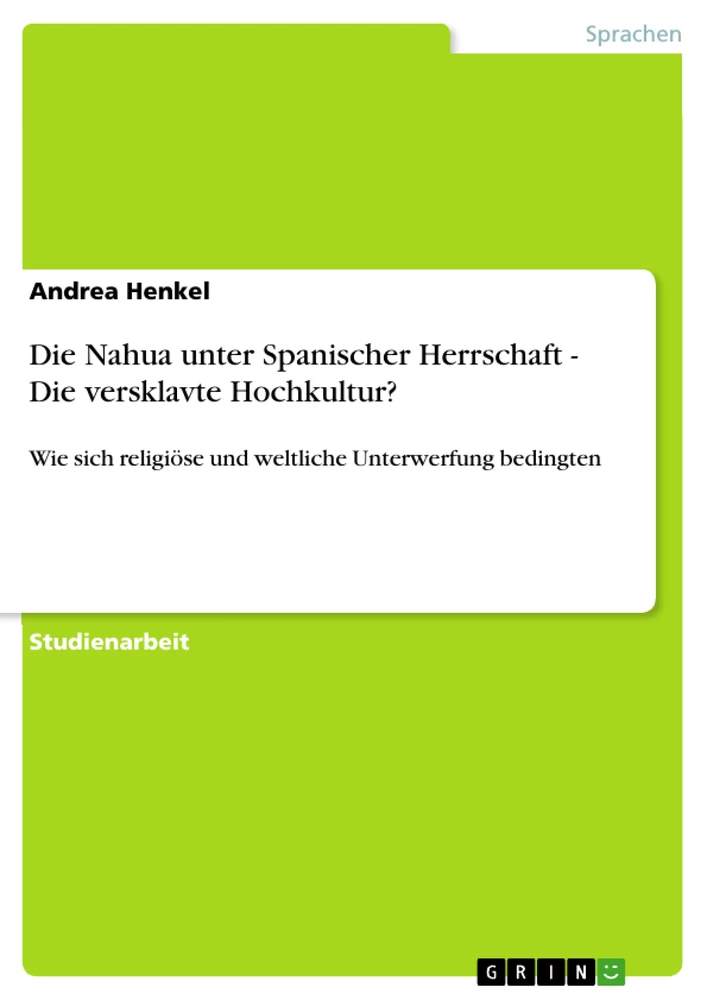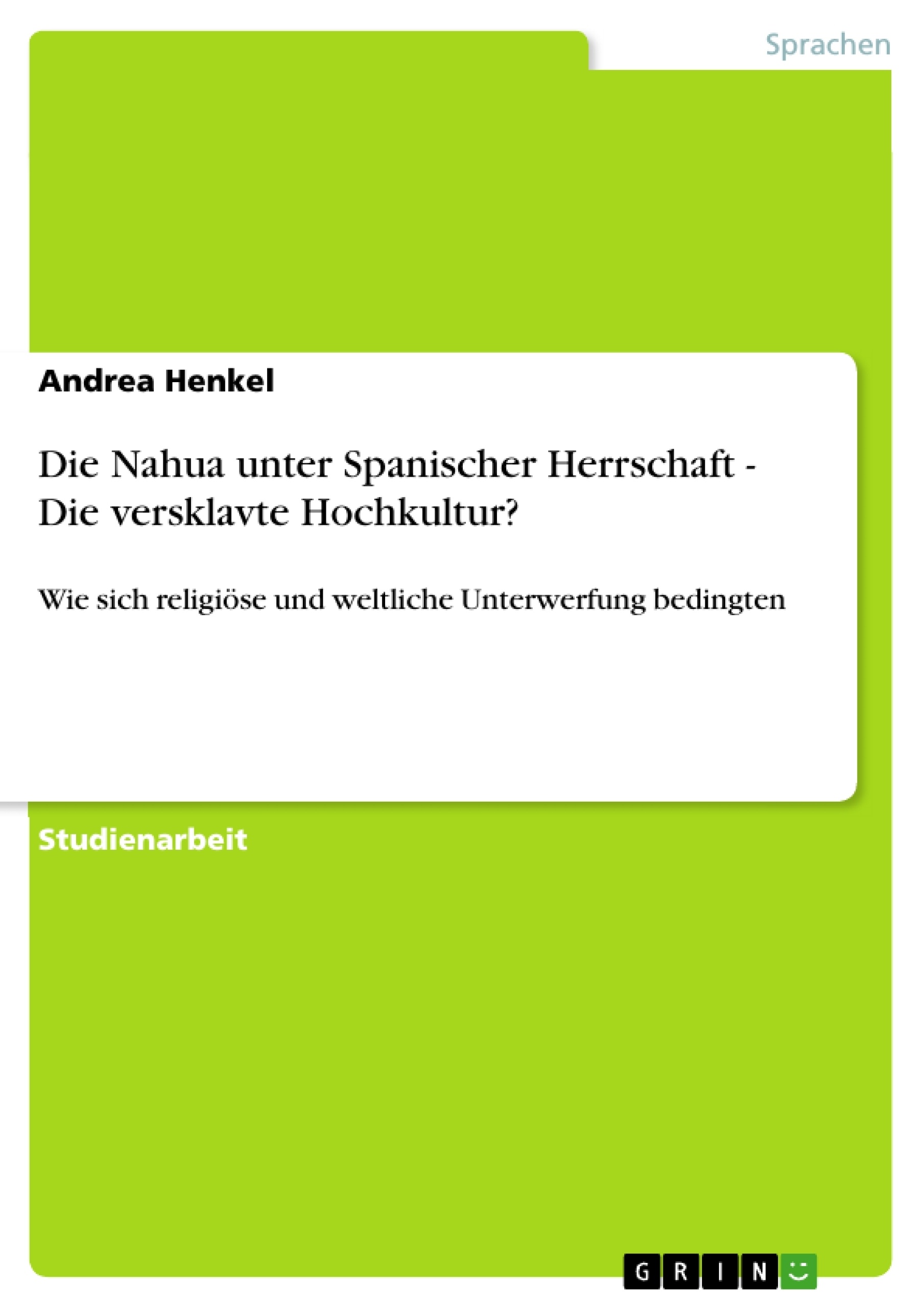"Tlatelolco, heroisch verteidigt von Cuathémoc, fiel am 13. August 1512 in die Hände von Hernan Cortez. Es war weder ein Sieg noch eine Niederlage, sondern die schmerzhafte Geburt des Mestizenvolkes, das heißt der Mexikaner von heute (Gedenktafel an der Seite der Großen Pyramide von Tlatelolco, wo die letzte Schlacht stattfand)"
... so heißt es auf einer Gedenktafel am Platz der drei Kulturen, wo die letzten Reste einer längst vergangenen Hochkultur zu finden sind. In einer Stadt, die nicht mehr Tlatelolco oder Tenochtitlán heißt, sondern Mexico City genannt wird- eine Megalopolis, erbaut über den Gemäuern der Aztekenstadt, die sie unter sich begräbt.
Diese Vorstellung von der "Stadt über der Stadt" scheint geradezu sinnbildlich zu sein für die gesamte Eroberungs- und Kolonialzeit. Immerhin fand mit der Eroberung Mexikos durch die Spanier scheinbar eine ganze Kultur, eine Religion, ein ganzes Volk, ein Zeitalter sein plötzliches Ende.
Schon während der Eroberung wurde mit verschiedenen rechtlichen Grundlagen der Grundstein für die spätere Ausbeutung gelegt. Schon hier wird deutlich wie sehr sich die geistige und die weltliche Unterwerfung gegenseitig bedingten. Diese These wird im Verlauf der Arbeit durch weitere Textbeispiele zu belegen versucht. Dabei wird zuerst näher auf die weltliche Unterwerfung eingegangen und zum besseren Verständnis die Grundzüge der spanischen Verwaltung erklärt. Später wird eine Verbindung zur geistigen Unterwerfung gezogen und auch hier zur Verständniserleichterung auf die Spanische Missionsgeschichte eingegangen. Zum Abschluss der Arbeit wird das Gedankengut des Bartolomé de las Casas präsentiert, das, wenn es umgesetzt worden wäre, eine Alternative zum Verlauf der Konquista geboten hätte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführende Worte
- Die rechtliche Grundlagen der Eroberung Altamerikas
- Die Verwaltung der Kolonien (oder: weltliche Versklavung unter kirchlichem Deckmantel)
- Aus Alt mach Neu: Christentum versus Götterkult (oder: geistige Versklavung auf staatliche Anordnung?)
- Bartolomé De Las Casas oder: die Gewissenskrise
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eroberung Mexikos durch die Spanier und beleuchtet die komplexe Interdependenz von weltlicher und religiöser Unterwerfung der indigenen Bevölkerung. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen der Eroberung, die Rolle der spanischen Krone und die Auswirkungen der Kolonialverwaltung auf die indigene Kultur und Religion.
- Die rechtlichen Grundlagen der spanischen Eroberung und deren Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung.
- Die Rolle der spanischen Krone in der Ausbeutung und Versklavung der Indios.
- Die Interdependenz von weltlicher und religiöser Unterwerfung im Kontext der Kolonisierung.
- Die Auswirkungen der spanischen Kolonialverwaltung auf die soziale und politische Struktur Mexikos.
- Die Gegenposition Bartolomé de Las Casas und seine Kritik an der spanischen Kolonialpolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
Einführende Worte: Der einleitende Abschnitt beschreibt die symbolische Bedeutung der "Stadt über der Stadt" – Mexico City über den Ruinen von Tenochtitlán – als Metapher für die gesamte Eroberungs- und Kolonialzeit. Er betont das scheinbar plötzliche Ende einer ganzen Kultur und Religion mit der spanischen Eroberung und kündigt die These an, dass sich weltliche und geistige Unterwerfung gegenseitig bedingten. Der Text skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit, der die weltliche Unterwerfung, die spanische Verwaltung und die geistige Unterwerfung, sowie die Missionsgeschichte behandelt, um schließlich Bartolomé de Las Casas und seine alternative Sichtweise zu präsentieren.
Die rechtliche Grundlagen der Eroberung Altamerikas: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen Begründungen der spanischen Eroberer für ihre Taten. Es wird deutlich, dass die spanische Krone von Anfang an wirtschaftlich von der Eroberung und Versklavung der Indios profitierte, wie das königliche Fünftel und die Tauschhandels- und Poblamiento-Lizenzen belegen. Das Kapitel analysiert das "Requerimiento", ein 1513 erlassenes Gesetz, das die Indios zur Unterwerfung und zum Konvertierung zum Christentum aufforderte. Die Verlesung in Spanisch und die gewaltsame Durchsetzung des Requerimientos zeigen die Scheinheiligkeit des Anspruchs auf friedliche Bekehrung und offenbaren die Brutalität der Eroberung. Das Kapitel betont die Verbindung zwischen weltlicher Unterwerfung und religiöser Begründung.
Die Verwaltung der Kolonien (oder: weltliche Versklavung unter kirchlichem Deckmantel): Dieses Kapitel beschreibt die spanische Kolonialverwaltung in Amerika. Es erläutert die Rolle von Städten, Kirchen und dem Indienrat als zentrale Institutionen der Unterwerfung. Bernal Díaz del Castillo wird zitiert, um die gewaltsame Unterwerfung und den ideologischen Austausch der indigenen Bevölkerung zu illustrieren. Das Kapitel beschreibt weiterhin die Rolle der Audiencias und Oidores als Machtzentren und die Korruption der Visitadores. Die Verwaltung festigte die weltliche Unterwerfung und diente gleichzeitig als Instrument der ideologischen und kulturellen Umgestaltung.
Schlüsselwörter
Mexiko, Eroberung, Kolonialismus, Unterwerfung, Religion, Spanien, Indios, Bartolomé de Las Casas, Requerimiento, Kolonialverwaltung, Bernal Díaz del Castillo, geistige Versklavung, weltliche Versklavung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Eroberung Mexikos – Weltliche und Geistige Versklavung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eroberung Mexikos durch die Spanier und analysiert die komplexe Verflechtung von weltlicher und religiöser Unterwerfung der indigenen Bevölkerung. Im Mittelpunkt steht die Interdependenz zwischen wirtschaftlicher Ausbeutung und religiöser Bekehrung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der spanischen Eroberung, die Rolle der spanischen Krone, die Auswirkungen der Kolonialverwaltung auf die indigene Kultur und Religion, die Rolle von Kirchen und Verwaltungsapparat in der Unterwerfung, die Korruption innerhalb der Verwaltung, und die Gegenposition Bartolomé de Las Casas.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf historische Dokumente wie das "Requerimiento", und zitiert Augenzeugenberichte, beispielsweise von Bernal Díaz del Castillo, um die gewaltsame Unterwerfung und den ideologischen Austausch der indigenen Bevölkerung zu illustrieren.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die weltliche und geistige Unterwerfung der indigenen Bevölkerung in Mexiko untrennbar miteinander verbunden waren und sich gegenseitig bedingten. Die wirtschaftliche Ausbeutung wurde durch religiöse Rechtfertigung legitimiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu einführenden Worten, den rechtlichen Grundlagen der Eroberung Altamerikas, der Kolonialverwaltung (weltliche Versklavung unter kirchlichem Deckmantel), dem Vergleich Christentum versus Götterkult (geistige Versklavung), Bartolomé de Las Casas und einem Schlusswort.
Welche Rolle spielt Bartolomé de Las Casas?
Bartolomé de Las Casas repräsentiert in der Arbeit eine Gegenposition zur spanischen Kolonialpolitik. Seine Kritik an der Brutalität der Eroberung und der Unterwerfung der Indios wird ausführlich behandelt.
Was ist das "Requerimiento"?
Das "Requerimiento" war ein 1513 erlassenes Gesetz, das die Indios zur Unterwerfung und zum Konvertierung zum Christentum aufforderte. Die Verlesung in Spanisch und die gewaltsame Durchsetzung zeigen die Scheinheiligkeit des Anspruchs auf friedliche Bekehrung und offenbaren die Brutalität der Eroberung.
Wie wird die Kolonialverwaltung dargestellt?
Die Kolonialverwaltung wird als zentrales Instrument der Unterwerfung dargestellt, das durch Städte, Kirchen und den Indienrat strukturiert war. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Audiencias und Oidores als Machtzentren und die Korruption der Visitadores.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mexiko, Eroberung, Kolonialismus, Unterwerfung, Religion, Spanien, Indios, Bartolomé de Las Casas, Requerimiento, Kolonialverwaltung, Bernal Díaz del Castillo, geistige Versklavung, weltliche Versklavung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich akademisch mit der Geschichte der spanischen Kolonialisierung Mexikos auseinandersetzen möchten und an einer detaillierten Analyse der Interdependenz von weltlicher und religiöser Unterwerfung interessiert sind.
- Quote paper
- Andrea Henkel (Author), 2008, Die Nahua unter Spanischer Herrschaft - Die versklavte Hochkultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136722