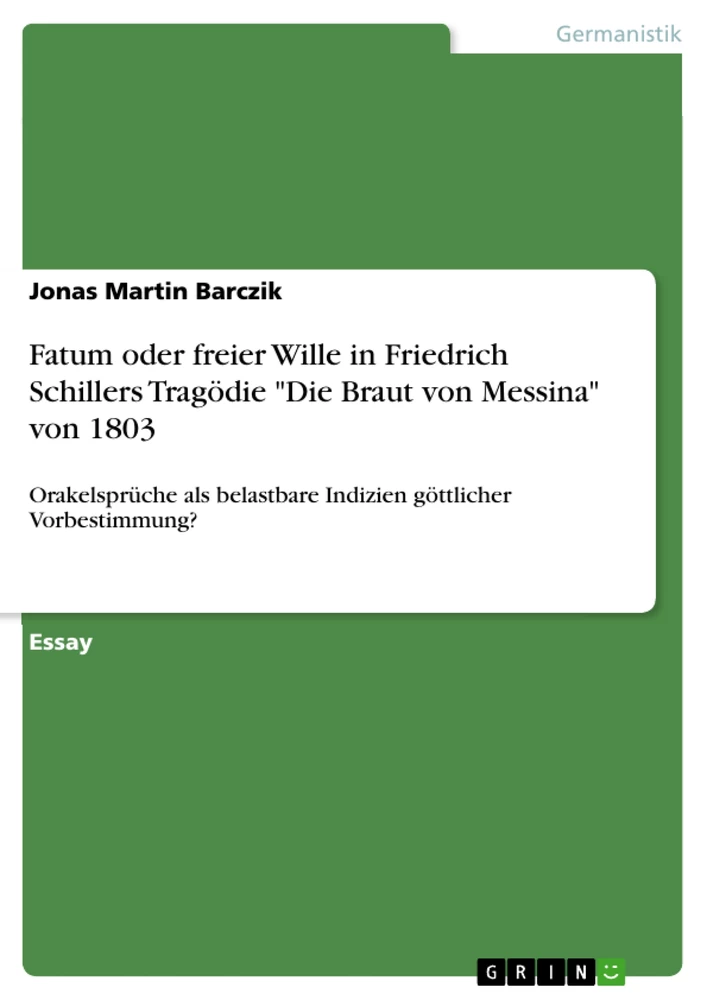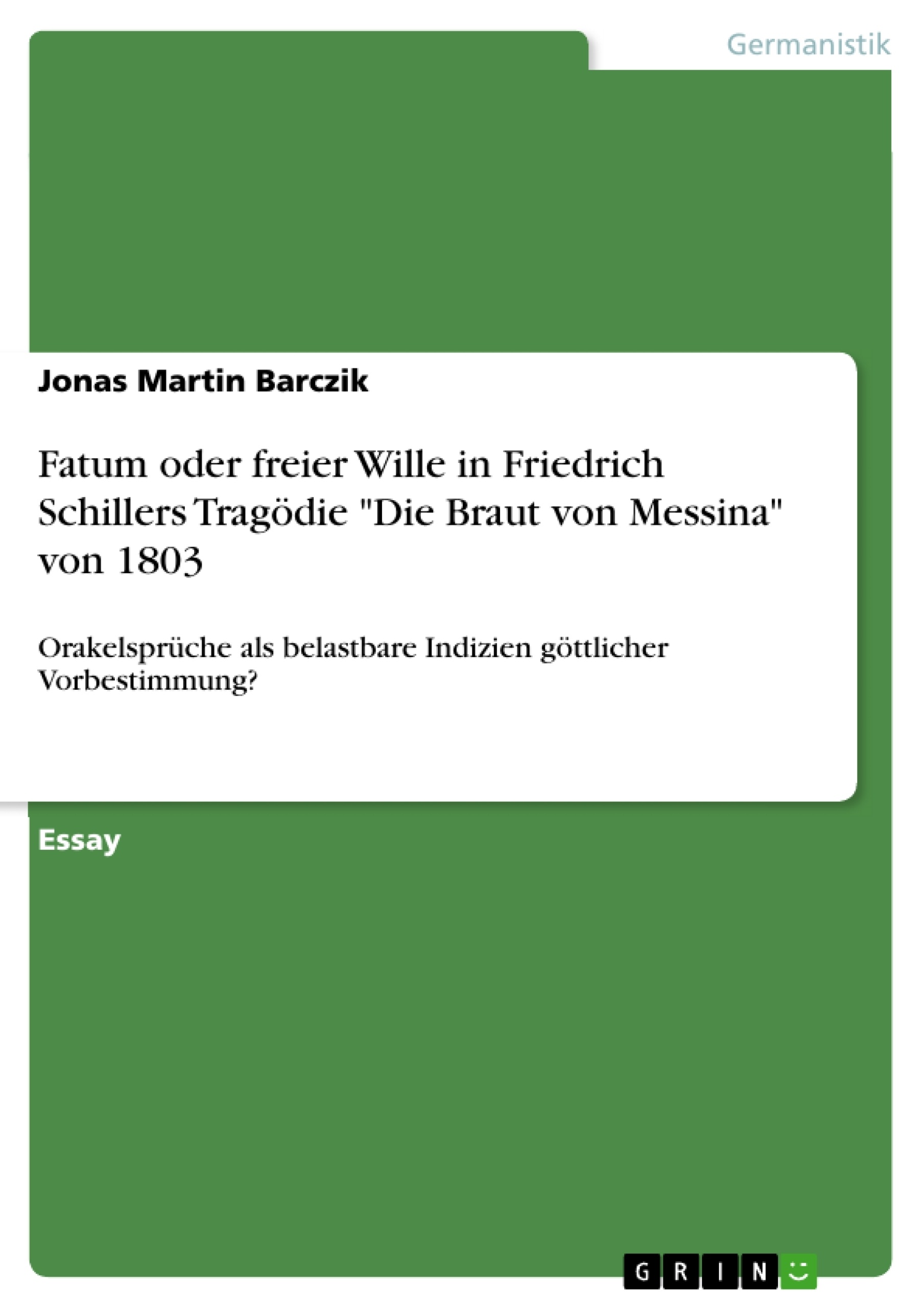Friedrich Schillers Tragödie "Die Braut von Messina" aus dem Jahre 1803 handelt von dem tragischen Schicksal der Herrscherfamilie von Messina, die ihr Ende dramatischer Art, zuvor angekündigt durch mehrere Orakelsprüche, scheinbar selbst hervorruft. Es stellt sich die Frage, ob diese Vorausdeutungen als Zeichen einer göttlichen Vorbestimmung zu sehen sind, oder ob doch die frei getroffenen Entscheidungen der Individuen den Ausgang des Stücks hervorrufen.
Inhaltsverzeichnis
- Fatum oder freier Wille: Können die Orakelsprüche in Schillers "Die Braut von Messina" als belastbare Indizien der göttlichen Vorbestimmung des Familienschicksals angesehen werden?
- Schillers "Die Braut von Messina" und die Elemente der griechischen Tragödie
- Die Orakelsprüche als Indizien einer göttlichen Vorbestimmung?
- Die Rolle des historischen Kontextes
- Die Orakelsprüche und die signa dei
- Die Interpretation der Orakelsprüche und die Fatumstheorie
- Schillers Sozialisierung und seine Weltanschauung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die Orakelsprüche in Friedrich Schillers "Die Braut von Messina" als belastbare Indizien einer göttlichen Vorbestimmung des Familienschicksals angesehen werden können. Der Fokus liegt auf der Analyse der Orakelsprüche im Kontext der Figuren und der Handlung des Dramas, sowie auf der Berücksichtigung des historischen Kontextes und Schillers eigener Weltanschauung.
- Die Verbindung von griechischer Tragödie und christlicher Mythologie in Schillers Werk
- Die Frage nach dem freien Willen und der Vorherbestimmung im Kontext der Orakelsprüche
- Die Rolle des historischen Kontextes und der Aufklärung im Werk Schillers
- Die Interpretation der Orakelsprüche als signa dei und ihre Auswirkungen auf die Handlung
- Schillers Positionierung zur Frage nach der Fatumstheorie und seiner Weltanschauung
Zusammenfassung der Kapitel
- Im ersten Kapitel wird die Fragestellung der Arbeit eingeführt und die Relevanz der Orakelsprüche im Kontext von Schillers "Die Braut von Messina" erläutert.
- Das zweite Kapitel untersucht die Elemente der klassischen griechischen Tragödie in Schillers Werk und diskutiert die Frage, ob es sich um eine reine Imitation oder um eine Mischform von moderner und antiker Schreibkunst handelt.
- Im dritten Kapitel werden die Orakelsprüche als mögliche Indizien einer göttlichen Vorbestimmung näher betrachtet. Dabei wird die Bedeutung der Traumdeutungen und der verschiedenen Orakelgelehrten im Werk Schillers analysiert.
- Das vierte Kapitel beleuchtet den historischen Kontext und die Auswirkungen der französischen Revolution und der Aufklärung auf Schillers Weltanschauung.
- Das fünfte Kapitel analysiert die Orakelsprüche als signa dei und untersucht, wie sie die Handlung des Dramas beeinflussen und die Figuren Entscheidungen treffen lassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Fatum und freier Wille, Orakelsprüche, signa dei, griechische Tragödie, Aufklärung, Schillers "Die Braut von Messina", historische Kontext, Weltanschauung, Dramenanalyse.
- Quote paper
- Jonas Martin Barczik (Author), 2020, Fatum oder freier Wille in Friedrich Schillers Tragödie "Die Braut von Messina" von 1803, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1367007