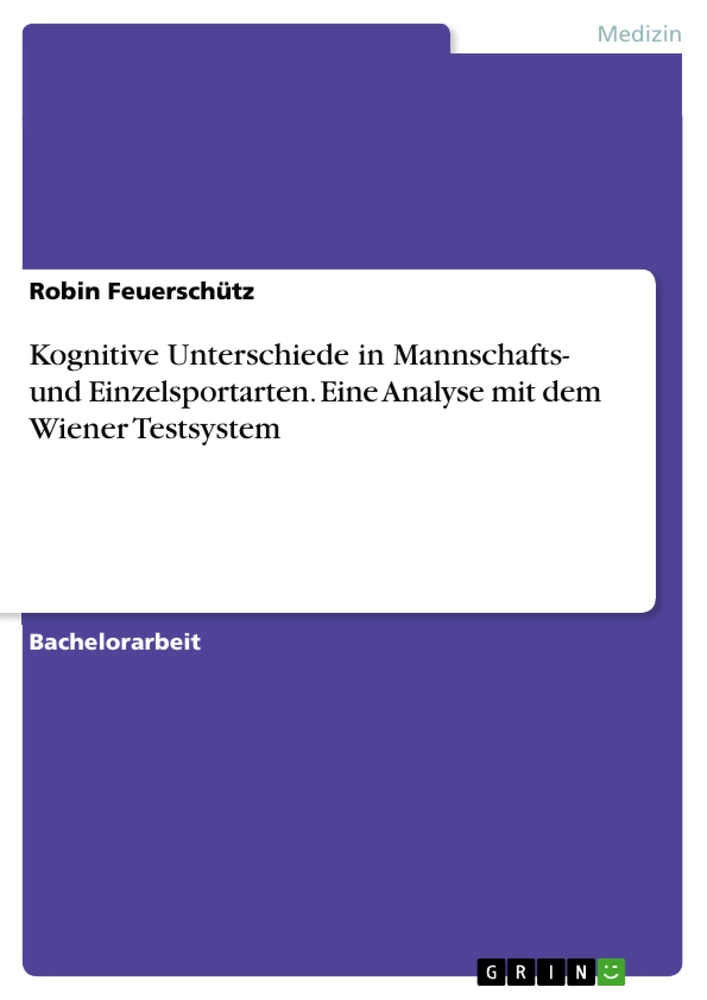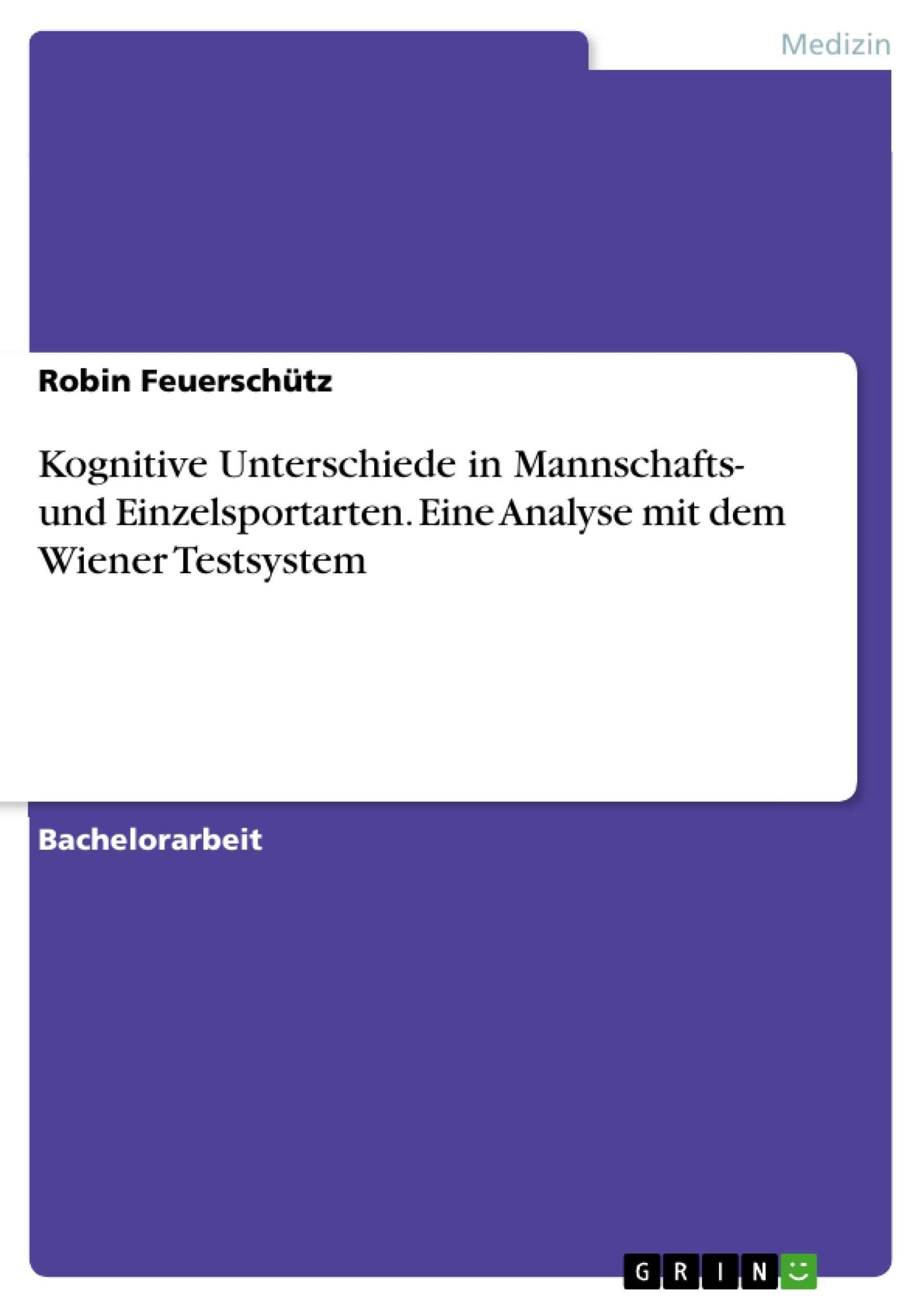Die Hauptzielsetzung dieser Studie ist die Untersuchung und Vergleich der kognitiven Unterschiede zwischen verschiedenen Sportfeldern, insbesondere zwischen Mannschafts- und Einzelsportarten. Konkret werden dabei die periphere Reaktionszeit und die Reaktionszeit bei Wahlreaktionen untersucht.
Im Rahmen einer Querschnittsstudie wurden 534 Teilnehmer im Alter von 7 bis 75 Jahren mittels des Wiener Testsystems einer kognitiven Prüfung unterzogen. Die Tests fanden in einem Labor statt, wo die Daten zu peripherer Reaktionszeit und Reaktionszeit bei Wahlreaktionen erhoben wurden, welche die Basis für diese Studie darstellen.
Inhaltsverzeichnis
I.Zusammenfassung
II.Abstract
III. Abbildungsverzeichnis
IV. Tabellenverzeichnis
V.Abkürzungsverzeichnis
VI.Genderhinweis
1Einleitung
2Theoretische Grundlagen
2.1 Kognition
2.2 Wahrnehmung
2.1.1 Gesichtsfeld
2.1.2 Bedeutung für den Sport
2.3 Aufmerksamkeitsfähigkeit
2.4 Reaktionsfähigkeit
2.5 Reaktionsschnelligkeit
2.6 Das Wiener Testsystem zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten
2.6.2 WTS Testung periphere Wahrnehmung (PP)
2.6.3 WTS Reaktionstest (RT)
3Stand der Forschung
3.1 Experten-Novizen-Paradigma
3.2 Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern
3.3 Geschlecht und Alter als Faktor
4Fragestellung und Hypothese
5Methodik
5.1 Studiendesign
5.2 Stichprobe
5.3 Untersuchungsablauf
5.3.1 Testung PP Reaktionszeit auf linke/rechte Reize
5.3.2 RT mittlere motorische Zeit und mittlere Reaktionszeit
5.4 Statistische Auswertung
6Ergebnisse
6.1 Testung Periphere Wahrnehmung
6.1.1 PP Reaktionszeit auf linke Reize
6.1.2 PP Reaktionszeit auf rechte Reize
6.2. Reaktionstest
6.2.2 RT mittlere Reaktionszeit
6.2.1 RT mittlere motorische Zeit
7Diskussion
8Fazit
VII.Literaturverzeichnis
I. Zusammenfassung
Einleitung: Ziel der Studie war eine Überprüfung der kognitiven Differenzen zwischen den verschiedenen Sportfeldern (Mannschafts- und Individualsportarten). Die periphere Reaktionszeit und die Reaktionszeit bei Wahlreaktionen wurden miteinander verglichen.
Methoden: Insgesamt nahmen 534 Probanden (Alter: 7-75 Jahre) im Umfang einer Querschnittsstudie an einer kognitiven Testung (Wiener-Testsystem) teil. Die Messung nach dem Wiener Testsystem erfolgte im Labor. Die dort erhobenen Daten (periphere Reaktionszeit und Reaktionszeit bei Wahlreaktionen) bilden die Grundlage der Studie.
Ergebnisse: Die Ergebnisse aus dem PP und dem RT zeigen keine signifikanten Differenzen zwischen den Sportfeldern. Der PP zeigt mit Signifikanzniveaus vonp= 0,235 (peripher rechtsseitig) undp= 0,167 (peripher linksseitig), dass das Ergebnis nicht signifikant ist. Der RT zeigt in dem Parameter mittlere motorische Zeit ein Signifikanzniveau vonp= 0,626, in dem Parameter mittlere Reaktionszeit einen Wert vonp= 0,598. H1, H2, H3, H4 konnten nicht unterstützt werden. Das Alter hatte in allen Testungen einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse. Das Geschlecht zeigte hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse.
Schlussfolgerung: Es konnten keine signifikanten kognitiven Differenzen der verschiedenen Sportfelder festgestellt werden. Limitationen der Studie müssen berücksichtigt werden, denn Alter, Geschlecht und Leistungsniveau können einen großen Effekt auf die Ergebnisse haben.
Schlüsselwörter: kognitive Differenzen, Mannschafts- und Individualsportler, Reaktionszeit, periphere Wahrnehmung, Wiener Testsystem, Exekutive Funktionen
II. Abstract
Introduction: The aim of the study was to examine the cognitive differences between the different sports fields (team and individual sports). The peripheral reaction time and the reaction time for choice reactions were compared.
Methods: A total of 534 subjects (age: 7-75 years) took part in a cognitive testing (Wiener-Testsystem) in the scope of a cross-sectional study. The measurement according to the Vienna Test System was performed in the laboratory. The data collected there (peripheral reaction time and reaction time for choice reactions) form the basis of the study.
Results: The results from the PP and RT did not show significant differences between the sports fields. The PP shows with significance levels ofp= 0.235 (peripheral right) andp= 0.167 (peripheral left) that the result is not significant. The RT shows in the parameter mean motor time a significance level ofp= 0.626, in the parameter mean reaction time a value ofp= 0.598. H1,H2,H3,H4 could not be supported. Age had a significant influence on the results in all tests. Gender did not show a significant influence on the results.
Conclusion: No significant cognitive differences of the different sport fields could be found. Limitations of the study have to be considered, because age, gender and performance level can have a large effect on the results.
Keywords: cognitive differences, team and individual athletes, reaction time, peripheral perception, Vienna Test System, executive function
III.Abbildungsverzeichnis
Abb. 1. Probandenbildschirm WTS (Söhnlein & Borgmann, 2018, S. 37)
Abb. 2. Aufbau Testung periphere Wahrnehmung (Schuhfried, 2014, S. 24)
Abb. 3. Grafische Darstellung der Altersverteilung
Abb. 4. Boxplots der vier Parameter, Differenzen der Altersgruppen
IV.Tabellenverzeichnis
Tab. 1. Deskriptive Darstellung Sportarten
Tab. 2. Ergebnisse ANVOCA (Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanz)
V. Abkürzungsverzeichnis
Abb Abbildungen
ANCOVA Kovarianzanalyse SPSS
DT Determinationstest
EF exekutive Funktionen
KKT komplexe Konzentrationstest
M Mittelwert
msec Millisekunden
M-RZ mittlere Reaktionszeit
n Größe der Grundgesamtheit
PP Test zur peripheren Wahrnehmung
RT Reaktionstest
RTL periphere Reaktionszeit links
RTR periphere Reaktionszeit rechts
SD Standardabweichung
WTS Wiener-Testsystem
VI. Genderhinweis
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Bachelorarbeit die männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. Im Sinne der sprachlichen Vereinfachung soll dies als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
1 Einleitung
Der heutige Leistungssport ist geprägt durch hohe physische und technisch - taktische Anforderungen. Hinsichtlich der physischen Leistungsfähigkeit scheinen den Athleten natürliche Grenzen gesetzt zu sein. Allerdings setzt sich die Leistungsfähigkeit von Sportlern nicht nur aus konditionellen und technischen Komponenten zusammen (Weineck, Memmert & Uhing, 2012). Die Bedeutung kognitiver Fähig- und Fertigkeiten nimmt im Sport immer weiter zu und wird sowohl in Mannschaftssportarten als auch in Individualsportarten als Faktor für Spitzenleistungen gesehen (Vestberg et al., 2012; Williams, M.A., Davids, K., & Williams, J. (Eds.), 1999)
Dies beginnt bei der Informationsaufnahme durch verschiedene Sensoren, woraufhin die gewonnenen Reize gefiltert, subjektiv eingeschätzt und bewertet werden. Abschließend erfolgen Entscheidungsprozesse oder Ursachenklärungen aus erfolgreichen und missglückten Handlungen (Stoll, 2010). Für den Sportler ist es entscheidend schnellstmöglich auf optische, auditive oder taktile Reize reagieren zu können (Grosser & Renner, 2007). Vor allem Mannschaftssportarten werden durch viele kognitive Prozesse insbesondere der Wahrnehmungsfähigkeit und der schnellstmöglichen Reaktion auf die wahrgenommenen Reize geprägt. Aufgrund der im Mannschaftssport ständig wechselnden Spielsituationen wird den Prozessen der Informationsaufnahme und der Informationsverarbeitung ein hoher Stellenwert zugerechnet. So ist eine pausenlose Wahrnehmung von Spielraum, Ziel, Mitspieler, Gegner und dem Spielgerät notwendig, um Spielhandlungen erfolgreich regulieren zu können (Konzag & Konzag, 1981). Auch in Individualsportarten sind kognitive Prozesse wichtig, um sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Ein typischer kognitiver Prozess der fundamental ist, ist auch hier die Reaktionsfähigkeit „zur schnellen Einleitung und Ausführung zweckmäßiger motorischer Aktionen auf mehr oder weniger komplizierte Signale“ (Meinel, Schnabel & Krug, 2007, S. 223).
Mannschafts- und Individualsportarten haben verschiedene Anforderungsprofile, weshalb sich mehrere Sportarten zu einer Gruppe ähnlicher Profile zusammenfassen lassen (Turkeri, Ozturk, Buyuktas, & Ozturk, 2019). Mannschaftssportarten sind Sportarten, in denen meist zwei verschiedene Gruppen versuchen, die gegnerische Gruppe unter Voraussetzung bestimmter Regeln zu schlagen, indem sie die wahrnehmenden, kognitiven, motorischen und technischen Eigenschaften des ausgeübten Sports nutzen (Turkeri, Ozturk, Buyuktas, & Ozturk, 2019). Dieses Sportfeld definiert ein ähnliches Anforderungsprofil und erfordern von den Athleten, dass sie große Mengen an Informationen unter hohen psychischen und physischen Druck verarbeiten sowie gleichzeitig schnelle, komplexe Entscheidungen treffen können. Die Sportler müssen sich so schnell wie möglich auf der Grundlage von peripheren und zentralen visuellen Informationen bewegen, weshalb von ihnen eine gute periphere visuelle Wahrnehmung verlangt wird.
Individualsportarten sind einerseits Sportarten, bei denen Leistung erbracht werden, die selbstgesteuert geschehen und nicht von anderen Wettkämpfern verhindert werden können. In diesen Sportarten tritt der Athlet im Wettkampf mit sich selbst an und muss eigenverantwortliche alle sportartbezogenen Eigenschaften ausreichend und fehlerfrei zeigen, um erfolgreich zu sein. Andererseits fallen auch Sportarten, wie z.B Tennis und Kampfsportarten in die Kategorie bei denen der Athlet versucht, seinen direkten Konkurrenten nach festgelegten Regeln, mit Hilfe seiner kognitiven- und physischen Fähigkeiten zu schlagen (Turkeri, Ozturk, Buyuktas, & Ozturk, 2019). Somit müssen auch Individualsportler ein hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten besitzen. Vor allem das Reagieren ist in sport-bezogenen Situationen ein wichtiger Faktor für Erfolg. Typische Beispiele dieser Art von kognitivem Reiz sind Startsignale, bei denen schnellstmöglich reagiert werden muss, um Spitzenleistungen zu erbringen.
Zu den grundlegenden Elementen der Wahrnehmungsfähigkeit eines Sportlers gehören die visuelle periphere Reaktionsschnelligkeit und das periphere Sehen, welche in der vorliegenden Arbeit genauer beleuchtet werden.
Die offensichtliche Relevanz kognitiver Faktoren hat in den letzten Jahrzehnten umfangreiche sportpsychologische Forschungen angeregt. Die zentrale Frage ist, wie sich jahrelange Praxis in verschiedenen Sportarten auf die kognitiven Funktionen der Athleten auswirkt (Voss et al., 2010). Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, individuelle Unterschiede in der sportlichen Expertise und die Besonderheiten einer bestimmten Sportart zu berücksichtigen. Betrachtet man die Charakteristika von Mannschaftssportarten, die permanente Entscheidungen unter Zeitdruck in sich dynamisch verändernden und unvorhersehbaren Situationen einfordern (Huijgen et al., 2015), wird die Relevanz kognitiver Funktionen sehr deutlich. Auch die Reaktionsfähigkeit wird in verschiedenen Kontexten gefordert. Eine schnelle Reaktionszeit stellt sowohl in Mannschaftssportarten als auch in Individualsportarten eine fundamentale Eigenschaft für sportlichen Erfolg dar. Die sportbezogene Reaktionsschnelligkeit wird je nach Sportart und Sportfeld anderweitig abverlangt und ist die Fähigkeit, ein optisches, akustisches und taktiles Signal maximal schnell aufzunehmen und zu verarbeiten (Hirtz, 2012). Man kann somit zu der Annahme kommen, dass die Sportfelder (Mannschaftsund Individualsportarten) auch unterschiedlich ausgeprägte kognitive Fähigkeiten, vor allem in der peripheren Reaktionszeit und Reaktionszeit bei Wahlreaktionen, aufweisen.
Im Hinblick auf die kognitiven Unterschiede von Athleten verschiedener Sportfelder, haben zahlreiche Studien sich mit den kognitiven Differenzen zwischen Sportarten und Sportfeldern auseinandergesetzt (z.B Nuri et al., 2013; Aslan, 2018; Voss et al., 2010). Die Ergebnisse von Krenn et al. (2018) unterstreichen die Rolle der Exekutiven Funktionen im Hochleistungssport und zeigen, dass sich die Athleten je nach Sportart kognitiv unterscheiden. Die meisten Studien vergleichen „open-skill-sports“, in denen Athleten auf sich ständig verändernde Situationen in einem dynamischen Umfeld reagieren müssen, mit „closed-skill-sports“, bei denen das sportliche Umfeld für die Athleten relativ gleichbleibend, vorhersehbar und selbstbestimmend ist (Krenn et al.,2018). In Bezug auf die Reaktionszeit wurden unterschiedliche Ergebnisse publiziert. Studien bei denen die „open-skill-sports“ bzw. Mannschaftssportler bessere Reaktionsfähigkeiten gegenüber den „closed-skill-sports“ bzw. Individualsportlern aufweisen (Ong, 2017; Kida et al., 2005), stehen Ergebnisse gegenüber, die keine signifikanten Unterschiede beschreiben (Yu, Chan, Chau & Fu ,2017; Kida et al., 2005).
Vor dem Hintergrund des Experten-Novizen Paradigmas haben Untersuchungen gezeigt, dass Experten einer Sportart den Novizen kognitiv überlegen sind (Scharfen & Memmert, 2019; Vaughan & Edwards, 2020). Sie weisen Vorteile im Bereich der taktischen Voraussagen, der Präzision, der Antizipation und dem situativen Anpassen der visuellen Suchstrategie auf. Die Ergebnisse von Nakamoto & Mori (2008) legten nahe, dass eine gute Reaktionsfähigkeit ein Index für sportartspezifische Expertise ist. In der Untersuchung erzielten die Experten bessere Ergebnisse, als die Novizen. Auch Gabbett et al. (2008) führen die Erkennung spielrelevanter Muster und ein schnelleres, durch weniger Fehler charakterisiertes Entscheidungshandeln als Vorteile der Experten an. Auch Nimmerichter et al. (2015) zeigen auf, dass hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten signifikante Unterschiede zwischen Experten einer Sportart und Novizen bestehen.
Basierend auf diesem diskutablen Forschungsstand und der oben beschriebenen Relevanz untersucht die vorliegende Studie die periphere Reaktionszeit und die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben und vergleicht dabei die beiden vorgestellten Sportfelder miteinander (Mannschafts-und Individualsportarten).
Angesichts der Thematik wurden im Rahmen dieser Arbeit 534 Kaderathleten der Universität Hamburg miteinander verglichen. Dieser Vergleich basiert auf den Daten einer Querschnittsuntersuchung, welche am sportlichen Institut der Universität Hamburg durchgeführt wurde. Das Hauptaugenmerk der Arbeit wird dabei auf die periphere Reaktionszeit sowie die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben gelegt. Zusätzlich wurden das Alter und das Geschlecht der Athleten berücksichtigt, da diese Faktoren Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten haben können (Chraif, 2013; Ong, 2017; Schumacher et al., 2020).
In den theoretischen Grundlagen sollen zunächst der Begriff Kognition und das Messinstrument dieser Studie erläutert werden, ehe eine Hinführung zum Untersuchungsgegenstand der vier Parameter erfolgt. Der aktuelle Forschungsstand soll anschließend Aufschluss über aktuelle Kognitionsstudien geben und kognitive Unterschiede zwischen den verschiedenen Sportfeldern aufzeigen. Die auf dem theoretischen Hintergrund aufbauenden Fragestellungen und die dazugehörigen Hypothesen gilt es zu überprüfen. Im methodischen Teil werden das Studiendesign, die Stichprobe und der Untersuchungsablauf beschrieben. Der Ergebnisteil, welcher die Auswertung der erfassten Daten beinhaltet, dient als Grundlage für die nachfolgende Diskussion. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab.
2 Theoretische Grundlagen
Um ein grundlegendes Verständnis über die wesentlichen Aspekte und Ziele der vorliegenden Arbeit zu erlangen, ist eine Einführung in den theoretischen Hintergrund nötig. Dieser beinhaltet eine Einordnung des Themas, den definitorischen Einblick in den psychischen Leistungsfaktor der Kognition, eine detaillierte Erläuterung des kognitiven Messsystems und den Stand der Forschung, um ein fundiertes Wissen über die aktuelle Studienlage zu erlangen.
In der Psychologie werden grundlegende kognitive Fähigkeiten, die das Verhalten steuern, als exekutive Funktionen (EF) beschrieben (Höner, 2017). Exekutive Funktionen werden unterteilt in Kernfunktionen („core-executive functions“), welche die Aufmerksamkeitskontrolle, Inhibitation, das Arbeitsgedächtnis, sowie die kognitive Flexibilität steuern und in höhere exekutive Funktionen (higher-order executive functions“), zu denen Denken, Problemlösung und Planung zählen (Schumacher et al., 2018). Bislang hat sich die Forschung wenig mit der Analyse exekutiver Funktionen der verschiedenen Sportarten befasst. Die unterschiedlichen kognitiven Anforderungen der verschiedenen Sportarten und deren bewusste Ausübung sollten aber Unterschiede in den exekutiven Fähigkeiten aufzeigen. Kognitive Prozesse, vor allem die Regulation der Aufmerksamkeit, sind sowohl bei Mannschaftssportarten als auch in Individualsportarten entscheidend (Alfermann & Stoll, 2010). Anlässlich der bestehenden Forschungslücke existieren aber nur wenige evidenzbasierte Studien, die das Forschungsfeld der kognitiven Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern untersuchen.
2.1 Kognition
Die individuelle Leistungsfähigkeit im Mannschaftssport sowie in Individualsportarten wird durch mehrere Leistungsfaktoren determiniert. Eine Komponente der Leistungs- und Spielfähigkeit ist der psychische Leistungsfaktor der Kognition, welcher Hauptbestandteil dieser Arbeit sein soll. Aufgrund der breitgefächerten Fachgebiete der Kognition gibt es viele verschiedene Definitionen. Der Begriff „Kognition“ (lat.cognitiofür „Erkenntnis“) ist ein „Sammelbegriff für Prozesse und Strukturen, die sich auf Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen beziehen“ (Hänsel, Baumgärtner & Kornmann 2016). Disziplinübergreifend werden unter dem Begriff Kognition „alle Gedächtnis- und Informationsverarbeitungsprozesse des Menschen inklusive deren exekutive Kontrolle“ beschrieben (Davis & Lambourne, 2009). Nach Kluwe (2001) wird Kognition „als Sammelbezeichnung für die geistige Aktivität von Menschen verwendet“.
Die Sportpsychologie versteht unter Kognition eine ganze Reihe von „Phänomenen“, welche zwischen einem von außen kommendem Reiz (Inputreiz) sowie dem Verhalten vermitteln „und damit als Teil eines Systems verstanden werden können“ (Hagendorf et al. 2011, S.22). Dieses System nimmt Informationen auf, vermittelt und speichert sie (Hagendorf et al. 2011).
Für den Kontext der Sportspiele können Kognitionen als „höhere geistige Funktionen und Prozesse“ beschrieben werden, „die notwendig sind, um in bestimmten Situationen gezielt adäquate Lösungen zu generieren“ (Memmert, 2016, S. 24). Beispiele für kognitive Faktoren im Sport sind Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Entscheidung, Planung und Gedächtnis, welche einerseits die sensomotorische Kontrolle von Bewegungen bilden. „Andererseits basieren auch taktische Handlungen im Sport, also kurzfristige, situative Problemlösungs- und Entscheidungsprozesse des Sportlers“, auf diesen Prozessen (Memmert, 2016, S. 24). Insbesondere Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse sind grundlegend für das angemessene individualtaktische Verhalten des Spielers (Höner, 2017; Memmert, 2016).
Aus einer handlungspsychologischen Perspektive beeinflussen die kognitiven Prozesse den sportlichen Handlungsprozess deutlich (Gabler, 1995; Höner, 2017). In der ersten Phase, der Antizipationsphase, sind Kalkulations- und Planungsprozesse notwendig, in der der Sportler zwischen zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten wählt und eine Entscheidung trifft. Nachdem die Entscheidung für eine zweckmäßige Handlung getroffen wurde, beginnt die Realisationsphase, in der eine motorische Umsetzung stattfindet. Nach der Umsetzung der geplanten Handlung erfolgt in der Interpretationsphase eine Beurteilung, in welcher der Erfolg der Handlung vom Sportler reflektiert wird (Gabler, 1995; Stoll, 2010; Thumfart, 2006).
Eine noch detailliertere Betrachtung der kognitiven Faktoren erfolgt in der kognitionspsychologischen Sportspielforschung, in der sich zwei Forschungsansätze gegenüberstellen lassen. Der „Expert Performance Approach“ und der „Cognitive Component Skills Approach“ unterscheiden sich bezüglich der Frage, ob sich Experten im Sport durch sportartspezifische Expertise oder durch eine allgemeine, sportartunspezifische kognitive Leistungsfähigkeit auszeichnen. Eine genauere Betrachtung des Experten- Novizen-Paradigmas erfolgt im Stand der Forschung (sieheKapitel 3).
2.2 Wahrnehmungsfähigkeit
Eine sportliche Handlung ist ohne Wahrnehmungsprozesse schwer denkbar. Ein Hockeyspieler fühlt seinen Schläger in der Hand, er sieht das Spielfeld sowie den Ball vor sich und nimmt körperlich wahr, ob er in der Lage ist, bestimmte Situationen zu lösen. Unter Wahrnehmung versteht man bewusste sensorische Erfahrungen (Goldstein, 2007) und im weiteren Sinne einen „Prozess, mit dem die von den Sinnesorganen bereitgestellten Informationen organisiert und interpretiert werden“ (Hagendorf et al. 2011, S. 5).
„Wahrnehmung ist ein aktiver psychischer Prozess, bei dem ein Sportler auf Basis von Lernerfahrungen ein subjektives Abbild eines Objekts konstruiert“ (Gabler, 2004, S. 8). Die Handlungssteuerung läuft multimodal ab und basiert auf verschiedenen Ebenen: der visuellen Wahrnehmung (Sehen), der akustischen oder auditiven Wahrnehmung (Hören), der taktilen Wahrnehmung (Tastsinn), der olfaktorischen Wahrnehmung (Riechen) und der gustatorischen Wahrnehmung (Schmecken) (Spering & Schmidt, 2009; Conzelmann, Hänsel & Höner, 2013). Zusätzlich tauchen in der Literatur weitere Wahrnehmungsebenen auf, die im sportlichen Kontext wichtig sind: die propriozeptive Wahrnehmung (Wahrnehmung von Körperbewegung und -lage im Raum) und die vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn). Bei den zuletzt genannten Ebenen werden Informationen in erster Linie nicht durch die Außenwelt aufgenommen, sondern durch den eigenen Körper produziert. Wahrnehmung kann von dem Sportler somit von außen (Fremdwahrnehmung) oder innen (Selbstwahrnehmung) ausgehen. Im Folgenden soll die visuelle Ebene genauer betrachtet werden, da ihr im Sport ein besonderer Stellenwert zugeschrieben wird.
2.1.1 Gesichtsfeld
Das gesamte Gesichtsfeld beträgt bei beidäugigem Sehen ca. 200 Grad in der waagerechten Ebene und in der senkrechte Ebene 55 Grad nach oben und 75 Grad nach unten. Die zentrale (foveale) Wahrnehmung und die periphere Wahrnehmung, definieren zusammen das visuelle Feld. DerfovealeBereich umfasst lediglich 2 Grad des Gesichtsfeldes und ermöglicht ein scharfes Sehen. Die übrige Netzhaut bilden den Bereich des peripheren Sehens, in dem sich Bewegungen deuten lassen, allerdings nicht im Detail. Über die periphere Wahrnehmung wird die Umwelt dauernd gescannt. Nach Entdecken von Veränderungen werden Blickbewegungen eingeleitet, um die jeweiligen Objekte zu fixieren bzw. über das foveale Sehen scharf wahrzunehmen (Memmert et al., 2019).
Das periphere Sehen ist prädestiniert für ein gutes Wahrnehmungsvermögen schneller Bewegungen und die rasche Auffassung von Gefahrenobjekten. Die genaue Identifizierung erfolgt nach Blickzuwendung in der Fovea centralis (Sehgrube), weshalb die periphere- und zentrale Wahrnehmung als funktionales Zusammenspiel eines Systems beschrieben werden können. Im Sport laufen Wahrnehmung, foveales und peripheres Sehen also simultan ab. Diese funktionale Unterteilung lässt sich mit einem Minimum an neuronalem Aufwand erzielen und erleichtert die selektive Aufnahme von Umweltsituationen mit einer möglichst hohen Detail- und Zeitauflösung (Lachenmayer, 1989). Die meisten Aktionen, die der Mensch wahrnimmt, ereignen sich peripher, sodass die aktive Aufnahme von möglichst vielen Prozessen in vielen Sportarten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeutet (Memmert et al., 2020).
2.1.2 Bedeutung für den Sport
Ohne angemessene Wahrnehmungsfähigkeit können relevante Informationen (akustisch, taktil, optisch) vom Sportler nicht adäquat aufgenommen, verarbeitet und in eine motorische Handlung umgesetzt werden. Vor allem Sportspieler befinden sich häufig in sehr komplexen Situationen und haben in der Regel wenig Zeit. Expertise im Sportspiel zeichnet sich daher auch durch ein großes Maß an einer hohen Wahrnehmungsgabe aus (Noel & Dicks, 2013). Das menschliche Auge ist das Sinnesorgan für die visuelle Wahrnehmung und bildet eine Orientierungsgrundlage für jeden Sportler. Die visuelle Wahrnehmung dient der Kontrolle von Eigenbewegung sowie der Antizipation von Fremdbewegungen und erlaubt eine Beurteilung von verschiedenen Bewegungsmustern (Jendrusch & Brach, 2003).
Gerade in den Sportspielen ist das periphere Sehen wichtig, um Bewegungen von Mit- und Gegenspielern wahrzunehmen und daraufhin effektiv reagieren zu können (Schapschröer et al., 2011). Die periphere Wahrnehmung ermöglicht nicht nur, den nächsten Fixationspunkt zu finden und auszuwählen, sondern Spielsituationen als Ganzes wahrzunehmen. Dazu können Spielfeldgröße und -begrenzungen, Ziele, aber auch bewegliche Objekte wie Mit- und Gegenspieler zählen (Memmert et al., 2019). Talentierte Spieler fixieren z.B. den Ball foveal, während sie ihre Umgebung mit Mitspielern und Gegenspielern peripher beobachten. Dadurch verrät der Spieler nicht, wie seine Folgeaktion aussehen wird. Damit kann z.B. eine Abwehraktion des Gegenspielers verhindert werden. In Individualsportarten kommen vermehrt die propriozeptive Wahrnehmung sowie die vestibuläre Wahrnehmung zum Tragen und garantieren beispielsweise dem Turner ein kontrolliertes Bewegungsrepertoire (Nierhoff, 2003).
2.3 Aufmerksamkeitsfähigkeit
Die kognitiven Prozesse beginnen mit der Wahrnehmung, wobei diese von der Aufmerksamkeit abhängig ist (Alfermann & Stoll, 2017; Gabler, 1995; Gabler, Nitsch, & Singer, 1995).
Die Aufmerksamkeit hat einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl bestimmter Informationen für die Umsetzung eines bestimmten Handlungsziels. Die für aktuelle Handlungen relevanten Informationen werden im Rahmen der Aufmerksamkeit gezielt ausgewählt. Über den Aufmerksamkeitsprozess werden Informationen, die für die Realisierung des Handlungsziels benötigt werden, selektiert bzw. irrelevante Informationen, die dem Handlungsziel nicht dienen, werden ausgeblendet. Innerhalb des Wahrnehmungsprozesses ist die Aufmerksamkeit also ein „Subprozess, dessen Aufgabe es ist, die für den Organismus relevanten Aspekte der Welt aus dem verfügbaren, riesigen Informationspool zu selektieren“ (Hagendorf, Krummenacher & Schubert, 2011, S. 182).
2.4 Reaktionsfähigkeit
Nach Hirtz (1988) ist die Reaktionsfähigkeit eine der fünf fundamentalen koordinativen Fähigkeiten des Menschen. Eine sportbezogene Definition beschreibt sie als Fähigkeit „zur schnellen Einleitung und Ausführung zweckmäßiger motorischer Aktionen auf mehr oder weniger komplizierte Signale“ (Meinel, Schnabel, & Krug, 2007, S. 223). Diese Signale werden akustisch, optisch oder taktil erfasst. In der Literatur werden zwei Arten von Reaktionen differenziert: die Einfachreaktion und die komplexe Reaktion bzw. Wahlreaktion. Vor allem in Individualsportarten reagiert der Sportler vermehrt auf ein akustisches Signal mit einem vorgegebenen, festen Bewegungsablauf (Leichtathletik, Schwimmen). Eine Antwort auf diese Art von Reiz, nennt man einfache Reaktion. Komplexe Reaktionen/ Wahlreaktionen werden vom Sportler verlangt, wenn beim Auftreten einzelner Reize mehrere Handlungsalternativen möglich sind. Wenn der Athlet beispielsweise auf ein Situation trifft, bei der motorische Antworten nicht vorgeschrieben sind, muss auf die relevanten Reize mit einer der Situation angepassten Reaktion geantwortet werden (Grosser & Renner, 2007; Grosser, Starischka, & Zimmermann, 2015; Hirtz, 2012; Meinel et al., 2007; Schnabel et al., 2011). Wahlreaktionen treten insbesondere in Spielsportarten auf (Weineck, 2004).
2.5 Reaktionsschnelligkeit
Die sportbezogene Reaktionsschnelligkeit ist die Fähigkeit, ein optisches, akustisches und taktiles Signal maximal schnell aufzunehmen und zu verarbeiten (Hirtz, 2012). Wesentliche Beeinflussungsfaktoren sind die Geschwindigkeit und Qualität der Wahrnehmungs-, Antizipations- und Entscheidungsprozesse (Grosser et al., 2015; Neumaier, 2016; Weineck, 2004). Um die Reaktionsschnelligkeit messbar zu machen, wird die Reaktionszeit als Indikator verwendet. Die Reaktionszeit ist die Zeit, die zwischen dem Setzen eines Sinnesreizes und dem Beginn der willkürlichen motorischen Reaktion vergeht (Schnabel et al., 2011).
Zaciorskij (1972) gliedert die Reaktionszeit in fünf hintereinander geschaltete Phasen, welche von Grosser & Renner (2007) mit übersichtlichen Teilüberschriften versehen wurden.
1. Wahrnehmungsphase: Auftreten einer Erregung im Rezeptor
2. Afferente Leitungsphase: Überführung der Erregung auf das zentrale Nervensystem
3. Informationsverarbeitungsphase: Übergang des Reizes in die Nervennetze und Bildung des effektorischen Signals
4. Efferente Leitungsphase: Eintritt des Signals vom Zentralnervensystem in den Muskel
5. Latenzzeitphase: Reizung des Muskels und Entstehung einer mechanischen Aktivität im Muskel
Die Reaktionszeit und die ausgeführte Bewegungszeit ergeben zusammen die Handlungsdauer (Singer, 1985). Die Bewegungszeit ist definiert als die Zeit, die der Sportler benötigt, um die erste Zielbewegung nach der Reaktion zu realisieren (Krüger, 1982). Durch die Differenzierung der beiden Begrifflichkeiten kann in kognitiven Untersuchungen zwischen Reaktionszeit und motorischer Zeit differenziert werden. Somit sind präzise Aussagen für beide Komponenten möglich (Schuhfried, 2014)
2.6 Das Wiener Testsystem zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten
Im Leistungssport nimmt die Relevanz der kognitiven Fähig- und Fertigkeiten immer weiter zu, weshalb Kognitionen im Sport mittlerweile systematisch ausgebildet, optimiert und trainiert werden. Dafür ist es notwendig, Athleten mit Hilfe diagnostischer Verfahren reliabel und valide zu testen und zu diagnostizieren. Das Wiener Testsystem (WTS) zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten im Sport ist ein computergestütztes Trainings- und Diagnoseinstrument der österreichischen Firma Schuhfried. Das WTS umfasst eine Reihe psychologischer Reaktions- und Aufmerksamkeitstests, die für verschiedene Fachgebiete von Relevanz sein können. In den Bereichen Verkehrspsychologie, Neurologie, Personalwesen und Sport ist das WTS ein bewährtes Diagnose-Tool, um kognitionspsychologische Daten auszuwerten und zu erfassen. Die Aufgabenstellung sowie die Reizdarbietung erfolgt auf Computerbildschirmen und ist in mehrere Testreihen unterteilt. Es existieren folgende sportrelevante Testsysteme: der Determinationstest (DT), welcher einer Erfassung der reaktiven Belastbarkeit sowie der damit verbundenen Reaktionsfähigkeit dient; der Test zur peripheren Wahrnehmung (PP), mit dem die Fähigkeit zur Aufnahme und Verarbeitung peripherer visueller Informationen überprüft werden kann; der komplexe Konzentrationstest (KKT), bei dem die Konzentrationsleistung einer Person mittels unterschiedlichster Aufgabenmaterialien kontrolliert wird und der Reaktionstest (RT), welcher je nach Testform die Reaktionszeit sowie die motorische Zeit erfasst (Schuhfried, 2014; Schuhfried, 2016). Ong (2015) stellte in seinem Review einen Überblick bezüglich der Verwendung des Wiener Testsystems in der sportpsychologischen Forschung zusammen. In der Übersichtsarbeit wurde auf 22 Studien hingewiesen, die kognitive Leistungen von Athleten untersuchten. Mit der Testung zur peripheren Wahrnehmung und dem Reaktionstest ist es möglich, die periphere Reaktionszeit sowie die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben miteinander zu vergleichen. In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit werden im Folgenden die beiden Testreihen und ausgewählte Ergebnisse von Ong (2015) vorgestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1. Probandenbildschirm WTS (Söhnlein & Borgmann, 2018, S. 37)
2.6.1 WTS Testung periphere Wahrnehmung (PP)
Der PP testet die Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit visueller Reize im peripheren Gesichtsfeld und setzt sich aus zwei Teilaufgaben zusammen. Zum einen muss der Proband eine Trackingaufgabe absolvieren, indem er auf einem Computerbildschirm ein sich bewegendes Fadenkreuz verfolgen muss. Zusätzlich wird währenddessen eine periphere Wahrnehmungsaufgabe absolviert, indem der Proband versucht, auf Reize im peripheren Gesichtsfeld zu reagieren. Hierfür sind an der Seite des Computerbildschirms zwei Leuchtdioden-Arme konstruiert, welche aus dem Gesichtsfeld des Probanden von 180 Grad hinausragen. Diese erzeugen in zeitlichen Abständen kontinuierlich Lichtreize, auf die der Proband durch das Drücken von Fußpedalen reagieren soll. Durch die Reaktion können die Größe des Gesichtsfeldes und die Aufmerksamkeitsleistung abgeleitet werden (Schuhfried, 2014; Söhnlein & Borgmann, 2018).
Eine Studie von Zwierko (2008) zeigte anhand der PP, dass Athleten im Vergleich zu Nicht-Sportlern signifikant schnellere periphere Reaktionen aufweisen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. Aufbau Testung periphere Wahrnehmung (Schuhfried, 2014, S. 24)
2.6.2 WTS Reaktionstest (RT)
Der RT erfasst die Reaktionszeit sowie die motorische Zeit und setzt sich aus acht verschiedenen Testformen zusammen. Die Testformen S1-S5 messen die Reaktionszeit und motorische Zeit auf einfache und komplexe optische bzw. akustische Signale, S3 und S4 beinhalten kritische Reizkombinationen. Auf alle Reize soll mit einem möglichst raschen Betätigen oder Loslassen der Drucktaste auf einen Lichtreiz (gelbes oder rotes Licht), einen Ton (2000 Hz) oder eine Kombination aus Lichtreiz und Ton reagiert werden. Damit wird die „Grund-Reaktionszeit“ gemessen. Für die Auswertung relevant sind die Hauptvariablenmittlere Reaktionszeitundmittlere motorische Zeit.Diemittlere Reaktionszeit(M-RZ msec) ist die Zeit zwischen dem Beginn der Darbietung des geforderten Reizes und dem Verlassen der Ruhetaste.
Diemittlere motorische Zeitist die Zeitspanne zwischen dem Verlassen der Ruhetaste und dem Kontakt mit der Drucktaste bei geforderten Reizen (Schuhfried, 2016).
Die Studie von Zwierko et al. (2008) verwendete verschiedene Testungen des Wiener Testsystems, um die Reaktionszeiten von Volleyballspielern und NichtSportlern zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Volleyballspieler im Vergleich zu den Nicht-Sportlern kürzere Reaktionszeiten auf visuelle Stimuli hatten, die sowohl im zentralen als auch im peripheren Gesichtsfeld auftraten, und kürzere prämotorische Reaktionszeiten sowohl bei der Einfach- als auch bei der Wahlreaktion aufwiesen. Die Ergebnisse des Wiener Testsystems in Bezug auf verschiedene Sportfelder (Gierczuk et al., 2012) zeigten keine Differenzen in der RT zwischen Ringern und Taekwondo Athleten.
3 Stand der Forschung
Im Folgenden wird der aktuelle Stand der Forschung mit empirischen Befunden in Bezug auf kognitive Prozesse und sportliche Aktivität näher beleuchtet. Dabei geht es um die Frage, wie sich jahrelange Praxis in verschiedenen Sportarten auf die kognitiven Funktionen der Athleten auswirkt (Voss et al., 2010). Das Experten-Novizen-Paradigma untersucht wie sich Experten von Novizen unterscheiden und beschreibt viele Differenzen. Im Hinblick auf die verschiedenen sportlichen Expertisen und Besonderheiten der unterschiedlichen Sportfelder, erfolgt eine Darstellung signifikanter Ergebnisse zu kognitiven Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern. Das Geschlecht und das Alter werden ebenfalls thematisiert.
3.1 Experten-Novizen-Paradigma
Das Experten-Novizen-Paradigma ist durch zwei Forschungsansätze geprägt. Der „Expert Performance Approach“ ist aus der „Long-Term-Working Memory Theorie“ abgeleitet und vergleicht die sportspezifische kognitive Leistungsfähigkeit von Experten und Novizen. Der Ansatz geht davon aus, dass Experten, also Personen, die in ihrem Sport eine langjährige Erfahrung aufweisen können, den Novizen, welche weniger oder gar keine sportliche Expertise haben, überlegen sind. Dieser Ansatz und die Annahme, dass eine sportartspezifische, kognitive Überlegenheit von Experten gegenüber Novizen besteht, scheint sich durch viele Studien zu bestätigen.
Nimmerichter et al. (2015) zeigen anhand diverser Studien, dass hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten signifikante Unterschiede zwischen Experten einer Sportart und Novizen bestehen. Experten weisen erhebliche Vorteile im Bereich der taktischen Voraussagen, der Präzision der Antizipation und dem situativen Anpassen der visuellen Suchstrategie auf. Gabbett et al. (2008) führen die Erkennung spielrelevanter Muster und ein schnelleres, durch weniger Fehler charakterisiertes Entscheidungshandeln als Vorteile der Experten an. Eine Studie von Huijgen et al. (2015) untersuchte den Zusammenhang zwischen kognitiven Funktionen und dem Leistungsniveau von Elite- und Sub-EliteJugendfußballern im Alter von 13-17 Jahren.
Bei den höheren exekutiven Funktionen, der Inhibition und kognitiven Flexibilität, fanden die Autoren signifikante Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen. Bei der einfachen Reaktionszeit und der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit wurden dagegen kaum Differenzen zwischen den Elite- und Sub-Elite-Fußballern festgestellt. Es gibt Hinweise darauf, dass Experten eine funktional organisierte Gedächtnisstruktur haben, die zu einem Reaktions- und Wahrnehmungsvorteil bei taktischen Entscheidungen führt (Lex et al., 2015)
Im „Cognitive Component Skills Approach” wird untersucht, inwiefern sich Experten von weniger erfahrenen Athleten in Bezug auf sportartunspezifische kognitive Funktionen unterscheiden. Der Ansatz geht davon aus, dass Experten einer Sportart über bessere allgemeine exekutive Funktionen verfügen und somit auch sportunspezifische kognitive Aufgaben besser bewältigen als Novizen (Furley, Schul, & Memmert, 2016; Höner, 2017). Voss et al. (2010) zeigte auf, dass Sportler bei kognitiven Aufgaben ohne Sportbezug bessere Leistungen zeigten als Nicht-Sportler. Das Expertenniveau der Sportler hatte aber keinen Einfluss auf die Leistung. Sportler mit niedrigeren Leistungsniveaus zeigten bei sportunspezifischen kognitiven Aufgaben keine Differenzen zu Experten. In Bezug auf die periphere Reaktionszeit stellten Ando et al. (2001) fest, dass Fußballspieler gegenüber Nicht-Sportlern kürzere Reaktionszeiten bei peripheren Stimuli aufwiesen.
Unter Verwendung des computergestützten Wiener Testsystems berichtete Zwierko (2008), dass Handballspieler im Vergleich zu Nicht-Sportlern eine signifikant kürzere Reaktionszeit auf Reize im peripheren Gesichtsfeld hatten. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Experten in Ballsportarten wie Fußball bei zentralen und peripheren visuellen Reaktionsaufgaben kürzere prämotorische Zeiten haben als Nicht-Sportler.
Borgmann et al. (2016) kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass höherklassig spielende Fußballer und Fußballerinnen in allen Altersklassen bessere Leistungen im Determinationstest zeigten, als Spieler tieferer Klassen. Der Determinationstest ist ein Teil des Wiener Testsystems und steht mit kognitiver Flexibilität als komplexem Teilbereich exekutiver Funktionen im Zusammenhang.
3.2 Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern
Aslan (2018) vergleicht in einer Studie die exekutiven Funktionen von 237 Mannschafts- und Individualsportlern und kam zu der Erkenntnis, dass die Mannschaftssportler ein höheres Maß an kognitiver Flexibilität gegenüber den Individualsportlern zeigten.
In der Studie von Turkeri et al. (2019) wurde in Bezug auf die Reaktionszeit zwischen Individual- und Mannschaftssportlern ein signifikanter Unterschied zugunsten der Mannschaftssportler aufgezeigt. Koc et al. (2006) fanden in ihrer Studie an Fußball- und Tennissportlern heraus, dass Fußballspieler eine bessere Reaktionszeit haben als Tennisspieler.
Über die Kategorisierung nach Mannschafts-und Individualsportarten hinaus, scheint die Sportartenkategorisierung zwischen Open- und Closed-Skills- Sportarten ein interessanter Ansatz zu sein, um differenzierte Aussagen über den Zusammenhang zwischen sportlicher Leistung und kognitiver Leistungsfähigkeit treffen zu können (Wang et al., 2013; Tsai et al., 2017). Geschlossene Fertigkeiten (Closed-Skills) zeichnen sich durch relativ stabile Umweltbedingungen und sich wiederholende Bewegungsmuster aus, wie dies beim Schwimmen oder Joggen der Fall ist. Fertigkeiten, die überwiegend in Sportarten wie Handball, Fußball, Fechten oder Tennis ausgeführt werden, die eine ständige Anpassung an sich verändernde und unvorhersehbare Umweltbedingungen sowie direkte Interaktionen mit dem Gegner erfordern, werden als Open-Skills-Sportarten bezeichnet (Nuri et al., 2013; Huijgen et al., 2015; Elferink-Gemser et al., 2018)
Daher erfordert die Ausführung offener Fertigkeiten in einem funktionalen Kontext ein hohes Maß an visueller Aufmerksamkeit, die Fähigkeit, schnelle und flexible Entscheidungen zu treffen, sowie eine schnelle Bewegungsausführung (Tsai et al., 2016). Daher sind Sportarten mit überwiegend offenen Fertigkeiten kognitiv anspruchsvoller als Sportarten mit geschlossenen Fertigkeiten. Dies führt zu der Annahme, dass Sportlerinnen und Sportler aus Sportarten mit offenen Fähigkeiten, die ständig mit diesen kognitiven Reizen konfrontiert sind, bessere sportrelevante kognitive Leistungen erbringen sollten (Voss et al., 2010; Tsai und Wang, 2015; Elferink-Gemser et al., 2018).
Die Studie von Nuri et al. (2013), welche die verschiedenen Sportdomänen ebenfalls in „open and closed skill-dominated sports“ klassifiziert, untersuchte die visuelle und auditive Reaktionszeit (RT) und die antizipatorische Fähigkeit von Volleyballspielern (open skill-dominated sport) im Vergleich zu Sprintern (closed skill-dominated sport). Die Sprinter zeigten eine schnellere RT bei auditorischen Reaktionsaufgaben, die Messung der einfachen und komplexen visuellen Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben hingegen ergab keine signifikanten Unterschiede.
Yu, Chan, Chau und Fu (2017) stellten in ihrer Studie keine Unterschiede in der RT fest. Die Badminton Spieler erzielten keine besseren Ergebnisse als die Schwimmer. Ebenfalls keine Unterschiede ermittelten Kida et al. (2005) in der einfachen RT zwischen Baseballspielern, Tennisspielern und Nicht-Sportlern. Dabei war die Go/No-Go-Reaktionszeit der Baseballspieler deutlich kürzer als die der Tennisspieler.
Voss et al. (2010) klassifizieren Sportarten nochmals genauer. Sie unterscheiden zwischen statischen Sportarten (selbstgesteuerte Aktivitäten unter gleichbleibenden Bedingungen, z.B. Schwimmen), interzeptiven Sportarten (die eine dynamische Koordination zwischen dem Körper des Athleten und einem Gerät oder einer Umgebung erfordern, z.B. Tennis) und strategischen Sportarten (die eine Anpassung an sehr unterschiedliche Situationen unter einer Berücksichtigung von Mitspielern, Gegnern, Positionen und Objekten erfordern, z.B. Fußball). In Abhängigkeit von dieser Kategorisierung fanden Voss et al. (2010) in ihrer Meta-Analyse bessere kognitive Fähigkeiten bei Sportlern des interzeptiven Sports als bei strategischen oder statischen Sportarten. Dieser Effekt erwies sich jedoch hauptsächlich für Aufgaben der Verarbeitungsgeschwindigkeit als bedeutsam und bezog sich auf kognitive Aufgaben im Allgemeinen. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Sportarten mit offenen Fertigkeiten, bei denen die Athleten in ständig wechselnden Situationen und einem von außen beeinflussten Umfeld reagieren müssen (z. B. Basketball, Tennis), möglicherweise höhere kognitive Anforderungen stellen als Sportarten mit geschlossenen Fertigkeiten. Darüber hinaus deuten neuere Erkenntnisse darauf hin, dass selbst innerhalb der Klasse der Open-Skill-Sportarten oder der Sportarten mit externem Tempo Unterschiede in der EF in Bezug auf die unterschiedlichen kognitiven Anforderungen des individuellen Sports auftreten können (Krenn et al., 2018). Der weit gefassten Transferhypothese zufolge werden in einer bestimmten Sportart umso mehr kognitive Anforderungen gestellt, je mehr die kognitiven Fähigkeiten der Athleten trainiert werden und je mehr diese wahrscheinlich auf universelle, nicht sportbezogene kognitive Aufgaben übertragen werden. Daher können verschiedene Sportarten auch unterschiedlich EF-Übertragungen und -Verbesserungen erleichtern (Jacobson & Matthaeus, 2014).
3.3 Geschlecht und Alter als Faktor
Die Neuroforschung erkannte schon früh, dass es in verschiedenen Altersstadien zu signifikanten kognitiven Entwicklungen kommt (Schumacher et al. 2020). Klenberg et al. (2001) erkannten in der Hirnreifung und Aufmerksamkeitsspanne einen U-förmigen Trend. Von der Kindheit bis zum frühen Erwachsenenalter (12-15 Jahre) steigt die Kurve und sinkt ab dem jungen Erwachsenenalter (20-30 Jahre) bis zum höheren Erwachsenenalter (60-70 Jahre) ab. Zusätzlich erkennen Betts et al. (2006) eine nachhaltige Steigerung der Aufmerksamkeitsfähigkeit von 8 auf 16 Jahre. Sportartspezifische Testungen zeigten, dass kognitive Fähigkeiten wie Antizipation und Spielmustererkennung sich mit dem Alter und dem Erfahrungswissen der Athleten verbessern (Ward P, Williams AM, 2003). Diese These wird durch Alves et al. (2014) gestützt, die herausfanden, dass die visuellen Fähigkeiten der weiter entwickelten und erfahreneren Fußballspieler (U 20 und die Männermannschaft) besser ausfallen als die visuellen Fähigkeiten von jüngeren und weniger erfahrenen Fußballlern (U15 und U17). Darüber hinaus scheinen sich Wahrnehmungsfähigkeiten wie die einfache Reaktionsfähigkeit und das periphere Bewusstsein mit dem Alter zu verbessern (Vänttinen T, Blomqvist M, Luhtanen P, Hakkinen K, 2010).
Zahlreiche Studien weisen auf geschlechterspezifische Differenzen in Kognitionstestungen hin. Schumacher et al. (2019) untersuchten mit dem Wiener Testsystem kognitive Differenzen zwischen den Geschlechtern. Bei Multiple-Choice-Aufgaben wiesen die Frauen bessere Ergebnisse als die Männer auf. In dem einfachen Wahlreaktionstest hingegen übertrafen die männlichen Athleten die weiblichen.
Arabac (2008) fand in seiner Studie einen signifikanten Unterschied in der Reaktionszeit bei männlichen und weiblichen Athleten unter 15 Jahren (13,8 ± 1,7 Jahre), zugunsten der männlichen Athleten.
Chraif (2013) erkennt in einem peripheren Wahrnehmungstest Unterschiede in der Reaktionszeit zwischen weiblichen und männlichen Athleten. Auch bei der Reaktionszeit gab es bei Jugendlichen geschlechtsspezifische Unterschiede. Keine signifikanten Unterschiede wurden dagegen bei der Geschwindigkeitsund Entfernungsschätzung festgestellt.
4 Fragestellung und Hypothese
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, mit Hilfe einer Querschnittsuntersuchung an der Universität Hamburg kognitive Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern herauszuarbeiten. Die der gesamten Arbeit übergeordnete Fragestellung lautet:
Gibt es kognitive Differenzen zwischen den beiden SportfeldernMannschaftsund Individualsport, insbesondere bei der peripheren Reaktionszeit und der Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben?
Auf diese Fragestellung aufbauend lassen sich die folgenden Hypothesen aufstellen, welche es anhand erhobener Daten zu überprüfen gilt.
Hypothese H1: Mannschafts- und Individualsportler weisen, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, Differenzen in der Reaktionszeit auf linksseitige Reize auf.
Hypothese H01: Mannschafts- und Individualsportler zeigen, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, keine Differenzen in der Reaktionszeit auf linksseitige Reize.
Hypothese H2: Mannschafts- und Individualsportler weisen, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, Differenzen in der Reaktionszeit auf rechtsseitige Reize auf.
Hypothese H02: Mannschafts- und Individualsportler zeigen, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, keine Differenzen in der Reaktionszeit auf rechtsseitige Reize.
Hypothese H3: Mannschafts- und Individualsportler weisen bei Wahlreaktionsaufgaben, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, Differenzen in der mittleren motorischen Zeit bei Wahlreaktionsaufgaben auf.
Hypothese H03: Mannschafts- und Individualsportler weisen bei
Wahlreaktionsaufgaben, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, keine Differenzen in der mittleren motorischen Zeit bei Wahlreaktionsaufgaben auf.
Hypothese H4: Mannschafts- und Individualsportler weisen bei Wahlreaktionsaufgaben, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, Differenzen in der Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben auf.
Hypothese H04: Mannschafts- und Individualsportler weisen bei Wahlreaktionsaufgaben, unterBerücksichtigung von Alter und Geschlecht, keine Differenzen in der Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben auf.
5.Methodik
5.1 Studiendesign
Für die vorliegende Querschnittstudie wurden die Daten im Rahmen der sportmedizinischen Kaderuntersuchungen (2017 - 2020), der Universität Hamburg, herangezogen. Anhand der erfassten Daten soll ein Vergleich der beiden Sportfelder möglich sein.
5.2 Stichprobe
Die sportmedizinische Untersuchung wurde mit Kaderathleten des sportlichen Institutes der Universität Hamburg durchgeführt. Die Stichprobe bestand aus Sportlern verschiedener Leistungsniveaus, welche in das Sportfeld Mannschaftssportler(n=395) undIndividualsportler(n= 139) unterteilt wurden. Insgesamt nahmen 534(w=107,m= 427) Probanden im Alter von 7 bis 75 Jahren an der Testung teil, wobei das durchschnittliche Alter der Mannschaftssportler bei 15,90 Jahren (SD= ± 4,38 Jahre) und das der Individualsportler bei 26,01 Jahren (SD= ± 14,61 Jahre) lag. Die meisten Probanden waren zwischen 11 und 16Jahrenalt (n=314). Die Verteilung des Alters lässt sich an Tabelle (1) gut ablesen. Die größte Verteilung istzwischen 11 und 22Jahren erkennbar (n=446).
Altersgruppen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3. Grafische Darstellung der Altersverteilung
Die Athleten führten zum Zeitpunkt der Messung folgende Sportarten aus und wurden nach Anforderungsprofilen in Mannschafts- oder Individualsportler klassifiziert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1. Deskriptive Darstellung Sportarten
5.3 Untersuchungsablauf
Um die kognitiven Fähig- und Fertigkeiten zu bestimmen, wurden die Athleten zu einer Laboruntersuchung am Institut für Sportmedizin des Fachbereichs Bewegungswissenschaften, eingeladen. Zusätzlich wurden mittels eines standardisierten Fragebogens breitgefächerte persönlichen Informationen (u.a. sportliche Laufbahn, psychisches Empfinden, sportliche Beeinträchtigung) erhoben. Die anschließende Messung nach dem Wiener Testsystem (WTS) erfolgte im Labor und hatte einen zeitlichen Umfang von ca. 45 Minuten pro Probanden. Zunächst erfolgte eine Übertragung der persönlichen Daten in das System. Daran schloss sich eine Instruktionsphase an. Hierbei wurde der Proband mit den Peripherie- und Trackingaufgaben vertraut gemacht. Bevor der Proband in die Messung überging, durfte eine Testphase gestartet werden. Da für die Ausarbeitung die Testungen zum peripheren Sehen (PP) und der Reaktionstest (RT) relevant waren, wird im Folgenden erläutert, welche Parameter zur Auswertung herangezogen wurden.
5.3.1 Testung PP Reaktionszeit auf linke/rechte Reize
Um beurteilen zu können, ob es Unterschiede in der peripheren Reaktionszeit zwischen Probanden gibt, ist der ParameterPP/S1 Rohwert Median Reaktionszeit auf linke bzw. rechte Reizeaussagekräftig. Hierbei werden mit den am Bildschirm montierten Leuchtdioden periphere Lichtreize erzeugt, die sich mit vorgegebener Geschwindigkeit bewegen. Die peripheren Displays bestehen aus vertikalen und horizontalen Reihen von Leuchtdioden (64 vertikale Diodenspalten und acht horizontale Diodenzeilen). Die Stimuli werden durch grüne Lichter gegeben, die von der Mitte des Gesichtsfeldes zur Peripherie wandern. Auf diese kritischen Reize reagiert der Proband durch Drücken der Fußtaste. Die Zeit vom Auftreten des Reizes bis zum Pedaldruck wird in Sekunden gemessen. Zusätzlich muss der Proband auf dem Bildschirm einen Ball im Fadenkreuz halten. Bei dieser Variablen werden nur jene Reize zur Berechnung desMedianesherangezogen, bei denen eine Reaktion erfolgt ist und sich das Fadenkreuz (siehe oben) im Toleranzbereich befunden hat. Die periphere Reaktionszeit wird inperiphere Reaktionszeit rechts (RTR)undperiphere Reaktionszeit links (RTL) unterteilt. Die periphere Reaktionszeit wird durch den Median für korrekte Reaktionen auf rechte und linke kritische Stimuli in Sekunden berechnet. Das bedeutet, dass bei der RTL die Stimuli auf der linken Seite erscheinen, während bei derRTRdie Stimuli jeweils auf der rechten Seite erscheinen (Schuhfried, 2014).
5.3.2 RT mittlere motorische Zeit und mittlere Reaktionszeit
Mit der TestformRT/S3(Wahlreaktion Gelb/Ton) wird die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben überprüft, weshalb diese für die Arbeit relevant ist. Bei demRT/S3Test ist es möglich, die Reaktionszeit von der motorischen Zeit abzugrenzen und auszuwerten. Bei dieser Testform werden abwechselnd ein rotes und gelbes Licht, ein Ton und eine Kombination aus beidem vorgegeben. Der Proband muss dabei auf kritische Reizkombinationen reagieren, welche aus einem akustischen und einem optischen Reiz bestehen. Zunächst werden Übungsreize simuliert, woraufhin in der Testphase 48 Reize vorgegeben werden. 16 davon erfordern eine Reaktion (Schuhfried, 2014). Für die Beurteilung der Reaktionsfähigkeit bei Wahlreaktionsaufgaben wurden dieParameter RT/S3 Rohwert mittlere motorische ZeitundRT/S3 Rohwert mittlere Reaktionszeitherangezogen und ausgewertet.
5.4 Statistische Auswertung
Als Grundlage der statistischen Auswertung dienten die kognitiven Daten der sportmedizinischen Untersuchung, welche mit dem WTS erhoben wurden. Die ermittelten Testwerte (Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) wurden mittels Excel (Microsoft Corp., Microsoft Office 365, Version 16.41) aufbereitet und zusammen mit zusätzlichen Testergebnissen (WTS_Urliste_2018) in ein neues Datenblatt exportiert.
Eine deskriptive Statistik für die genannten Variablen soll mit tabellarischer Hilfe, die Stichprobe der Studie verdeutlichen. Die Berechnungen bei dem Test zur peripheren Wahrnehmung basieren jeweils auf einer Stichprobengröße vonn= 353, bei dem Reaktionstest auf einer Stichprobengröße von n=414. Fehlende Werte gibt es nur bei den kognitiven Einzelmesswerten (888= nicht angegebener Wert), nicht bei Kontrollvariablen und anthropogenen Daten. Das gewählte Signifikanzniveau lag beip< 0,05, da diese Eingrenzung in der Statistik bevorzugt Anwendung findet und weit verbreitet ist (Frost, 2017). Die Berechnung der Effektstärkererfolgte in Anlehnung an Cohen (1988) durch Pearson mithilfe einer Umrechnung vond(Cohen) in den Korrelationskoeffizientenr, der für ungleiche Gruppengrößen aussagekräftiger ist als andere Effektstärken. Die Effektstärkerbetrachtet den Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Variablen. Diese besagt, dass alle Werte überr= 0,1 einem schwachen, überr= 0,25 einem mittleren und überr= 0,4 einem starken Effekt entsprechen (Cohen, 1992).
Zur Berechnung signifikanter Unterschiede und möglicher Effekte wurde zu jedem Parameter eine Kovarianzanalyse mit SPSS (IBM Corp., IBM SPSS Statistics for IOS, Version 27.0.0.0) durchgeführt. Um eine Kovarianzanalyse durchführen zu können, muss eine Varianzhomogenität und eine Normalverteilung der Residuen gegeben sein (Bortz & Schuster, 2010).
Die Voraussetzung der Normalverteilung wurde mit dem Kolmogoroff-Smirnov- Test geprüft. Die Daten der peripheren Wahrnehmung weichen zu keinem Messzeitpunkt signifikant von der Normalverteilung ab, die Daten des Reaktionstests sind ebenfalls normalverteilt. Um die Varianzhomogenität zu prüfen, wurde der Levene-Test herangezogen. Heterogene Fehlervarianzen ergaben sich dabei keine, womit beide Voraussetzungen für eine Kovarianzanalyse erfüllt waren.
Alle abhängigen Variablen wurden somit im Vorfeld zur Erhöhung der Trennschärfe mit dem zusätzlichen Faktor Geschlecht und Alter als Kovarianzanalyse (ANCOVA) durchgeführt. Ziel der Kovarianzanalyse ist es, den Einfluss der unabhängigen Variablen (Geschlecht und Alter) auf Signifikanz zu untersuchen und zu prüfen, ob diese die Untersuchung beeinflusst haben könnten. Die Mittelwerte und signifikanten Ergebnisse der Kovarianzanalyse werden gesammelt in einer Tabelle aufgeführt.
6 Ergebnisse
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten Studie dargestellt und beschrieben. Es erfolgt eine Unterteilung, um die Ergebnisse in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen (Kap. 4) übersichtlicher darzustellen.
6.1 Testung Periphere Wahrnehmung
6.1.1 PP Reaktionszeit auf linke Reize
Zur Prüfung der Hypothese H1 und H0 wurden zunächst die Mittelwerte der beiden Sportfelder gegenübergestellt. Die Differenz der Mittelwerte von Mannschaftssportlern (M= 0,714;SD= 0,099) und Individualsportlern (M= 0,688;SD= 0,111) war nicht signifikant (F(1, 349) = 1,418;p= 0,235). Die Kovariate Alter am Erhebungstag zeigte allerdings, dass das Alter der Probanden die Ergebnisse signifikant beeinflusst (F(1, 349) = 5,612;p= 0,018,r= 0,1258).
Das Geschlecht hingegen zeigte keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse (F(1,349) = 0,066;p= 0,798).
6.1.2 PP Reaktionszeit auf rechte Reize
Zur Prüfung der Hypothese H2 und H20 wurden ebenfalls die Mittelwerte der beiden Sportfelder gegenübergestellt. Die Differenz der durchschnittlichen Werte von Mannschaftssportlern (M= 0,707; SD=0,113) und Individualsportlern (M= 0,673; SD= 0,094) war nicht signifikant (F (1, 349) = 1,922; p = 0,167). Auch hier zeigte die Kovariate „Alter am Erhebungstag“ einen höchst signifikanten Einfluss (F (1, 349) = 10,329; p = 0,001, r = 0,173).
Die Kovariate „Geschlecht“ hingegen zeigte keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse (F (1,349) = 0,066; p= 0,798).
Tab. 2. Ergebnisse ANVOCA (Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanz)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkungen.* p < 0,05 = signifikant, ** p < 0,01 = hochsignifikant ; Median-RZ links = Rohwert Median Reaktionszeit linksseitig; Median RZ rechts = Rohwert Median Reaktionszeit rechtsseitig; M-RZ= mittlere Reaktionszeit; M-MZ= mittlere motorische Zeit; Angabe der Werte in Millisekunden (msec); r > 0,1= kleiner Effekt, r > 0,25= mittlerer Effekt, r > 0,4 = starker Effekt; p-Wert = Signifikanz; [1]ANCOVA= Varianzanalyse Mannschafts- und Individualsportler, [2]ANCOVA = Kovarianzanalyse Alter, [3]ANCOVA = Kovarianzanalyse Geschlecht
6.2. Reaktionstest
6.2.2 RT mittlere Reaktionszeit
Die Differenz der Mittelwerte von Mannschaftssportlern (M= 420,29;SD= 81,143) und Individualsportlern (M= 404,09;SD= 61,733) war nicht signifikant (F(1, 410) = 0,279;p= 0,598). Die Kovariate „Alter am Erhebungstag“ zeigte einen höchst signifikanten Einfluss (F(1, 410) = 13,567;p< 0,001,r= 0,185). Die Kovariate „Geschlecht“ hingegen, zeigte keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse (F(1,410) = 1,723;p= 0,190).
6.2.1 RT mittlere motorische Zeit
Zur Prüfung der Hypothese H3 und H03 wurden ebenfalls die Mittelwerte der beiden Sportfelder gegenübergestellt. Die Differenz der durchschnittlichen Werte von Mannschaftssportlern (M= 155,60;SD= 54,73) und Individualsportlern (M= 145,63;SD= 37,38) war nicht signifikant (F(1, 410) = 0,238;p= 0,626). Auch hier zeigte die Kovariate „Alter am Erhebungstag“ einen höchst signifikanten Einfluss (F(1, 410) = 11,453;p= 0,001,r= 0,169). Die Kovariate „Geschlecht“ hingegen zeigte keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse (F(1,410) = 3,011;p= 0,83).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4. Boxplots der vier Parameter, Differenzen der Altersgruppen
Die Boxplots zeigen die Ergebnisse der verschiedenen Parameter, unterteilt in Altersgruppen. Durch die Gruppierung ist zu erkennen, dass die Athleten in allen Parametern die besten Ergebnisse in der Altersgruppe 23 - 28 Jahren erzielten. Vor allem in der peripheren Reaktionszeit, zu sehen in den oberen beiden Boxplots, zeigt der Median der Altersklasse 23-28 bessere Ergebnisse als die anderen Altersgruppen. In der Altersklasse 11 - 16 sind in jedem Parameter anhand der vielen Ausreißer und Whisker (Antennen) zu erkennen, dass diese Altersklasse sehr heterogene Ergebnisse erzielte. Die Ausreißer und extremen Ausreißer sind vor allem bei den Mannschaftssportlern zu erkennen.
7 Diskussion
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der Fragestellungen und Hypothesen kritisch reflektiert und diskutiert. Dabei werden die Hypothesen bestätigt oder widerlegt, zudem werden die Befunde im Kontext früherer Studien diskutiert. Die aktuelle Studie zielte darauf ab, die kognitiven Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportler zu untersuchen. Dabei werden die kognitiven Fähigkeiten der peripheren Reaktionszeit und die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben verglichen. Im Folgenden werden die Ergebnisse für die Parameter PP und RT diskutiert.
Das Wiener Testsystem ist ein sportartunspezifisches Testsystem, bei dem generelle (basale) kognitive Fähigkeiten ohne Berücksichtigung der sportspezifischen Funktion untersucht werden (Memmert, 2016). Aus der Perspektive des Cognitive Component Skills hat sich das WTS jedoch als sehr geeignetes Verfahren für diese Studie herausgestellt. Der objektive Vergleich ausgewählter Parameter ließ Schlüsse zu über die kognitiven Differenzen zwischen beiden Sportfeldern. Aus den Ergebnissen des WTS geht hervor, dass es in der peripheren Wahrnehmung keine signifikanten Differenzen zwischen den Mannschafts- und Individualsportlern gibt. Die beiden untersuchten Hauptvariablen (PP/S1 rechtsseitig und PP/S1 linksseitig) unterscheiden sich nicht signifikant. Aufgrund dessen werden die Hypothese H1 und H2 mit einem Wert vonp> 0,05 abgelehnt. Dennoch ließen die Mittelwerte und Standardabweichungen einen leichten Vorteil für die Individualsportler vermuten.
Die Studienlage liefert kaum Erkenntnisse über Vergleiche der peripheren Wahrnehmung (nach Kategorisierung Mannschafts- und Individualsportler), weshalb sich eine Bezugnahme auf kongruente oder abweichende Ergebnisse schwierig gestaltet.
Die Kategorisierung in „open-skill-Sportarten“ und „closed-skill-Sportarten“ (Krenn et al., 2018; Ong, 2017; Nuri et al. 2013), kommt der von uns gewählten Kategorisierung „Mannschaftssport“ und „Individualsport“ sehr nahe, weshalb ein Bezug auf diesbezügliche Literatur sinnvoll ist. In den Mannschaftssportarten müssen die Athleten auf sich ständig verändernde Situationen in einem dynamischen Umfeld reagieren („open-skill-Sportarten“). Bei Individualsportarten ist das sportliche Umfeld oftmals konstanter, vorhersehbar und selbstbestimmend („closed-skill-Sportarten“). Die Kategorisierung ist lediglich ein Versuch, ähnliche Sportarten mit gleichen Anforderungsprofilen in Gruppen zu definieren. Nicht jede Individualsportart lässt sich als „closed-skill-sports“ definieren, nicht jede Mannschaftssportart als „open-skill-sports“ (Krenn, 2018).
In Anlehnung an die weit gefasste Hypothese, dass kognitive Anforderungen in „open-skill-Sportarten“ die Entwicklung von EF stärker fördern und diese besser ausgeprägt sind (Bianco et al., 2017; Furley & Memmert, 2010, 2011; Taatgen, 2013; Wang et al., 2013), wurden ähnliche Ergebnisse erwartet. Unsere Ergebnisse stützen die Vermutung allerdings nicht. Die Mannschafts- und Individualsportler zeigten keine signifikanten Differenzen in der peripheren Reaktionszeit (rechts- und linksseitig).
Ähnliche Befunde sind bei der Reaktionszeit festzustellen. Die Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Hauptvariablen (RT S3 mittlere motorische ZeitundRT S3 mittlere Reaktionszeit) sind ebenfalls nicht signifikant. Aufgrund dessen werden die Hypothese H3 und H4 mit einem Wert vonp> 0,05 abgelehnt. Anders als die Ergebnisse von Ong (2017) zeigten, wurden in dieser Studie keine Differenzen in den Sportfeldern bei der Reaktionszeit gefunden, allerdings gab es in der Studie von Ong (2017) keinen Bezug auf die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben. Daher ist es schwierig, einen Zusammenhang mit den von uns gewählten Parametern (Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben) herzustellen. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen hingegen die Ergebnisse von Nuri et al. (2013), in deren Untersuchung die Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben ebenfalls keine Differenzen zeigte.
Limitationen
Es muss eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden, die die Verallgemeinerbarkeit der aktuellen Ergebnisse einschränken. Die Kovarianzanalyse (ANCOVA) mit Hinzunahme bzw. einer Berücksichtigung des Alters ergab zu jedem Parameter einen signifikanten, sogar einen hochsignifikanten Effekt (PP: p = 0,018,p< 0,001; RT:p< 0,001,p= 0,001). Die Effektstärke zeigt bei allen Parametern einen kleinen Effekt r > 0,1 (PP:r= 0,126,r= 0,173; RT:r= 0,169,r= 0,185). Man kann also davon ausgehen, dass das Alter der Probanden einen großen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Die Vermutung ist vergleichbar mit den Ergebnissen von Studien (Schumacher et al. 2018), die einen großen Einfluss des Lebensalters auf wahrnehmungskognitive Fähigkeiten beschreiben. Somit muss die ungleiche Altersverteilung der Stichprobe (sieheKapitel 5.2) berücksichtigt und hinterfragt werden. Die meisten Mannschaftssportler (68,6%) waren zwischen 11 und 16 Jahre alt. Bei den Individualsportlern war das Alter homogener verteilt (11-16 Jahre = 30%). Aufgrund der Ergebnisse von Alves et al. (2014) und Vänttinen et al. (2010), bei denen weiter entwickelte Athleten (über 20 Jahre) bessere kognitive Leistungen zeigten als jüngere Athleten (U15 und U17), kann man zu der Annahme kommen, dass die älteren Athleten einen kognitiven Vorteil hatten und somit bessere Ergebnisse erzielten. Es lässt sich vermuten, dass die Heterogenität der Mannschaftssportler in dieser Studie dazu beigetragen hat, dass kognitive Vorteile (Aslan, 2018; Ong, 2017; Nuri et al., 2013) im Vergleich zu den Individualsportlern nicht aufgedeckt wurden.
Die grafische Darstellung der Boxplots (Abb. 4) ist verdeutlicht die Annahme, dass das Alter die Ergebnisse beeinflusst hat. In der Grafik wurden neben den Lagemaßen der Testergebnisse auch Streuungen (Ausreißer und extreme Ausreißer) aufgezeigt. Die möglichen Auswirkungen dieser Verteilung wurden bereits im letzten Abschnitt diskutiert, konnten aber mit der Boxplot Darstellung und der theoretischen Auseinandersetzung im Stand der Forschung (sieheKapitel 3.3) untermauert werden.
Die Heterogenität spiegelt sich auch in den Sportarten und im Leistungsniveau der Athleten wider. Die unterschiedlichen Leistungsniveaus konnten mittels Fragebogen nicht ausreichend erläutert werden. Die aktuellen Forschungsergebnisse aus beiden Perspektiven des Experten-Novizen- Paradigmas lassen auf einen kognitiven Vorteil der Experten gegenüber den Novizen schließen (Furley, Schul, & Memmert, 2016; Höner, 2017; Voss, Kramer, Basak, Prakash, & Roberts, 2010). Stichprobe umfasste teilweise Athleten aus Nachwuchsleistungszentren, andere hingegen kamen aus dem Breitensport. Man kann daher von einem heterogenen Leistungsniveau ausgehen. Aufgrund dessen sind die Ergebnisse ohne eine Berücksichtigung des „Expert Performance Approach“, vor allem aber durch den „Cognitive Component Skills Approach“, fragwürdig und müssten in zukünftiger Forschung heterogener analysiert werden. Der Begriff des Experten ist zusätzlich nicht ausreichend geklärt (Swann et al. 2015), weshalb sich eine Beurteilung in Bezug auf kognitive Leistung in Abhängigkeit sportlicher Expertise schwierig gestaltet.
Die ANCOVA konnte keine geschlechterspezifischen Unterschiede in der Kognition, wie Schumacher et al. (2019) & Chraif (2013), erkennen. Aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung von Männern (n= 427) und Frauen (n= 107) in unserer Stichprobe sowie der unterschiedlichen Stichprobengrößen der Sportkategorien, erwies sich die Analyse der Geschlechterunterschiede allerdings als ungeeignet. Nichtsdestotrotz könnte zukünftige Forschung diesen Aspekt näher untersuchen.
Darüber hinaus müssen wir die kognitive Kategorisierung von Sportarten hinterfragen, bei der die Literatur viele verschiedene Definitionen liefert (Krenn et al. 2014; Aslan, 2018; Ong, 2017; Nuri et al., 2013; Voss et al. 2010). Die Kategorisierung in Mannschafts- und Individualsportarten ist recht unpräzise und hat Schwächen in der Kategorisierung von kognitiven Anforderungsprofilen. Die Kategorisierung der Sportarten in statische, interceptive und strategische Sportarten hat sich ebenfalls als vage erwiesen (Voss et al., 2010). Selbst innerhalb eines Sportfeldes können kognitive Unterschiede in Bezug auf die unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Sportart festgestellt werden (Krenn, 2018).
8 Fazit
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie erbrachte keine signifikanten Ergebnisse hinsichtlich kognitiver Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern. Durch die Kovarianzanalyse wurden keine signifikanten kognitiven Differenzen der Sportfelder. Sowohl die Ergebnisse der peripheren Reaktionszeit als auch der Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben, zeigten keine Differenzen. Mögliche Beeinflussungen, vor allem das Alter der Probanden, muss in zukünftiger Forschung berücksichtigt werden. Die Kovarianzanalyse zeigte zusätzlich auf, dass das Alter einen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten der Athleten hat.
Da es sich bei der vorliegenden Studie um eine Querschnittsstudie handelt, werden Schwächen der Untersuchung offensichtlich. Um noch präzisere Aussagen über kognitive Differenzen zwischen den verschiedenen Sportarten und Sportfeldern zu erlangen, sollte in zukünftigen Untersuchungen eine Unterteilung in Altersklassen, Leistungsniveau und Geschlecht erfolgen. Darüber hinaus muss die weitere Forschung den Aspekt der SportfeldKategorisierung umfassender berücksichtigen und mit Hilfe der unterschiedlichen kognitiven Anforderungen innerhalb der Sportarten eine sinnvolle Kategorisierung vornehmen.
Das querschnittliche Studiendesign dieser Arbeit konnte keine kognitiven Differenzen zwischen den Sportfeldern aufzeigen, kann aber als Anhaltspunkt für weitere Studien dienen. Zukünftige Studien sollten unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht größere Stichproben, in unterschiedlichen Altersklassen aufweisen. Zudem können sportartspezifischere Messmethoden von Kognitionsleistungen verwenden werden, um die Bedeutung der kognitiven Differenzen für sportliche Expertise zu beleuchten.
VII. Literaturverzeichnis
Alfermann, D., & Stoll, O. (2017).Sportpsychologie: Ein Lehrbuch in 12 Lektionen(5., überarbeitete Auflage).Sportwissenschaft studieren: Band 4. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
Alves, M., Spaniol, F. & Erichsen, O. (2015). Visual skills of elite Brazilian soccer players. European Journal of Sports Science, 1-9. https://www.researchgate.net/publication/283492224.
Ando, S., Kida, N. & Oda, S. (2001). Central and peripheral visual reaction time of soccer players and nonathletes. Perceptual and Motor Skills, 92(3), 786-794. doi: 10.2466/pms.2001.92.3.786
Aslan, $. (2018). Examination of Cognitive Flexibility Levels of Young Individual and Team Sport Athletes.Journal of Education and Training Studies, 6(8), 149. doi: 10.11114/jets.v6i8.3266
Bianco, V., Di Russo, F., Perri, R. L., & Berchicci, M. (2017). Different proactive and reactive action control in fencers and boxers brain. Neuroscience, 343(SupplementC), 260268. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.12.006.
Bortz J., Schuster C. (2010). Hypothesentesten. In: Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-12770-0_7.
Chraif, M. & Anikei, M. (2013). Gender Differences in Measuring Positive and Negative Emotions Self-perception among Romanian High School Students A Pilot Study.Procedia - Social and Behavioral Sciences,76, 181-185. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.095.
Cohen, J. (1992). A power primer.Psychological bulletin, 112(1), 155-159.
Conzelmann, A., Hänsel, F., & Höner, O. (2013). Individuum und Handeln - Sportpsychologie. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.),Das Lehrbuch für das Sportstudium (Reihe Bachelor)(S. 271-337). Heidelberg: Springer.
Davis, C. L. & Lambourne, K. (2009). Exercise and Cognition in Children.Exercise and Cognitive Function,249-267. doi: 10.1002/9780470740668.ch13
Elferink-Gemser, M. T., Faber, I. R., Visscher, C., Hung, T.-M., de Vries, S. J. & Nijhuis-Van der Sanden, M. W. G. (2018). Higher-level cognitive functions in Dutch elite and subelite table tennis players. doi: 10.1371/journal.pone.020615.
Frost, I. (2017). Statistische Testverfahren, Signifikanz und p-Werte. Wiesbaden: Springer.
Furley, P., Schul, K., & Memmert, D. (2016). Das Experten-Novizen-Paradigma und die Vertrauenskrise in der Psychologie.Zeitschriftfür Sportpsychologie,23(4), 131-140. doi: 10.1026/1612-5010/a000174.
Gabbett, T. J., Carius, J., & Mulvey, M. (2008). Does improved decision-making ability reduce the physiological demands of game-based activities in field sport athletes?Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 2027-2035. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181887f34
Gabler, H. (1995). Kognitive Aspekte sportlicher Handlungen. In H. Gabler, J.R. Nitsch & R. Singer (Eds.), Sport und Sportunterricht: Vol. 2. Einführung in die Sportpsychologie (2nd ed.). Schorndorf: Hofmann.
Gierczuk, D., Bujak, Z., Rowinski, J., & Dmitriyev, A. (2012). Selected coordination motor abilities in elite wrestlers and taekwon-do competitors.Polish Journal of Sport and Tourism,19, 230-234. doi:10.2478/v10197-012-0022-1
Goldstein, B. E., Irtel, H., Lay, M. & Plata, G. (2007).Wahrnehmungspsychologie: Der Grundkurs (German Edition)(7. Aufl. 2007 Aufl.). Spektrum Akademischer Verlag.
Grosser, M., & Renner, T. (2007).Schnelligkeitstraining: Grundlagen, Methoden, Leistungssteuerung, Programmefür alle Sportarten(2., neu bearb. Aufl., Neuausg).BLV-Sportwissen. München: BLV-Buchverl.
Grosser, M., Starischka, S., & Zimmermann, E. (2015).Das neue Konditionstraining: Grundlagen, Methoden, Leistungssteuerung,Übungen, Trainingsprogramme(12. Auflage).Sportwissen. München: blv.
Hagendorf, H., Krummenacher, J., Müller, H.-J., & Schubert, T. (2011).Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3642-12710-6.
Hänsel, F., Baumgärtner, S. D., Kornmann, J., & Ennigkeit, F. (2016).Sportpsychologie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-662-50389-8.
Hirtz, P. (1988).KoordinativeFähigkeiten im Schulsport: Vielseitig, variationsreich, ungewohnt(2. Aufl.). Berlin: Volk und Wissen.
Hirtz, P. (2012).Reaktion.Praxisideen.
Höner, O. (2017). Die Bedeutung kognitiver Faktoren für die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern.BDFL Journal, 42-45. Retrieved from https://www.bdfl.de/images/Hoener_online.pdf.
Huijgen, B. C. H., Leemhuis, S., Kok, N. M., Verburgh, L., Oosterlaan, J., Elferink-Gemser, M. T., et al. (2015). Cognitive functions in elite and sub-elite youth soccer playersaged 13 to 17 years.PLoS One, 10, e0144580. doi: 10.1371/journal.pone.0144580.
Jacobson, J., & Matthaeus, L. (2014). Athletics and executive functioning: How athleticparticipation and sport type correlate with cognitive performance. Psychology of Sportand Exercise, 15, 521-527.
Jendrusch, G., & Brach, M. (2003). Sinnesleistungen im Sport.Handbuch Bewegungswissenschaft -Bewegungslehre,pp. S. 175-196.
Kida, N., Oda, S., & Matsumura, M. (2005). Intensive baseball practice improves the Go/Nogo reaction time, but not the simple reaction time.Cognitive Brain Research, 22,257-264. doi: 10.1016/j.cogbrainres.2004.09.003.
Klenberg, L., Korkman, M. & Lahti-Nuuttila, P. (2001). Differential Development of Attention and Executive Functions in 3- to 12-Year-Old Finnish Children.Developmental Neuropsychology,20(1), 407-428. doi: 10.1207/s15326942dn2001_6.
Kluwe, R. H. (2001). Kognition. In: G. Wenninger (Hrsg.), Lexikon der Psychologie in fünf Banden. Band 2 (F-L) (S. 352-356). Heidelberg/Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
Konzag, G., & Konzag, I. (1981). Kognitive Funktionen in der psychischen Regulation sportlicher Spielhandlungen und Folgerungen für den Ausbildungsprozess. In H. Schellenberger (Ed.),Psychologie im Sportspiel.Berlin: Sportverlag Berlin.
Krenn, B., Finkenzeller, T., Würth, S. & Amesberger, G. (2018). Sport type determines differences in executive functions in elite athletes.Psychology of Sport and Exercise,38, 72-79. doi: 10.1016/j.psychsport.2018.06.002.
Lex, H., Essig, K., Knoblauch, A. & Schack, T. (2015). Cognitive Representations and Cognitive Processing of Team-Specific Tactics in Soccer.PLOS ONE,10(2), e0118219. doi: 10.1371/journal.pone.0118219.
Meinel, K. & Schnabel, G. (2007).Bewegungslehre - Sportmotorik. Meyer & Meyer.
Memmert, D., Klatt, S. & Kreitz, C. (2019). Wahrnehmung und Aufmerksamkeit im Sport.Sportpsychologie, 15-42. doi: 10.1007/978-3-662-56802-6_2.
Memmert, D. (2016). Durch Kognitionstraining die richtigen Entscheidungen treffen! Fußballtraining. (5), 6-10.
Nierhoff, A. (2003). Kinästhetische Wahrnehmung im Turnen.Lehrhilfen für den Sportunterricht, 52(3), pp. S. 9-13.
Nimmerichter, A., Weber, N. J. R., Wirth, K., & Haller, A. (2015). Effects of Video-Based Visual Training on Decision-Making and Reactive Agility in Adolescent Football Players.Sports (Basel, Switzerland),4(1). doi: 10.3390/sports4010001.
Nuri, L., Shadmehr, A., Ghotbi, N. & Attarbashi Moghadam, B. (2013). Reaction time and anticipatory skill of athletes in open and closed skill-dominated sport.European Journal of Sport Science,13(5), 431-436. doi: 10.1080/17461391.2012.738712.
Ong, N. C. H. (2015). The use of the Vienna Test System in sport psychology research: A review.International Review of Sport and Exercise Psychology, 8(1), 204-223.
Ong, N. C. H. (2017). Reactive stress tolerance in elite athletes: Differences in gender, sport type, and competitive level.Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal,21(3), 189-202. doi: 10.24193/cbb.2017.21.11.
Schapschröer, M., Holzhey, C., Bund, A., & Sickenberger, W. (2011). Trainierbarkeit der visuellen Wahrnehmung im Sport.DOZ Optometrie, 1,92-96.
Scharfen, H-E., & Memmert, D. (2019). Measurement of Cognitive Functions in Experts and Elite-Athletes: A Meta-Analytic Review.Applied Cognitive Psychology, 33(5), 843860. doi: 10.1002/acp.3526.
Schuhfried, A. (2014). Manual Wiener Testsystem - Periphere Wahrnehmung. Mödling.
Schuhfried, A. (2016). Manual Wiener Testsystem - Reaktionstest. Mödling.
Schumacher, N., Schmidt, M., Wellmann, K., & Braumann, K.-M. (2018). General perceptual cognitive abilities: Age and position in soccer. PLoS ONE, 13(8). doi: 10.1371/journal.pone.0202627.
Schumacher, N., Richter, L., Reer, R. & Braumann, K. (2020). Multiple-choice and choice reaction in female and male athletes: Do women outperform men?.
Singer, R. N. [Robert]. (1985).Motorisches Lernen und menschliche Leistung(1. Aufl.).
Spering, M. & Schmidt, T. (2009).Allgemeine Psychologie kompakt. Beltz Verlag.
Söhnlein K., Borgmann S. (2018) Diagnostik von Exekutivfunktionen im Fußball. In: Lanwehr R., Mayer J. (eds) People Analytics im Profifußball. Wirtschaft - Organisation - Personal. Springer Gabler, Wiesbaden. doi: 10.1007/978-3-658- 21256-8_3.
Stoll, O. (2010). Biopsychologische Grundlagen von Kognition, Emotion und Motivation im Sport. In O. Stoll, I. Pfeffer, & D. Alfermann (Eds.),Psychologie Lehrbuch. Lehrbuch Sportpsychologie(1st ed., pp. 15-42). Bern: Verlag Hans Huber.
Swann, C., Moran, A. & Piggott, D. (2015). Defining elite athletes: Issues in the study of expert performance in sport psychology.Psychology of Sport and Exercise,16, 3-14. doi: 10.1016/j.psychsport.2014.07.004.
Taatgen, N. A. (2013). The nature and transfer of cognitive skills.Psychological Review,120(3), 439-471. doi: 10.1037/a0033138.
Thumfart, M. (2006).Optimales Taktiktraining imJugendfußball(1. Aufl.).Optimales Taktiktraining.
Turkeri, C., Ozturk, B., Buyuktas, B. & Ozturk, D. (2019). Comparison of Balance, Reaction Time, Attention and Bmi Values in Individual and Team Sports.Journal of Education and Learning,8(6), 119. doi: 10.5539/jel.v8n6p119.
Tsai, C.-L., & Wang, W.-L. (2015). Exercise-mode-related changes in task-switching performance in the elderly.Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9,Article 56.
Vaughan, R., Hagyard, J., Brimmell, J., & Edwards, E. (2020).The effect of trait emotional intelligence on working memory across athletic expertise. Journal of Sport Sciences. doi: 10.1080/02640414.2020.1840039.
Vänttinen, T., Blomqvist, M., Luhtanen, P. & Häkkinen, K. (2010). Effects of Age and Soccer Expertise on General Tests of Perceptual and Motor Performance among Adolescent Soccer Players.Perceptual and Motor Skills,110(3), 675-692. doi: 10.2466/pms.110.3.675-692.
Vestberg, T., Gustafson, R., Maurex, L., Ingvar, M. & Petrovic, P. (2012). Executive Functions Predict the Success of Top-Soccer Players.PLoS ONE,7(4), e34731. doi: 10.1371/journal.pone.0034731.
Voss, M. W., Kramer, A. F., Basak, C., Prakash, R. S. & Roberts, B. (2010). Are expert athletes ‘expert' in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise.Applied Cognitive Psychology,24(6), 812-826. doi: 10.1002/acp.1588.
Wang, C.-H., Chang, C.-C., Liang, Y.-M., Shih, C.-M., Chiu, W.-S., Tseng, P., Hung, D. L., Tzeng, O. J. L., Muggleton, N. G. & Juan, C.-H. (2013). Open vs. Closed Skill Sports and the Modulation of Inhibitory Control.PLoS ONE,8(2), e55773. doi: 10.1371/journal.pone.0055773.
Ward, P. & Williams, A. M. (2003). Perceptual and Cognitive Skill Development in Soccer: The Multidimensional Nature of Expert Performance.Journal of Sport and Exercise Psychology,25(1), 93-111. doi: 10.1123/jsep.25.1.93.
Weineck, J., Memmert, D. & Uhing, M. (2012).Optimales Koordinationstraining imFußball: Sportwissenschaftliche Grundlagen und ihre praktische Umsetzung. Spitta GmbH.
Williams, A. M., Davids, K., & Williams, J. G. (1999). Visual Perception and Action in Sport. London: Taylor & Francis.
Yu, Q., Chan, C. C. H., Chau, B. & Fu, A. S. N. (2017). Motor skill experience modulates executive control for task switching.Acta Psychologica, 180,88-97. doi: 10.1016/j.actpsy.2017.08.013.
Zaciorskij, V. M. (1972).Diekörperlichen Eigenschaften des Sportlers(1. Aufl.).Trainerbibliothek: Vol. 3. Berlin: Bartels & Wernitz.
Zwierko, T. (2008). Differences in Peripheral Perception between Athletes and Nonathletes.Journal of Human Kinetics,19(1), 53-62. doi: 10.2478/v10078-008-0004- z.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Sprachvorschau?
Diese Sprachvorschau bietet einen umfassenden Überblick über den Inhalt, einschliesslich Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielen, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Zusammenfassung, Abstract, Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Genderhinweis, Einleitung, Theoretische Grundlagen, Stand der Forschung, Fragestellung und Hypothese, Methodik, Ergebnisse, Diskussion, Fazit und Literaturverzeichnis. Die theoretischen Grundlagen umfassen Kognition, Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Reaktionsschnelligkeit und das Wiener Testsystem zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten.
Was ist das Wiener Testsystem (WTS)?
Das Wiener Testsystem (WTS) ist ein computergestütztes Trainings- und Diagnoseinstrument zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten, insbesondere im Sport. Es umfasst verschiedene Testreihen wie den Determinationstest (DT), den Test zur peripheren Wahrnehmung (PP), den komplexen Konzentrationstest (KKT) und den Reaktionstest (RT).
Was ist die periphere Wahrnehmung (PP) Testung?
Der PP-Test testet die Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit visueller Reize im peripheren Gesichtsfeld. Der Proband muss eine Trackingaufgabe absolvieren und gleichzeitig auf Reize im peripheren Gesichtsfeld reagieren.
Was erfasst der Reaktionstest (RT)?
Der RT erfasst die Reaktionszeit sowie die motorische Zeit auf einfache und komplexe optische bzw. akustische Signale. Die Hauptvariablen sind mittlere Reaktionszeit und mittlere motorische Zeit.
Was untersucht das Experten-Novizen-Paradigma?
Das Experten-Novizen-Paradigma untersucht, wie sich Experten von Novizen in Bezug auf sportartspezifische Expertise oder allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit unterscheiden.
Welche Hypothesen werden in der Studie überprüft?
Die Studie überprüft Hypothesen bezüglich kognitiver Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern, insbesondere bei der peripheren Reaktionszeit und der Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben, unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht.
Welche methodischen Ansätze wurden verwendet?
Es wurde eine Querschnittstudie mit Kaderathleten der Universität Hamburg durchgeführt. Die kognitiven Daten wurden mit dem Wiener Testsystem (WTS) erhoben und statistisch ausgewertet, einschliesslich Kovarianzanalyse (ANCOVA) zur Berücksichtigung von Alter und Geschlecht.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten kognitiven Differenzen zwischen Mannschafts- und Individualsportlern in Bezug auf periphere Reaktionszeit und Reaktionszeit bei Wahlreaktionsaufgaben. Das Alter hatte jedoch einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Es konnten keine signifikanten kognitiven Differenzen der verschiedenen Sportfelder festgestellt werden. Limitationen der Studie müssen berücksichtigt werden, denn Alter, Geschlecht und Leistungsniveau können einen großen Effekt auf die Ergebnisse haben.
Welche Schlüsselwörter werden verwendet?
Die Schlüsselwörter umfassen kognitive Differenzen, Mannschafts- und Individualsportler, Reaktionszeit, periphere Wahrnehmung, Wiener Testsystem und exekutive Funktionen.
- Quote paper
- Robin Feuerschütz (Author), 2020, Kognitive Unterschiede in Mannschafts- und Einzelsportarten. Eine Analyse mit dem Wiener Testsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1366180