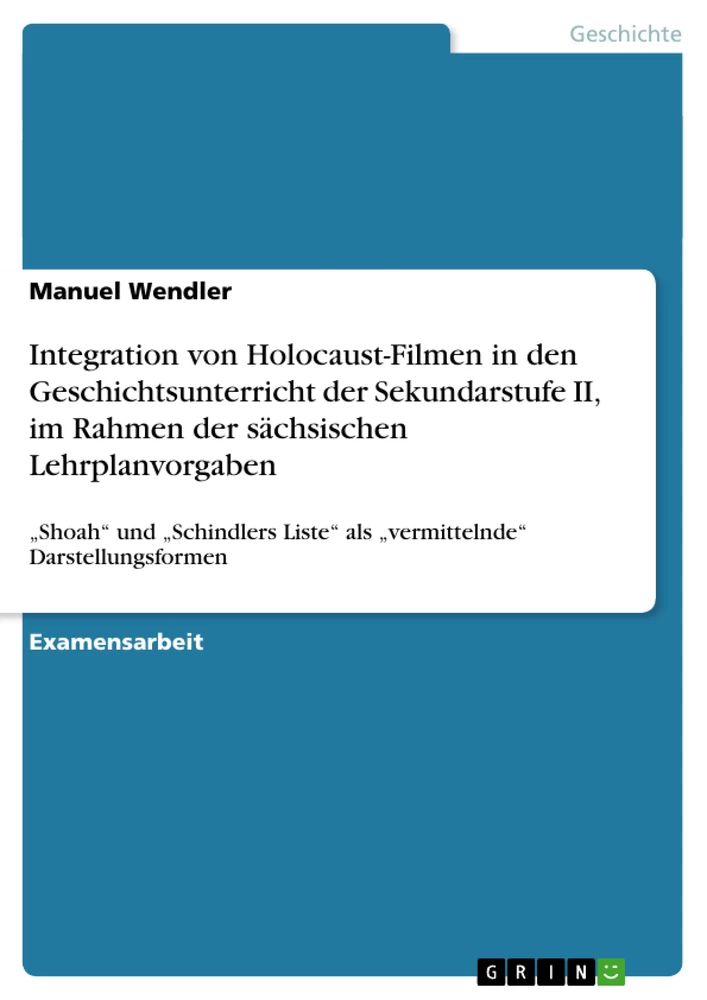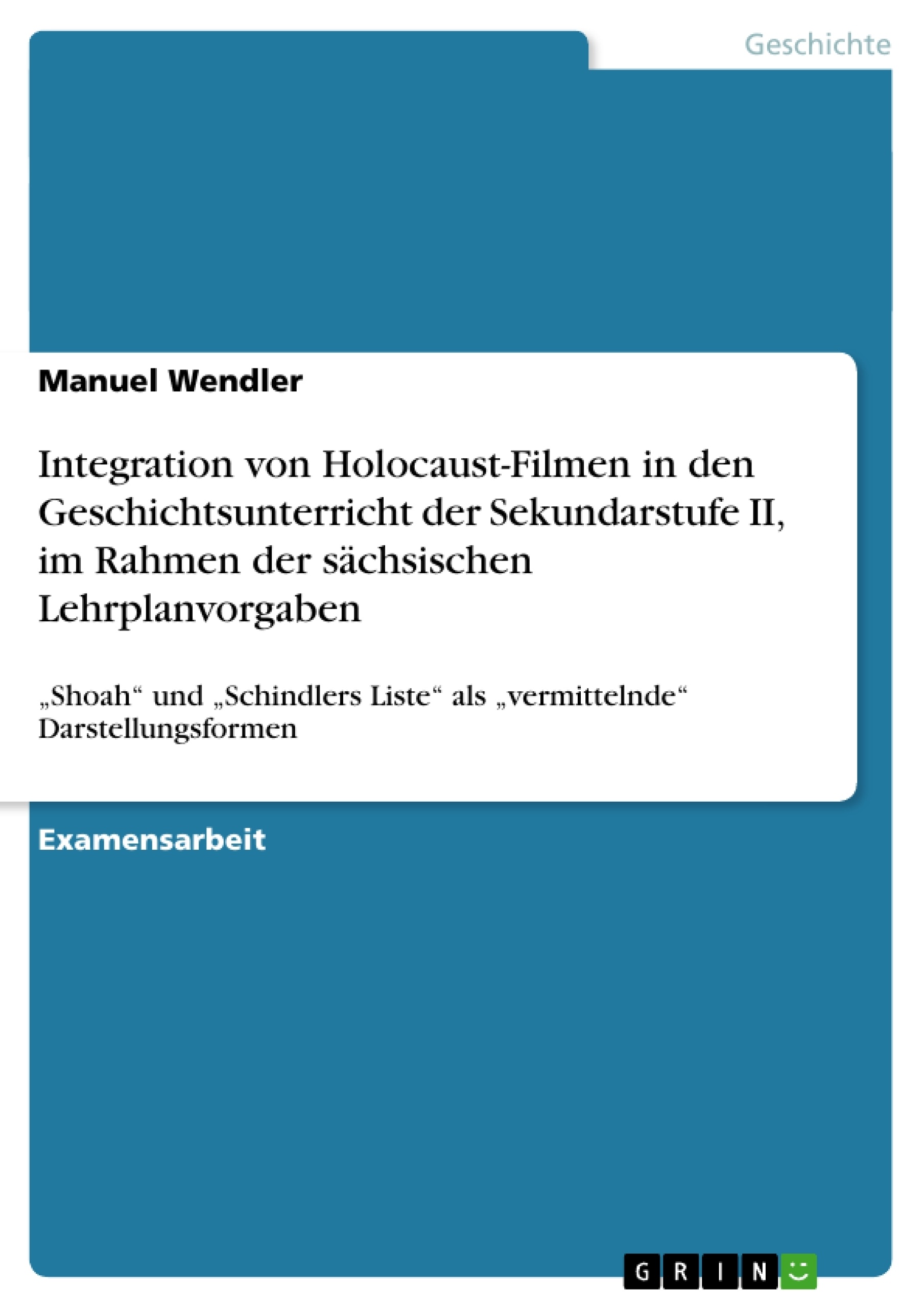Auf die implizierte Frage, ob es eine „Holocaust- Ästhetik“ gibt, antwortet Christan Angerer: „Im Lauf der Jahrzehnte hat sich – wenn auch stets kritisch von der Diskussion der Darstellbarkeit von Auschwitz begleitet – sozusagen das „Genre“ einer Holocaust- Ästhetik herausgebildet, insbesondere in Form der Holocaust- Literatur und des Holocaust- Films.“ Weiter schreibt er: „Viele dieser Texte und Filme prägen unser Gedächtnis […] sie sind nicht nur im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs präsent, sondern nehmen auch in didaktischen Aufbereitungen von Nationalsozialismus und Holocaust ihren Platz ein.“
Kein Zitat könnte treffender die Erkenntnisse der modernen Geschichtsdidaktik beschreiben wie dieses. Moderne Medien und Filme gehören heute genauso zum Unterrichtsgeschehen wie Lehrbuchtexte und Quellenpapiere. Tonfilme stellen sogar eines der wichtigsten audiovisuellen Unterrichtmittel überhaupt dar und gleichzeitig muss sich der heutige Geschichtslehrer darüber im Klaren sein, dass die Wirkung, die von Spielfilmen auf das Geschichtsbild der Schüler ausgeht, heute keinesfalls mehr zu unterschätzen ist. Die Spezifik, die gerade Filme über den Holocaust für sich vereinnahmen, stellt dabei aber eine Besonderheit dar. Nach jahrzehntelangen Diskussionen über die künstlerische Darstellung dieses abscheulichen und unvergleichbaren Massenmordes am jüdischen Volk und anderen Minderheiten, hat die Forschung diese Filme als eine Chance wahrgenommen, um den Verarbeitungsprozess und die schulische Thematisierung des Holocausts zu unterstützen.
Doch gleichzeitig gehen von der medialen Aufarbeitung von Geschichte auch Gefahren aus. Fachwissenschaftliche und didaktische Kompetenz sind gefragt, um sich die angebotene Chance auch zu Nutze zu machen. Kritisch muss hinterfragt werden und eine Methodenkompetenz muss vorhanden sein, um Authentizität und Fiktion von einander zu trennen. Das haben auch die Kultus- und Bildungsministerien erkannt. Methodentraining im Umgang mit bewegten Bildern hat Einzug in die Lehrpläne gehalten.
Doch welche Gattungen und Subgenres des Films sind geeignet, wo es doch keinen Kanon von unbedingt zu „konsumierenden“ Filmen für den Geschichtsunterricht gibt? Welche Möglichkeiten bieten sich denn durch den gesteuerten Einsatz von Filmen jeglicher Art im Geschichtsunterricht?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Geschichtswissenschaft und Medienwissenschaft
- Geschichtsdidaktik
- Terminologie und Methodik
- „Holocaust“
- Spielfilm, Dokumentation und „Holocaust-Film“
- Der Dokumentarfilm
- Der Spielfilm
- „Schindlers Liste“ und „Shoah“ im Geschichtsunterricht?
- Hauptteil
- „Shoah“ von Claude Lanzmann (1985)
- Inhalt
- Entstehung und Rezeption
- „Shoah“ aus der Sicht des Historikers
- Filmgattungsspezifik
- Auswahl der Zeitzeugen
- „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg (1993)
- Inhalt
- Entstehung und Rezeption
- „Schindlers Liste“ aus der Sicht des Historikers
- Das Medium Film im Geschichtsunterricht
- Pädagogisch-didaktische Vorüberlegungen
- Ausbildung von Medienkompetenz
- Die systematische Filmanalyse im Geschichtsunterricht
- Lehrplanvorgaben des Bundeslandes Sachsen
- Lehrplaninhalte des Bundeslandes Sachsens bis Klassenstufe 10
- Lehrplaninhalte des Bundeslandes Sachsen ab Klassenstufe 11
- Lernziele im Leistungskurs
- Lernziele im Grundkurs
- „Shoah“ im Geschichtsunterricht des Leistungskurses Klasse 11
- Einführung und Vorbereitung
- Die Betrachtung der Sequenzen
- Erstes Herangehen an den Film und spontane Gedankenreflexion
- Beantwortung der Beobachtungsaufgaben im Klassenverband
- Verflechtung der erarbeiteten Ergebnisse mit den historischen Hintergründen und den Lehrplanvorgaben
- „Schindlers Liste“ im Geschichtsunterricht des Leistungskurses Klasse 11
- Einführung und Vorbereitung
- Die Betrachtung des Films
- Erstes Herangehen an den Film und spontane Gedankenreflexion
- Beantwortung der Beobachtungsaufgaben im Klassenverband
- Verflechtung der erarbeiteten Ergebnisse mit den historischen Hintergründen und den Lehrplanvorgaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration von Holocaust-Filmen, insbesondere „Shoah“ und „Schindlers Liste“, in den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II in Sachsen. Ziel ist es, die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Verwendung dieser Filme zu beleuchten und ihren Einsatz im Kontext der sächsischen Lehrplanvorgaben zu evaluieren. Dabei wird die wissenschaftliche Diskussion um die Darstellung des Holocaust im Film berücksichtigt.
- Didaktische Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einsatz von Holocaust-Filmen im Unterricht
- Analyse der Filme „Shoah“ und „Schindlers Liste“ unter historisch-didaktischen Aspekten
- Kontextualisierung der Filme innerhalb der sächsischen Lehrpläne
- Entwicklung von methodischen Ansätzen für den filmbasierten Geschichtsunterricht
- Die Rolle von Authentizität und Fiktion in der filmischen Darstellung des Holocaust
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet den Forschungsstand in Geschichtswissenschaft, Medienwissenschaft und Geschichtsdidaktik bezüglich der Darstellung des Holocaust im Film. Sie definiert zentrale Begriffe wie „Holocaust“ und „Holocaust-Film“ und skizziert die methodischen Ansätze der Arbeit. Es wird die Bedeutung von Filmen im Geschichtsunterricht betont und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit deren Wirkung auf das Geschichtsbild der Schüler hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Frage, welche Filme sich für den Geschichtsunterricht eignen und wie man Authentizität und Fiktion trennen kann.
„Shoah“ von Claude Lanzmann (1985): Dieses Kapitel analysiert Claude Lanzmanns Dokumentarfilm „Shoah“. Der Inhalt des Films wird zusammengefasst, seine Entstehung und Rezeption beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf einer Betrachtung des Films aus historischer Perspektive, wobei die Filmgattungsspezifik und die Auswahl der Zeitzeugen kritisch untersucht werden. Die Analyse fokussiert auf die Wirkung der gezeigten Interviews und deren Bedeutung für das Verständnis des Holocaust.
„Schindlers Liste“ von Steven Spielberg (1993): Dieses Kapitel widmet sich Steven Spielbergs Spielfilm „Schindlers Liste“. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird der Inhalt, die Entstehung und die Rezeption des Films dargestellt. Die Analyse betrachtet den Film aus der Perspektive eines Historikers, indem die Darstellung der Ereignisse, die filmische Umsetzung und die mögliche Wirkung auf die Zuschauer untersucht werden. Die Analyse betont die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Spielfilm und Dokumentation im Kontext der Holocaust-Darstellung.
Das Medium Film im Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Verwendung von Filmen im Geschichtsunterricht. Es werden pädagogisch-didaktische Überlegungen angestellt, die Bedeutung der Medienkompetenzentwicklung betont und methodische Ansätze für die systematische Filmanalyse vorgestellt. Es wird die Frage diskutiert, wie Schüler die unterschiedlichen filmischen Darstellungsweisen kritisch reflektieren und analysieren können.
Lehrplanvorgaben des Bundeslandes Sachsen: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz des Themas Holocaust in den sächsischen Lehrplänen für die Sekundarstufe II. Die Lehrplaninhalte werden sowohl für die Klassenstufen bis 10 als auch für die Oberstufe (ab Klasse 11) analysiert, wobei die Lernziele in Grund- und Leistungskursen im Detail betrachtet werden. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Themas Holocaust und der Möglichkeiten der Verwendung von Filmen im Unterricht.
Schlüsselwörter
Holocaust, Geschichtsdidaktik, Medienpädagogik, Filmanalyse, „Shoah“, Claude Lanzmann, „Schindlers Liste“, Steven Spielberg, Lehrplan Sachsen, Sekundarstufe II, Authentizität, Fiktion, Zeitzeugen, Dokumentarfilm, Spielfilm, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Holocaust-Filme im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Einbindung von Holocaust-Filmen, insbesondere „Shoah“ und „Schindlers Liste“, in den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II in Sachsen. Sie beleuchtet die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes dieser Filme und evaluiert ihren Einsatz im Kontext der sächsischen Lehrplanvorgaben. Die wissenschaftliche Diskussion um die Darstellung des Holocaust im Film wird dabei berücksichtigt.
Welche Filme werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert ausführlich den Dokumentarfilm „Shoah“ von Claude Lanzmann (1985) und den Spielfilm „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg (1993). Die Analysen umfassen Inhalt, Entstehung, Rezeption und eine Betrachtung aus historisch-didaktischer Perspektive.
Welche Aspekte werden in den Filmanalysen betrachtet?
Die Filmanalysen untersuchen die Filmgattungsspezifik, die Auswahl der Zeitzeugen (bei „Shoah“), die Darstellung der Ereignisse, die filmische Umsetzung und die mögliche Wirkung auf die Zuschauer. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Spielfilm und Dokumentation im Kontext der Holocaust-Darstellung werden ebenfalls hervorgehoben.
Welche didaktischen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einsatz von Holocaust-Filmen im Unterricht. Sie betont die Bedeutung der Medienkompetenzentwicklung und präsentiert methodische Ansätze für die systematische Filmanalyse im Geschichtsunterricht. Die Frage, wie Schüler die unterschiedlichen filmischen Darstellungsweisen kritisch reflektieren und analysieren können, wird ausführlich diskutiert.
Wie werden die sächsischen Lehrpläne berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht die Relevanz des Themas Holocaust in den sächsischen Lehrplänen für die Sekundarstufe II. Die Lehrplaninhalte werden für die Klassenstufen bis 10 und die Oberstufe (ab Klasse 11) analysiert, wobei die Lernziele in Grund- und Leistungskursen im Detail betrachtet werden. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Themas Holocaust und den Möglichkeiten der Verwendung von Filmen im Unterricht.
Welche methodischen Ansätze werden für den Einsatz der Filme im Unterricht vorgeschlagen?
Die Arbeit skizziert methodische Ansätze für den filmbasierten Geschichtsunterricht, einschließlich der Einführung und Vorbereitung der Schüler, der Betrachtung der Filmszenen, der Reflexion der Eindrücke und der Verknüpfung der filmischen Inhalte mit historischen Hintergründen und Lehrplanvorgaben. Konkrete Beispiele werden für den Einsatz von „Shoah“ und „Schindlers Liste“ im Leistungskurs der 11. Klasse gegeben.
Welche Rolle spielen Authentizität und Fiktion in der Arbeit?
Die Arbeit diskutiert die Rolle von Authentizität und Fiktion in der filmischen Darstellung des Holocaust und zeigt auf, wie diese Aspekte im Unterricht kritisch reflektiert werden können, um ein differenziertes Geschichtsbild zu fördern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Holocaust, Geschichtsdidaktik, Medienpädagogik, Filmanalyse, „Shoah“, Claude Lanzmann, „Schindlers Liste“, Steven Spielberg, Lehrplan Sachsen, Sekundarstufe II, Authentizität, Fiktion, Zeitzeugen, Dokumentarfilm, Spielfilm, Medienkompetenz.
- Quote paper
- Manuel Wendler (Author), 2009, Integration von Holocaust-Filmen in den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II, im Rahmen der sächsischen Lehrplanvorgaben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136613