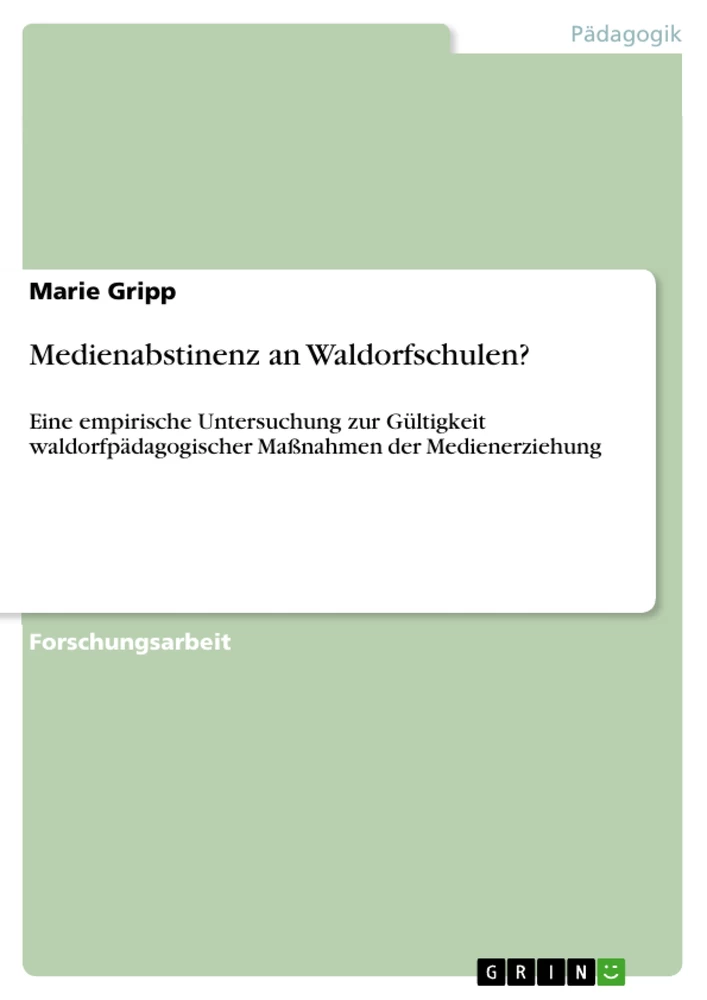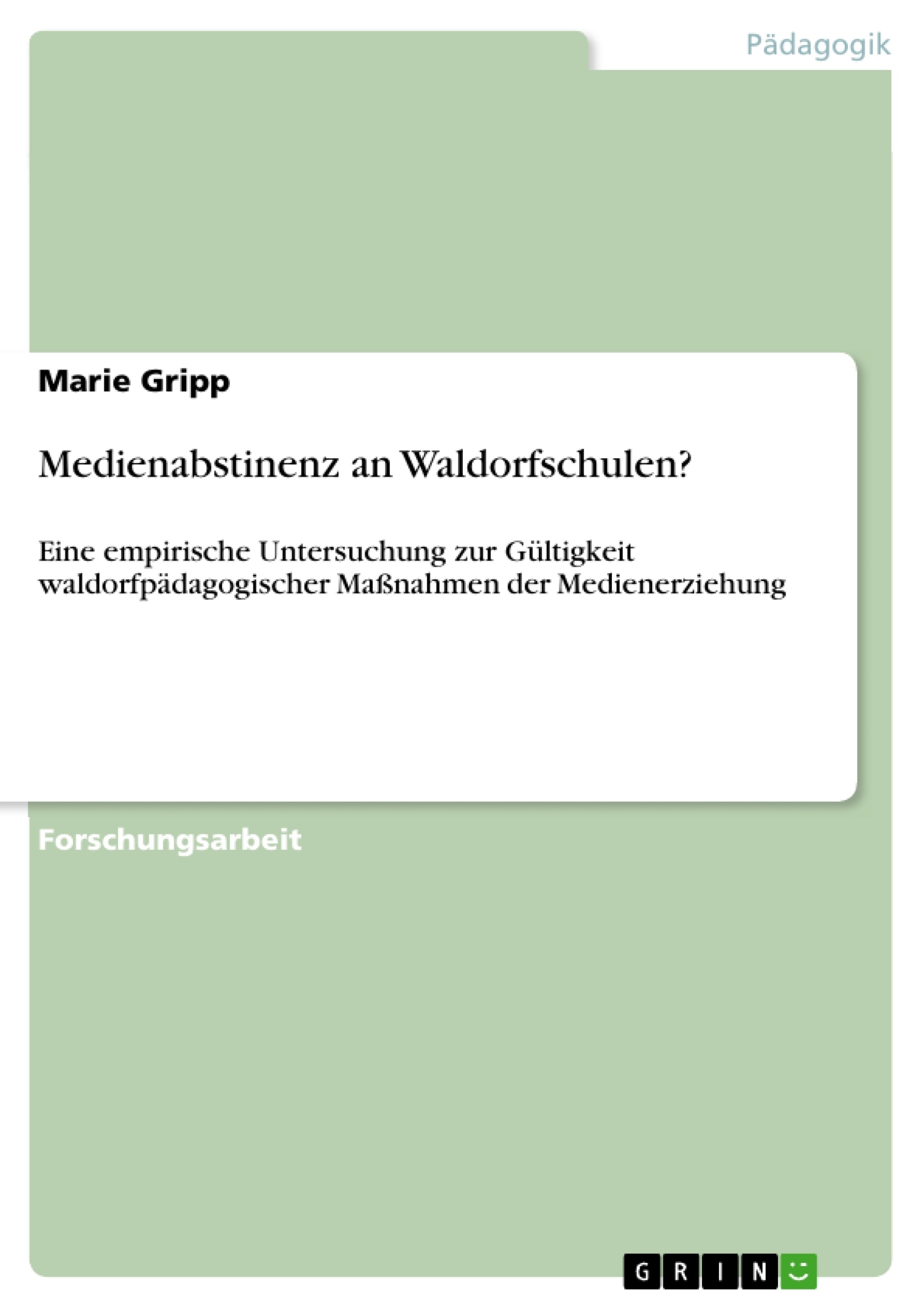Diese Forschungsarbeit untersucht die Gültigkeit eines waldorfpädagogischen Medienkonzeptes auf qualitative, wissenschaftliche Weise. Dabei wurde sich an einem exemplarischen Medienkonzept orientiert, welches als Grundlage für die geführten Interviews im Forschungsteil galt. Anhand der Aussagen von Schüler:innen der Schule wurde eine Beurteilung bezüglich der Gültigkeit des Konzeptes vorgenommen.
In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Chancen der Digitalisierung innerhalb des Bildungssektors aufgedeckt. Insbesondere seit den pandemiebedingten Einschränkungen wurde die Hinwendung zu digitalen Alternativen für die Unterrichtsgestaltung nahezu verlangt. Die Bildungspolitik hat erkannt, dass Smartphones, Tablets und Co. mittlerweile nicht mehr einzig und allein dem privaten Entertainment dienen, sondern ebenso im Rahmen der Bildungsmöglichkeiten eine bedeutsame Rolle einnehmen können. Aufgrund dieser relevanten Erkenntnisse wurde vor einigen Jahren der Beschluss gefasst, dass jede Schule ihr eigenes Medienbildungskonzept anzufertigen habe, welches an individuelle Rahmenbedingungen angepasst und entsprechend umgesetzt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen der waldorfpädagogischen ,Medienerziehung‘
2.1 Zum waldorfpädagogischen Medienbegriff
2.2 Medienmündigkeit & Medienabstinenz
2.3 Das Modell der ,indirekten und direkten Medienerziehung‘
2.4 Theoretische Grundlagen im Schulalltag: Das Medienkonzept der RSSW
3 Methodik
3.1 F orschungsdesign
3.2 Datenerhebung
3.2.1 Stichprobenauswahl
3.2.2 Durchführung der Methode
3.2.3 Reflexion der Methodendurchfuhrung: Stichprobenerweiterung
3.3 Datenauswertung
3.3.1 Methodologisches V orgehen
3.3.2 Das Kodierverfahren
3.3.3 Das Kategoriensystem
4 Ergebnisse
4.1 Darstellung der Ergebnisse
4.1.1 Kategorie 1 : Privater Umgang mit digitalen Medien
4.1.2 Kategorie 2: Schulintemer Umgang mit digitalen Medien
4.1.2.1 ,Medienarbeit an der Schule
4.1.2.2 ,Eindimensionalität‘
4.1.2.3 ,Einstellung der Lehrkräfte‘
4.1.2.4 ,Entzug steigert Verlangen‘
4.1.2.5 ,Mangelnde Grundlagenbildung‘
4.2 Analyse & Diskussion der Ergebnisse
5 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
Gemäß der Kultusministerkonferenz hat Schule folgenden Auftrag zu erfüllen: „Schülerinnen und Schüler sollen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden, die verantwortungsvoll, selbstkritisch und konstruktiv ihr berufliches und privates Leben gestalten und am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können“ (KMK, 2005, S. 6). Dazu gehört seit Zunahme digitaler Einflüsse im Alltag auch die Berücksichtigung von Medienkompetenz, welche laut den Beschlüssen der KMK im Jahre 2012 als fester Bestandteil grundlegender Kompetenzen gilt. Im Rahmen der Umsetzung von Medienbildung gelten sowohl das Lernen mit Medien als auch das Lernen über Medien als zentral (vgl. Süss et al., 2018, S. 11; KMK, 2012, S. 6).
In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Chancen der Digitalisierung innerhalb des Bildungssektors aufgedeckt. Insbesondere seit den pandemiebedingten Einschränkungen, wurde die Hinwendung zu digitalen Alternativen für die Unterrichtsgestaltung nahezu verlangt. Die Bildungspolitik hat erkannt, dass Smartphones, Tablets und Co. mittlerweile nicht mehr einzig und allein dem privaten Entertainment dienen, sondern ebenso im Rahmen der Bildungsmöglichkeiten eine bedeutsame Rolle einnehmen können. Aufgrund dieser relevanten Erkenntnisse wurde vor einigen Jahren der Beschluss gefasst, dass jede Schule ihr eigenes Medienbildungskonzept anzufertigen habe, welches an individuelle Rahmenbedingungen angepasst und entsprechend umgesetzt werden soll (vgl. KMK, 2012, S. 7).
Vergangenes Semester absolvierte ich ein Praktikum an einer Waldorfschule. Dort konnte ich beobachten, dass sich bei Weitem noch nicht alle Schulen den zentralen Potenzialen digitaler Bildungsmöglichkeiten zuwandten. Die rein analoge Gestaltung des Unterrichts sowie das strikte Untersagen der Nutzung elektronischer Geräte auf dem Schulgelände vermittelten sofort eine aversive Haltung digitalen Medien gegenüber. Meinen Beobachtungen zufolge holte der Großteil der Schüler rinnen jedoch nach Schulschluss trotzdem das Smartphon aus der Tasche. Das überraschte mich nicht weiter, denn laut der JIM-Studie des Jahres 2020 nutzen rund 97% der Jugendlichen Smartphones und das Internet in der Freizeit (S. 14). Dieser Aufprall von ,medienfreier Blase ^und der scheinbaren Alltagsrealität der Schülerrinnen, warf viele Fragen auf. Werden hier nicht die Augen vor der Realität verschlossen? Welche Zukunft hat das waldorfpädagogische Modell? All diesen Fragen sollte während meines Praktikums auf den Grund gegangen und schließlich im Rahmen dieser Arbeit diskutiert werden.
1 Hier: frei von digitalen Medien. Entgegen meinen Erwartungen wurde sich an meiner Praktikumsschule, der Rudolf-Steiner- Schule Wandsbek (im Folgenden RSSW), auf ein eigenes Medienkonzept berufen. Dafür spielt das Konzept der Erziehung zur Medienmündigkeit eine tragende Rolle, welches im Fortgang näher erläutert wird. Insofern existierten folglich konkrete schriftliche Vorgaben darüber, wie Medienbildung im Schulalltag auszusehen habe und schließlich umgesetzt werden soll. Bislang beobachtete ich jedoch eine auffällige Abweichung von theoretischem Konzept und praktischer Umsetzung. Beispielsweise wird in der Theorie vorgesehen, direkte Arbeit mit digitalen Medienträgem ab der 8. Klasse in den Unterricht zu integrieren. Das konnte ich selbst während meines gesamten Praktikumszeitraums nicht beobachten, was schlussendlich zur Anzweiflung dieser Konzeption führte.
Auf Grundlage meiner Recherche wies zudem der gegenwärtige Forschungsstand hinsichtlich der tatsächlichen Mediennutzung von Waldorfschülerdnnen einige Lücken auf, was mein Forschungsinteresse zusätzlich bestärkte. Der rudimentäre Stand lässt sich mitunter dadurch begründen, dass Waldorfschulen der privaten Trägerschaft unterliegen. Diese Erkenntnis impliziert, dass weniger statistische Erhebungen an Waldorfschulen durchgefuhrt werden.
Im Rahmen dieses Projektes wurde somit überprüft, in welchem Verhältnis das Konzept der waldorfpädagogischen Medienerziehung zu dem tatsächlichen Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen steht. Dabei wurde darauf abgezielt, einen realistischen Blick auf die Alltagsumstände der Schülerinnen zu gewinnen und somit zu beurteilen, wie zeitgemäß die Maßstäbe des Konzeptes von Medienmündigkeit im Zeitalter der Digitalisierung noch sind.
Folglich hat diese Arbeit die Überprüfung der Gültigkeit des Medienkonzepts der RSSW zum Ziel. Zunächst wird ein Einblick in die konzeptionellen Grundlagen waldorfpädagogischer Medienerziehung (2.1) gewährleistet, um eine grundlegende theoretische Basis für die weitere Ausführung zu schaffen. Dazu lohnt sich ein konkreter Blick in das Medienkonzept der RSSW (2.2), um den leitgebenden Vorschriften im weiteren Verlauf besser folgen zu können. Der methodische Teil dieser Arbeit versucht, das Forschungsdesign nachvollziehbar darzustellen (3.1). Dabei erfolgt sowohl ein Blick auf den Prozess der Datenerhebung (3.2) als auch eine Erläuterung des Auswertungsprozesses (3.3). Anschließend werden die Forschungsergebnisse und Erkenntnisse entsprechend dargestellt, analysiert und diskutiert (4). Das Fazit gilt als resümierende Schlussbetrachtung der zentralen Ergebnisse. Zudem erfolgt dort ein kurzer thematischer Ausblick sowie eine kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise.
2 Theoretische Grundlagen der waldorfpädagogischen ,Medienerziehung*
Zu Beginn meines Praktikums wurde mir eine Broschüre zu dem Thema waldorfpädagogischer Medienerziehung in die Hand gedrückt. Die prägnante Aufschrift „Die spätere Medienkompetenz wurzelt in einer frühen Medienabstinenz!“ (Hübner, 2015b, S. 11) sprang mir dabei direkt ins Auge. Diese radikale These erzeugte bei mir ein inständiges Gefühl der Irritation sowie des inneren Unbehagens. Man könne doch keine Entwicklung elementarer Kompetenzen erwarten, wenn man die Augen vor medialen Einflüssen gänzlich verschließt?!
Sobald man sich jedoch näher mit dem Medienbegriff der Waldorfpädagogik befasst, wird ersichtlich, dass dem Themenkomplex ,Bildung & Erziehung in der medialen Welt‘ durchaus Beachtung geschenkt wird. In leitgebenden Konzepten lässt sich allerdings ein vornehmlich kritischer Blick auf den Anstieg digitaler Einflüsse im Alltag erkennen, was sich mit meinen Erfahrungen aus dem Schulalltag deckt. Die Waldorfpädagogik hat über die letzten Dekaden hinweg ein eigenes Verständnis von Medienerziehung entwickelt, wie sich anhand der im Fortlauf diskutierten Literatur zeigt. Wodurch sich dieses Verständnis genau auszeichnet, soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden. Dabei werden die Begriffe der Medienmündigkeit bzw. Medienabstinenz sowie das Modell der indirekten und direkten Medienerziehung erläutert.
Anschließend wird das Medienkonzept der RS SW näher beleuchtet, welches sich am Modell der Medienmündigkeitserziehung orientiert. Gleich zu Anfang heißt es: „Die RS SW hat das Ziel, einen bewussten und souveränen Umgang mit den digitalen Medien zu pflegen“ (Anhang 2, Abb. 2, S. 33). Wie diese konkreten Maßnahmen aussehen, wird in Kapitel 2.4 dargelegt.
2.1 Zum waldorfpädagogischen Medienbegriff
Der Waldorfpädagogik liegt ein phänomenologischer Zugang zum Medienbegriff zugrunde. Dabei werden MedienzwÄa/Z, Medien/örw und MedienZrager klar voneinander getrennt (vgl. Hübner, 2017, S. 5). Insofern erfolgt eine Differenzierung auf verschiedenen Ebenen, auf denen Medien eine tragende Rolle spielen. Der MedienznAa/Z meint das zu Rezipierende, also schließlich das, was inhaltlich aufgenommen wird. Die Medien/önw beschreibt „das Verfahren, wie etwas vermittelt oder präsentiert wird“ (Hübner, 2015a, S. 5). Der MedienZrager gilt „als materielle Grundlage, auf oder innerhalb der sich das Vermittlungsverfahren vollzieht“ (ebd.). Häufig wird hierfür im alltäglichen Sprachgebrauch der Begriff des Mediums verwendet, worunter sich beispielsweise elektronische Geräte eingliedem. Die älteste Form des Medienträger stellt folglich das Buch dar, welches seinen Erfolg vor rund 500 Jahren Gutenberg zu verdanken hatte und sich seitdem als populäres Medium durchsetzt.
2.2 Medienmündigkeit & Medienabstinenz
„Ziel der Medienerziehung ist Medienmündigkeit“, proklamiert der Bund der Freien Waldorfschulen in seiner 12. Ausgabe des Blickpunkt Magazins (2020, S. 4). Das waldorfpädagogische Verständnis von Mündigkeit setzt einen gewissen Grad von Reife und Lebens-, sowie Welterfahrung voraus. Zudem wird davon ausgegangen, dass Medienträger die Fähigkeit haben, den Menschen stark zu beeinflussen: „[...] das Gerät fordert vom Bediener, dass er es in einer bestimmten Weise handhabt; das wiederum wirkt auf ihn zurück und verändert ihn subtil“ (Hübner, 2017, S. 6). Demzufolge müssen Schülerrinnen insofern ein gewisses körperliches sowie seelisches Entwicklungsstadium erreicht haben, bevor sie digitalen Umwelteinflüssen ausgesetzt werden. „Der sinnvolle Umgang mit dem Internet setzt eine willensstarke Persönlichkeit voraus. Deshalb muss in einer Pädagogik des Informationszeitalters die Stärkung und Schulung des Willens im Zentrum stehen“, so Hübner (2017, S. 17). Somit wird gezielt darauf geachtet, dass erst der Umgang mit möglichst vielen analogen Medientechniken beherrscht wird, bevor digitale Welten betreten werden. Dafür Schreiben, Lesen, Rechnen, Malen, Zeichnen sowie Musizieren als zentrale Kompetenzen, die zuerst ausgebildet werden sollen (vgl. BdFW2, 2020, S. 5).
In den ersten Kindheitsjahren sei eine intensive Beziehung zur realen Umwelt zu schaffen. Laut Kullak-Ublick bedeutet der frühe Verzicht auf elektronische Medien jedoch keine Verarmung, sondern ein Gewinn an Weltnähe und Welt(zu)gewandtheit (vgl. Kullak-Ublick, 2015, S. 22). Damit wird auf das Konzept der Medienabstinenz verwiesen. Hübner spricht in diesem Kontext auch von einer „Ermöglichungspädagogik“, die den Kindern dazu verhilft, Kräfte zu erwerben, „die sie für das Leben in einer von Informationstechnologie durchdrungenen Welt brauchen, die ihnen aber diese Welt nicht geben kann“ (Hübner, 2015b, S. 11). Insofern versucht der Waldorfpädagoge eine Erklärung für seine pointierte These zu leisten. Trotz dessen stimmt Hübner der These der Medienpädagogen Süss et al., ,Erziehung ohne Medienerziehung sei heute nicht mehr denkbar und Bildung ohne Medienbildung ebenso wenig' (vgl. 2013, S. 16) wiederum zu (vgl. Hübner, 2017, S. 3ff). Folglich impliziert der von ihm geprägte Begriff der Medienabstinenz nicht die Ignoranz der Tatsache, dass wir in einer Welt des Zuwachses digitaler Einflüsse leben. Wie genau die entsprechende Entwicklung von Medienkompetenz im Sinne der waldorfpädagogischen Medienerziehung nun gelingen kann, versucht Hübner anhand seines Modells der (in)direkten Medienerziehung zu zeigen.
2.3 Das Modell der indirekten und direkten Medienerziehung
In der Waldorfpädagogik herrscht somit Konsens darüber, dass der Umgang mit Medien den Menschen von seiner Leiblichkeit entfremde. Medienkompetenz setze demzufolge das sichere Verankertsein von Körper und Geist im Leben voraus (vgl. ebd., S. 9).
Auf Basis dieses Verständnisses entwickelte Hübner ein Modell für die Integration digitaler Medien im Rahmen waldorfpädagogischer Schulbildung (Anhang 2, Abb. 1, S. 32). Das dargestellte Curriculum orientiert sich hierbei am anthroposophischen Entwicklungsmodell des Kindes. Die Grafik veranschaulicht durch seine an- und absteigenden Kurven, wie sowohl indirekte als auch direkte medienpädagogische Maßnahmen ineinandergreifen. „Je älter ein Kind wird, desto mehr tritt die indirekte Medienpädagogik in den Hintergrund und die direkte Medienpädagogik erhält ein stärkeres Gewicht“, betont Hübner (2017, S. 10). Laut Hübner veranschaulicht die Grafik, dass das Kind im Laufe seiner Entwicklung mit der technologischen Entwicklung mitwachsen darf (vgl. ebd., S. 19).
Die direkte Medienpädagogik baut somit auf die Fähigkeit des Verstehens. Grundlage dafür stellen die Kompetenzen dar, die in der Phase der indirekten Medienpädagogik erworben wurden. Diese seien notwendig, da der Mensch den Anforderungen gewachsen sein muss, welche die technisch-mediale Welt stetig an ihn stellt (vgl. ebd., S. 9). Während der Hinwendung zu direkter Medienerziehung wird sich von der Ebene der Medieninhalte getrennt, indem unterschiedliche Medienformen und Medienträger sukzessiv integriert werden. Die Urteilsfähigkeit wird als Voraussetzung für die Arbeit mit Medien angesehen.
Die praktische Arbeit mit digitalen Medien wird folglich ab Beginn der Pubertät berücksichtigt. Ein kompetenter Umgang mit Technik sei erst dann möglich, wenn ein Verständnis für die Funktionsweise des jeweiligen Medienträgers entwickelt wurde (vgl. ebd., S. 14). Insofern wird beispielsweise zunächst der Prozess des Buchbindens praktisch erfahren, bevor sich mit der Funktionsweise von Computern befasst wird. Dabei wird die Zusammensetzung und der Aufbau des jeweiligen Medienträgers bereits vor seiner Nutzung untersucht. Somit soll versucht werden, den Schülerinnen die Differenzierung von Maschine und Mensch deutlich zu machen. Ab der Oberstufe sollen dann laut Curriculum grundlegende Schaltungen der Computertechnologie mithilfe von Relais oder Transistoren dann selbst gebaut und untersucht werden (vgl. ebd., S. 14). Dies soll bereits geschehen, „bevor man die Arbeitsweise mit Mikroprozessoren herausarbeitet“ (ebd.).
2.4 Theoretische Grundlagen im Schulalltag: Das Medienkonzept der RSSW
Wie sieht es nun mit der Umsetzung dieser theoretischen Richtlinien im waldorfpädagogischen Schulalltag aus? Meine Praktikumsschule der RSSW berief sich zumindest auf ein schriftliches Konzept für die Organisation der , Medienerziehungso wie es auch der Fall bei staatlich organisierten Schulen ist. Im Gespräch mit der Ausbildungsbeauftragten der RSSW wurde mir gegenüber betont, dass die Schule das entsprechende Konzept seit vielen Jahren transparent und offen behandele. Auf der Schul-Website wird sogar darauf hingewiesen, dass das Konzept Teil des Schulvertrages sei. Dort heißt es: „Zum Ende des Schuljahres 2017/2018 wurde ein Medienkonzept für unsere Schule fertig gestellt und verabschiedet. Dieses Konzept ist ab dem Schuljahr 2018/2019 Teil des Schulvertrages.“3
Das vierseitige Medienkonzept präsentiert die schulinteme Einbindungsstrategie von Medienarbeit an der RSSW (Anhang 2, Abb. 2, S. 33ff). Dort wird sich an dem vorab illustrierten Konzept der indirekten und direkten Medienerziehung orientiert. Für jede Klassenstufe bzw. Entwicklungsstufe der Schülerinnen werden konkrete Themenvorschläge sowie die jeweilige Vorgehensweise der Medienarbeit aufgeführt. Darüber hinaus lassen sich dort auch Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Medien Zuhause finden. Diese Form der Grenzüberschreitung zwischen Schul- und Privatleben erscheint zunächst sehr sonderbar. Da die Schule allerdings z.T. von Eltern mitfinanziert wird, liegt die enge Beziehung von Elternhaus und Schule nahe. Insofern tragen die Eltern der Schülerinnen auch bewusst bei der Mitgestaltung des Schulwesens bei. Trotzdem lassen sich in den seltensten Fällen konkrete Empfehlungen für den privaten Umgang mit Medien in Medienkonzepten von Schulen finden.
Von Klasse 1 bis 6 gelten Buch und Sprache als die zentralen „altersgemäße Medien“. Auf digitale bzw. elektronische Einflüsse soll ganzheitlich verzichtet werden - sowohl in der Schule als auch Zuhause. Sowohl das Lernen mit als auch über digitale Medien wird hiermit gänzlich ausgespart. Als Begründung dafür wird in entsprechende These vorangestellt (3.1):
[...] Alle digitalen Medien haben eine entwicklungsverzögemde und -hemmende Wirkung, da ihrem Konsum die menschliche Beziehung fehlt. Aktuelle Studien der Himforschung bestätigen dies und fordern eine Medienabstinenz in den ersten 7 Lebensjahren. (Anhang 2, Abb. 2, S. 33)
Auf welche Studien sich bezogen wird, wurde hier allerdings nicht vermerkt.
Insgesamt wird auf die Einbindung digitaler Medien im Unterricht bis zur 7. Klasse durchgehend verzichtet (3.4). Dort zeichnet sich eine Wendung ab, da die Schülerinnen ab Klasse 7 gemäß anthroposophischer Phasenlehre eine neue Entwicklungsstufe überschreiten würden (vgl. Hübner, 2017, S. 9). In diesem Schuljahr vollziehe sich der Übergang in die Phase des dritten Jahrsiebtes. Dies äußere sich vornehmlich dadurch, dass alles bisher Gelernte nun kritisch hinterfragt würde (Punkt 3.4). Insofern wird ein plötzlicher Entwicklungsschub vorausgesetzt. Ab dort gilt es, die Schülerinnen „sinnvoll und konstruktiv kritisch an die digitalen Medien heranzufuhren“. Als ,sinnvoll‘ wird hier die Thematisierung von Medien auf rein inhaltlicher Ebene betrachtet. Bis zur Oberstufe bleibt der Unterricht an der RSSW frei von jeglichen Medienträgem. Folgende Medieninhalte seien bis zur 9. Klasse zu behandeln:
- Rechtliche Grundlagen (Urheberrechte & Datenmissbrauch)
- Kriterien für die Glaubwürdigkeit von Intemetseiten und -beiträgen
- Cybermobbing
- Bildmanipulationen
- Smartphones
- Pornografie im Internet
- Computerspiele
Die Berücksichtigung digitaler Ressourcen im Unterricht setzt ab der 9. Klasse ein. Hier bleibt anzumerken, dass bereits der Übergang in die 9. Klasse den Beginn der Oberstufe markiert. Somit unterscheidet sich das waldorlpädagogische Konzept zusätzlich von dem der Regelschulen. Von da an sollen Schülerinnen den maßvollen Umgang mit elektronischen Geräten erlernen (s. Punkt 4). Dafür gilt es, die Arbeit mit digitalen Medien sukzessiv in den Unterricht einzubinden. Ab Klasse 9 taucht zusätzlich das Fach ,Computerkunde‘ auf, wo gezielte Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien erlernt werden sollen. Dieses Fach wird jedoch lediglich 3-6 Wochen in das gesamte Schuljahr eingebunden.
Gleichzeitig fallt dort zum ersten Mal der Begriff der ,Medienkompetenz‘. Dem Konzept zufolge heißt es, Schülerinnen „[...] sollen sich Kompetenzen bezüglich der Nutzung von digitalen Medien aneignen und Fähigkeiten erwerben, die zu einer Medienmündigkeit führen“ (4). Die Relevanz der Medienkompetenz spielt eine zentrale Rolle im Rahmen schulischer Bildung. Dabei scheint an dieser Stelle nicht eindeutig, wie diese Kompetenz überhaupt entwickelt werden soll, wenn die Einbindung von Medienarbeit zuvor weder im Unterricht noch Zuhause erfolgt ist. In der Erziehungswissenschaft herrscht mittlerweile jedoch Konsens darüber, dass sich der Erwerb von Kompetenzen als kumulativer Prozess verstehen lässt (vgl. Klieme et al., 2006; Lersch, 2007). Demnach vollzieht sich dieser Prozess über einen längeren Zeitraum, was insbesondere im Schulalltag zu berücksichtigen ist. Diesem Verständnis zufolge lässt sich schließlich nicht davon ausgehen, dass die Schülerinnen innerhalb kürzester Zeit eine ausgereifte Medienkompetenz auszubilden, gerade wenn der Umgang mit digitalen Ressourcen so lange unterbunden wurde.
Ab der 10. Klasse kommt die Nutzung des Computerraums zur Sprache. Auffällig scheint hier die plötzliche Einführung in die Themen „Aufbau eines Computers“ (4.2), „Grundzüge des Programmierens“ (4.3) sowie das „freiwillige Erlernen der Scriptsprache HTML“ (4.4).
Damit lässt sich festhalten, dass die Berücksichtigung von Medienträgem im Unterricht gemäß Medienkonzept der RSSW auf regelrecht auf schlagartige Weise erfolgt. Demzufolge bleiben digitale Medien im Schulalltag zumindest nicht gänzlich unberücksichtigt, wenn auch in den ersten Jahren äußerst zurückhaltend damit umgegangen wird. Trotz dessen zeichnet sich im Allgemeinen eine eher vorurteilsbehaftete, aversive Haltung digitalen Medien gegenüber ab.
3 Methodik
Dieser Teil der Arbeit stellt die methodische Vorgehensweise des Forschungsprojektes dar. Dabei werden die einzelnen Forschungsschritte näher beleuchtet. Zunächst wird das Forschungsdesign präsentiert, bevor sowohl das ausgewählte Verfahren der Datenerhebung als auch die methodologischen Schritte der Datenauswertung näher betrachtet werden. Im Rahmen des gewählten Erhebungsverfahrens erfolgt ein Blick auf die Auswahl der Stichprobe sowie den Prozess der Durchführung der Methode. Daraufhin wird die Auswertungsstrategie der gesammelten Daten erläutert und ein Überblick über das erstellte Kategoriensystem verschafft, welches als Grundlage der Ergebnisauswertung im darauffolgenden Kapitel gilt. Eine kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise erfolgt schließlich im Fazit.
3.1 F orschungsdesign
Um mehr über das alltägliche Mediennutzungsverhalten von Schülerinnen der RSSW herauszufinden, erschien eine direkte Befragung diesbezüglich als zielführend. Dafür wurde die Form der leitfadengestützten Einzelinterviews gewählt, da auf diese Weise eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema seitens Interviewer sowie Interviewten ermöglicht wurde.
Die explorative Erhebung wurde folglich mit einer qualitativen Forschungsmethode umgesetzt, um ein tiefergehendes Verständnis dahingehend zu entwickeln, inwiefern das waldorfpädagogische Medienkonzept der RSSW in der Praxis berücksichtigt wird und welche Auswirkungen es auf die Schülerinnen hat. Die Befragung hatte insofern zum Ziel, tiefere Einblicke in den Alltag der Schülerinnen sowohl in der Schule als auch Zuhause zu gewinnen.
3.2 Datenerhebung
Um exemplarisch herauszufinden, in welchem Verhältnis das Konzept der waldorfpädagogischen Medienerziehung zu dem tatsächlichen Mediennutzungsverhalten der Schülertinnen steht, wurde die Forschungsfrage dieser Arbeit mittels leitfadengestützter Interviews untersucht. Als Methode der Datenerhebung schien das problemorientierte Interview (PZI) nach Witzei als passend, um sich dem Forschungsziel zu nahem.
Diese Form des Interviews hat gemäß Witzei „die Aushandlung der subjektiven Sichtweise der Interviewten zum Ziel“ (2000, S. 5). Laut Mey gilt das PZI als ein diskursiv-dialogisches Verfahren, das die Befragten als Experten ihrer Orientierungen und Handlungen begreift (vgl. 1999, S. 145). Pohlmann weist darauf hin, dass das problemzentrierte Interview in der Ausrichtung zwar qualitativ bleibe, jedoch eine lose Abfolge der anzusprechenden Themen festlege (vgl. 2020, S. 232). Insofern gilt die Interviewform als semistrukturiert.
Bei Witzei werden drei zentrale Grundprinzipien genannt: die Problemorientierung, die Gegenstandsorientierung und die Prozessorientierung. Mit Problemorientierung ist gemeint, dass die Fragestellung der Untersuchung eine „gesellschaftlich relevante [...] Problemstellung“ (Witzei, 2000, S. 3) darstellt. Das Prinzip der Gegenstandorientierung besagt dabei, dass die Methoden der Datenerhebung sowie die spezifischen Gesprächstechniken flexibel angepasst werden und jeweils an die konkreten Anforderungen des Gegenstands angepasst werden. Das Prinzip der Prozesshaftigkeit wird als das Sich-darauf-Einlassen des Interviewenden auf das prozesshafte Geschehen der sozialen Interaktion verstanden (vgl. Misoch, 2015, S. 72). Damit ist ebenso die Möglichkeit der prozesshaften Entwicklung des Leitfadens sowie des gesamten Erhebungsprozesses miteingeschlossen. Für die Gewährleistung eines gelingenden Erhebungsprozesses wurde auf vier zentrale Instrumente zurückgegriffen: ein Kurzfragebogen, der Interviewleitfaden, die Tonaufzeichnung sowie das Post-Skriptum. Witzei schlägt diese Maßnahmen vor, um eine „authentische und präzise Erfassung des Kommunikationsprozesses“ (2000, S. 5) sicherzustellen.
Misoch hebt die Relevanz des Prinzips der Narration für das PZI hervor (vgl. 2015, S. 71). Insofern wurde bei Erstellung des Leitfadens darauf geachtet, zwischen verschiedenen Formen der Fragen zu wechseln, um den Erzählfluss aufrechtzuerhalten. Der Interviewleitfaden setzt sich zum einen durch erzählgenerierende Fragen (Anhang 2, Abb. 3, S. 37ff.: „Würdest du mir etwas über deinen privaten Umgang mit Medien erzählen?“) als auch durch verständnisgenerierende Fragen (Anhang 2, Abb. 3, S. 38): „Kannst du mir die Begriffe erklären?“) zusammen. Diese Kategorien gelten laut Witzei als zentral für den Unterstützung des Erzählflusses (vgl. Witzei, 2000, S. 8).
Eine vorformulierte Einleitungsfrage galt als Mittel der Zentrierung des Gesprächs auf das zu untersuchende Problem (vgl. ebd., S. 7). Dabei wurde der Fokus bewusst auf die persönliche Haltung zum Nutzungsverbot von Smartphones auf dem Schulgelände gesetzt (Anhang 2, Abb. 3 : „Hier an eurer Schule herrscht ja überall ein ausdrückliches Handyverbot, oder?! Wie findest du das?“). Somit wurde das Prinzip der erzählgenerierenden Einstiegsfrage von Pohlmann aufgegriffen (vgl. Pohlmann, 2020, S. 232). Dort wurde sowohl das Problem direkt zum Ausdruck gebracht als auch die persönliche Einstellung dazu herausgefordert. Darüber hinaus wurde das Prinzip der Konfrontation (Witzei, 2000, S. 6) berücksichtigt, indem den Befragten jeweils das Medienkonzept vorgelegt und daraufhin deren Reaktion dazu eingefordert wurde.
3.2.1 Stichprobenauswahl
Die Auswahl der Befragten erfolgte eher zufällig, jedoch unter bestimmter Eingrenzung. Bereits während der Konkretisierung des Forschungsexposés war ersichtlich, dass sich die Auswahl der infrage kommenden Teilnehmerinnen auf Schülerinnen aus meiner Praktikumsklasse beschränken würde, da zu ihnen bereits ein Verhältnis entwickelt worden war. Insofern wurde sich erhofft, dass die Teilnehmerinnen entsprechende Bereitschaft zeigen würden, persönliche Perspektiven im Gespräch offenzulegen. Vorab wurde sich aufgrund des Arbeitsumfangs auf die Durchführung von drei bis vier Interviews beschränkt.
Die Auswahl der Interviewpartner geschah auf recht unwillkürlichem Wege: Am Ende meiner letzten Unterrichtsstunde kamen drei Schülerinnen zu mir ans Pult, um mit mir zum Verlauf meines Praktikums zu sprechen. Die Initiative kam dabei von den Schülerinnen. Einige von ihnen stellten mir Fragen zum Lehramtsstudium. Im Zuge dessen fragte ich die Schülerinnen spontan, ob sie Lust und Zeit hätten, an einer kurzen Befragung zum Thema Mediennutzung an Waldorfschulen in der darauffolgenden Woche teilzunehmen. Daraufhin sagten alle der angesprochenen Schülerinnen direkt zu. Auf den Vorschlag einer Schülerin hin, wurden Telefonnummern ausgetauscht, um die Termine zu organisieren. Die eigentlich übliche Art der Terminkoordination wirkte dem Forschungsgegenstand entsprechend plötzlich ironisch, da direkt auf die Verwendung digitaler Geräte zurückgegriffen wurde.
Alle der drei ausgewählten Interviewpartner waren somit Schülerinnen der 10. Klasse der RSSW, 15 Jahre alt und besuchten die Schule von der 1. Klasse an. Zwei der befragten Personen waren dabei weiblich und eine männlich. Insofern lag relativ wenig Diversität im Hinblick auf die Interviewpartner vor. Aufgrund der soziodemografischen Ähnlichkeit der Teilnehmerinnen wurde auf die Erstellung einer Übersicht der entsprechenden Merkmale verzichtet. Im Fortgang (3.2.3) wird die Auswahl der Stichprobe noch einmal diskutiert.
3.2.2 Durchführung der Methode
Die Erhebung der Daten fand während des Zeitraums vom 12.-16.09.2022 statt. Der Erhebungszeitraum deckte sich mit meiner letzten Praktikumswoche. Dort fand ebenso eine Projektwoche zum Anlass des Hundertjährigen Jubiläums der Schule statt. Insofern hatten die Schülerinnen keinen Regelunterricht, was mehr Freiheiten im Hinblick auf die Durchführung der Interviews während der eigentlichen Schulzeit erlaubte. Die Termine wurden so koordiniert, dass die Gespräche an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der zweiten großen Pause stattfinden konnten. Den Teilnehmenden wurden vorab keine weiteren Informationen zum Ablauf gegeben. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass für die Interviews in etwa eine halbe Stunde veranschlagt werden würde.
Als Durchführungsort wurde der Sprachraum I der Schule gewählt. Die Interviews konnten jeweils während der zweiten großen Pause durchgeführt werden. Insgesamt verliefen diese ungestört und ohne weitere Komplikationen. Zu Beginn der Aufnahme wurde eine mündliche Einverständniserklärung zur Einwilligung der Teilnahme sowie die der Audioaufzeichnung eingeholt. Darüber hinaus erfolgte ein zusätzlicher Hinweis auf die unbedingte Wahrung der Anonymität der Befragten. Zusätzlich wurde auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, das Interview jederzeit abbrechen zu können. Während der Interviews wurden situativ immanente sowie exmanente Fragen gestellt, um den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten. Der zeitliche Umfang der Interviews lag jeweils zwischen 22 und 37 Minuten (Anhang 3, S. 40ff). Im Anschluss an die Durchführung wurde ein kurzes Post-Skriptum angefertigt, welches dem Festhalten von zentralen Besonderheiten und Kemaussagen des jeweiligen Gesprächs diente.
3.2.3 Reflexion der Methodendurchflihrung : Stichprobenerweiterung
Während der Interviewdurchführung galt sowohl das unterschiedliche Sprechtempo als auch der andersartige Sprechanteil der Schülerinnen als besonders auffällig. Das machte sich insbesondere während des Transkriptionsprozesses bemerkbar. Ein Interview überstieg die vorab veranschlagten 30 Minuten. Gerade dort fiel es schwer, den Bogen zurück zum Leitfaden zu schlagen, da die Schülerin das Gespräch sehr stark selbst steuerte. Ein anderes Interview nahm gerade mal die Hälfte der Zeit in Anspruch. Dort war wesentlich mehr Input seitens des Interviewenden erforderlich, indem weitere ad hoc Fragen gestellt und Impulse gesetzt wurden. Noch vor der formalen Auswertung der Daten fiel auf, wie eingeschränkt die getroffene Auswahl der Befragten war. Für Zwecke des Vergleichs unter den Schülerinnen der gleichen Klasse galt die Vorgehensweise als adäquat. Auf recht spontane Weise ergab sich jedoch die Chance auf ein weiteres Interview mit einer ehemaligen Waldorfschülerin einer Rudolf- Steiner-Schule (Anhang 3, S. 77ff). Die Interviewpartnerin stammte aus entferntem persönlichem Bekanntenkreis. Durch die Berücksichtigung einer externen Perspektive wurde sich ein weiterer Blickwinkel auf das Thema erhofft. Auf Basis eigener Vorüberlegungen ließe sich im Gespräch ein retrospektiver Transfer der Waldorf-Vergangenheit auf die jetzigen Umstände der Interviewpartnerin herstellen. Die Stichprobe wurde somit folglich ausgeweitet.
Der bestehende Leitfaden wurde für das Interview mit der Ehemaligen entsprechend angepasst, indem zusätzliche Fragen zum persönlichen Mediennutzungsverhalten integriert wurden und sich weniger an den konkreten Leitlinien der RSSW orientiert wurde. Da die Befragte jedoch selbst eine Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg besuchte, wurde recht schnell ersichtlich, dass dort ähnliche Konzepte zugrunde lagen. Somit ließ sich auf eine Zusammenarbeit der Schulen schließen. Darüber hinaus wurde ein Blick auf den Einstieg in die Berufswelt geworfen. Es wurde auf die unterschiedlichen Vergleichsbedingungen hingewiesen, da ca. 7 Jahre zwischen der Ehemaligen und den aktuellen Schülerinnen liegen.
Die ehemalige Waldorfschülerin besuchte die RSS in Nienstedten und schloss die Schule im Jahr 2019 mit dem Abitur ab. Nun ist sie 22 Jahre alt und studiert Wirtschaftspsychologie an einer privaten Universität in Hamburg. Nebenbei arbeitet sie als Werkstudentin im Bereich Social Media. Insofern ist sie täglich auf die Nutzung diverser Medien im Alltag angewiesen. Das Interview wurde am 03.11.2022 gegen Abend bei mir zuhause durchgefuhrt. Somit entstand durch die private Räumlichkeit als auch die Uhrzeit ein etwas persönlicheres Setting.
3.3 Datenauswertung
Der folgende Abschnitt geht auf den Prozess der Datenaufbereitung sowie -auswertung ein, mit dem einige Wochen nach Abschluss der Interviewdurchführung begonnen wurde. Die Transkription der Interviews erfolgte einige Wochen nach der Durchführung. Dabei wurden idle personenbezogenen Daten entsprechend anonymisiert. Der Prozess nahm einige Zeit in Anspruch, da das Audiomaterial insgesamt nahezu zwei Stunden umfasste. Für das Umschreiben der Audiodateien in das Textformat wurde das Programm trint verwendet. Die einzelnen Transkripte sind jeweils in Anhang 3 (ab S. 40ff.) aufgeführt.
Für die Strukturierung des Materials wurden Kategorien gemäß dem Prinzip der Grounded Theory entwickelt. Dieses Prinzip wird im Fortlauf skizziert, bevor sich dem konkreten Kategoriensystem gewidmet wird.
3.3.1 Methodologisches Vorgehen
Auswertungsgrundlage dieses Projektes ist die methodologische Strategie der Grounded Theory, welche in den 60er Jahren von den amerikanischen Soziologen A. Strauss & B. Glaser entwickelt wurde. Das Prinzip wurde in den 90er Jahren von A. Strauss & J. Corbin überarbeitet und wird bis heute von anderen Soziologinnen stetig weiterentwickelt (vgl. Heiser, 2018, S. 256). Damit gilt diese methodologische Vorgehensweise als eines der populärsten Auswertungsmethoden innerhalb der qualitativen Sozialforschung.
Die Grundidee der Grounded Theory bestehe darin, auf eine Theorieentwicklung abzuzielen (vgl. Heiser, 2018, S. 208). Diese Methodologie hat damit zum Ziel, eine neue Theorie auf Basis empirisch gesammelten Datenmaterials zu generieren oder aber bestehende Theorien zu erweitern. Aufgrund der geringen Datenlage des in der Praxis beobachteten Phänomens, schien diese Methodologie angesichts des Forschungsgegenstandes als adäquate Auswertungsstrategie.
In ihrer überarbeiteten Auflage verweisen Strauss & Corbin auf die Entwicklung eines dreistufigen Prozessmodells des Kodierens (vgl. Strauss et al., 1996, S. 57ff). Entsprechende Kordier-Prinzipien werden an dieser Stelle einmal grob skizziert:
Offenes Kodieren
Bei diesem Prozess wird sich häufig zuerst an zentralen W-Fragen orientiert, um sich einen Überblick zu verschaffen. Hier werden die erhobenen Daten aufgebrochen und kleinschrittig mit sogenannten theoretischen Konzepten versehen. Diese werden voneinander abgegrenzt, indem ihre Eigenschaften rekonstruiert werden. Zusammengehörende Konzepte werden zu Kategorien abstrahiert. Das Ergebnis dieses Schrittes ist ein vorläufig ungeordneter Bestand von Kategorien. Es bietet sich zudem an, sich bei den ersten gesammelten Codes nah am Gesagten zu orientieren (in vivo).
Axiales Kodieren
Im Rahmen des axialen Kodierens werden die herausgearbeiteten Kategorien zueinander in Beziehung gesetzt - also insofern geordnet. Das Ergebnis dieses Schrittes ist ein sogenanntes Kodierparadigma, welches ein Netzwerk aus Kategorien herstellt.
Selektives Kodieren
Im Rahmen des selektiven Kodierens wird die sogenannte Kernkategorie herausgearbeitet, die das untersuchte Phänomen zu erklären vermag. In diese Kemkategorie haben sich alle umliegenden Kategorien zu integrieren. Wenn Probleme bei der Integration von Kategorien zu einem theoretischen Modell auftauchen, ist dies somit häufig ein Hinweis auf eine falsch ausgewählte Kemkategorie.
Diese Prozesse verlaufen jedoch nicht linear in der hier dargestellten Reihenfolge, sondern wechseln sich in der Praxis immer wieder ab. Daher bleibt der Prozess nur schwer exemplarisch darzustellen. Der grafischen Veranschaulichung der Zirkularität des Prozesses dient hier Anhang 2, Abbildung 4 (S. 39). Insofern erscheint das gesamte Analysevorgehen erscheint recht komplex und erfordert einen hohen Zeitaufwand. Auch Sampling, also Datenerhebung und -auswertung können parallel verlaufen und müssen nicht aufeinander folgen. Somit gilt der Auswertungsprozess erst dann als „theoretisch gesättigt“, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden (vgl. Heiser, 2018, S. 42).
Da dieses Projekt die Generierung einer neuen Theorie zur Gültigkeit des Medienkonzeptes der RSSW anhand einer qualitativen Analyse von Schülerrinnenaussagen zum Ziel hatte, wurde sich schließlich für diese methodologische Strategie entschieden.
3.3.2 Das Kodierverfahren
Die Software MAXQDA diente der Kodierung des Materials. Es wurde sich zunächst ein chronologischer Überblick geschaffen, indem konkrete Aussagen zu zentralen Geschehnissen in unterschiedlichen Klassenstufen kategorisiert wurden (Klasse 6 bis 11). Insofern ließ sich ein erster Eindruck hinsichtlich der progressiven Entwicklung von einer indirekter zu einer direkten Medienpädagogik gewinnen. Mithilfe der Memofunktion des Programms MAXQDA, konnten einige Gedanken zu den Aussagen festgehalten werden. Während des Kodierprozesses wurden entsprechende Konzepte aus dem Material hervorgearbeitet, die essenziell für das Nachgehen des eigentlichen Forschungsanliegens erschienen. Diese Markierung zentraler Konzepte erfolgte nach dem Schema des Clusterings. Insofern wurden zentrale Aussagen immer wieder zueinander in Beziehung gesetzt, bis ein System entstand, was das gezielte Nachgehen der Forschungsfrage ermöglichte. Die entstandenen Konzepte überschnitten sich dabei zu Teilen mit zentralen Kemaspekten, die bereits während der Erstellung des Interviewleitfadens (noch vor Beginn der eigentlichen Datenerhebung) berücksichtigt wurden (siehe Kategorie 1, Kap. 3.3.3). Diese Form der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial erlaubte das finale Abstrahieren zu übergeordneten und untergeordneten Kategorien. Demzufolge erfolgte die Zusammenstellung eines Kategoriensystems auf induktive Weise.
3.3.3 Das Kategoriensystem
Um den Einfluss des Medienkonzeptes auf die persönliche Haltung der Schülerinnen sowie deren individuelles Nutzungsverhalten näher untersuchen zu können, wurden schließlich zwei übergeordnete Kemkategorien gebildet:
Kategorie 1 : Privater Umgang mit digitalen Medien
Kategorie 2: Schulintemer Umgang mit digitalen Medien
Die im Fortgang präsentierten Subkategorien zu Kategorie 2 entstanden bereits vor Ausdifferenzierung der Kemkategorien. Diese Subkategorien wurden schließlich gebündelt Kategorie 2 zugeordnet. Insofern erfolgt im Rahmen der Ergebnispräsentation eine vertieftere Auseinandersetzung mit den Inhalten der Aussagen zu Kategorie 2, da diese als besonders zentral für die Beantwortung der Leitfiage erschienen. In Kategorie 1 wird ein Einblick in die Nutzungsprofile sowie die zentralen Überschneidungspunkte der Befragtengewährleistet. Demzufolge wurden für Kategorie 1 keine einzelnen Subkategorien gebildet.
Anhang 2, Abb. 5 (S. 39) leistet einen tabellarischen Überblick bezüglich des entstandenen Kategoriensystem. Folgende Kategorien ließen sich Kemkategorie 2 zuordnen und stellen somit entsprechende Subkategorien dar, die im Fortlauf näher beleuchtet werden:
,Medienarbeit an der Schule‘
,Eindimensionalität‘
,Einstellung der Lehrkräfte‘
,Entzug steigert Verlangen‘
,Mangelnde Grundlagenbildung‘
4 Ergebnisse
Während des Auswertungsprozesses wurden zentrale Inhalte hervorgearbeitet, die als relevant für die Beantwortung der Forschungsfragen galten. Zunächst werden die Ergebnisse mithilfe des entsprechenden Kategoriensystems dargestellt und interpretiert. Anschließend wird aufgezeigt, welche Erkenntnisse daraus für die Praxis resultieren und in welchem Zusammenhang diese mit der eingangs gestellten Forschungsfrage stehen.
4.1 Darstellung der Ergebnisse
Durch Kategorie 1 ließ sich das jeweilige Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen sowie der Einfluss digitaler Ressourcen in deren Alltag besser nachvollziehen. Kategorie 2 gewährt Einblicke in die Einstellung der Schülerinnen gegenüber dem Medienkonzept der RSSW.
Die Quellenverweise in der Darstellung der Ergebnisse beziehen sich jeweils auf die Transkripte der Interviews. Um im Fortlauf eine entsprechende Übersichtlichkeit zu gewährleisten, sind die Quellenverweise durch Kürzel gekennzeichnet und entsprechend in den Fließtext miteingebunden. Die erste Ziffer beschreibt die Nummer des Interviews, danach folgt die Seitenzahl sowie die Zeitangabe:
Interview 1: Sarah (Abkürzung: 1)
Interview 2: David (Abkürzung: 2)
Interview 3: Josefine (Abkürzung: 3)
Interview 4: Maria (Abkürzung: 4)
Die vollständigen Transkripte finden sich in Anhang 3 (S. 40ff).
4.1.1 Kemkategorie 1 : Privater Umgang mit digitalen Medien
Zunächst werden zentrale Aussagen zusammengefasst, die der Interpretation des jeweiligen privaten Medienkonsums der Befragten dienen. Insofern wird ein Einblick in die Nutzungsprofile der Schülerinnen als auch der ehemaligen Waldorfschülerin gewährleistet.
Alle Befragten gaben zunächst im, im Besitz eines Smartphones zu sein (vgl. 1,41, [00:03:21]; 2, 50, [00:03:26]; 3, 61, [00:07:02]; 4, 74, [00:06:00]). Sowohl Maria als auch Josefine behaupteten, dass sie davor für längere Zeit ein Tastenhandy nutzten (vgl. 3, 60, [00:05:14]; 4, 74, [00:05:21]). Diese dienten dazu, den Eltern im Notfall Bescheid geben zu können (ebd.).
Zusätzlich gaben bis auf Josefine alle Befragten an, im persönlichen Besitz weiterer Medienträger zu sein: „Jetzt habe ich ein Tablet. Ich habe ein Handy. Ich habe einen Computer, ein Notebook. So ... also ich habe freien Zugang dazu, was ich auch gut finde“ (1, 42, [00:04:21]). David selbst hat eine Xbox (vgl. 2,50, [00:02:15]) und Maria nutzt verschiedenste Mediengeräte, wie PC, Laptop und Smartphone sowohl privat als auch für die Arbeit (vgl. 4, 73, [00:03:21]). Dadurch käme ebenso die geschätzte Bildschirmzeit von ca. 9h pro Tag bei Maria zustande (ebd.). Sarah und David gaben an, dass sie im Durchschnitt 5-6h pro Tag vor dem Bildschirm verbringen würden (vgl. 1,42, [00:05:12]; 2, 51, [00:04:57]). Dabei seien aber auch passives Streaming von Musik oder Serien bei Netflix mitinbegriffen. Zudem verwies Sarah darauf, dass sie ebenso auf ihrem Tablet zeichne, wodurch sich ihre Bildschirmzeit zusätzlich steigere (ebd.). David gab an, dass die Jahreszeit Einfluss auf seine Bildschirmzeit hätte (vgl. 2, 50, [00:02:15]). Im Sommer würde er entsprechend weniger ,zocken‘ als im Winter (ebd.). Josefine, die selbst keine Medienträger außerhalb ihres Smartphones besitzt (vgl. 3, 65, [00:17:06]), kommt gemäß eigener Einschätzung auf ca. 3-4h Bildschirmzeit pro Tag (vgl. 3, 63, [00:14:08]).
Alle Befragten gaben an, dass sie im Kontext der Digitalisierung insbesondere die Aspekte der Zeitersparnis sowie die der Erleichterung bestimmter Prozesse (digitale Konferenzen für Homeschooling, Kommunikation durch Chat Anwendungen, Recherche für Schulisches, Wegführung wie Google Maps u.a.) als vorteilhaft erachten würden (vgl. 1, 42, [00:05:52]; 2, 51, [00:05:17]; 4, 76, [00:09:13]).
[...]
2 Im Literaturverzeichnis als Bund der Freien Waldorfschulen gekennzeichnet.
3 Waldorfschule Wandsbek: https://waldorfschule-wandsbek.de/eltem/medienkreis/medienkonzept/.
- Quote paper
- Marie Gripp (Author), 2023, Medienabstinenz an Waldorfschulen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1366055