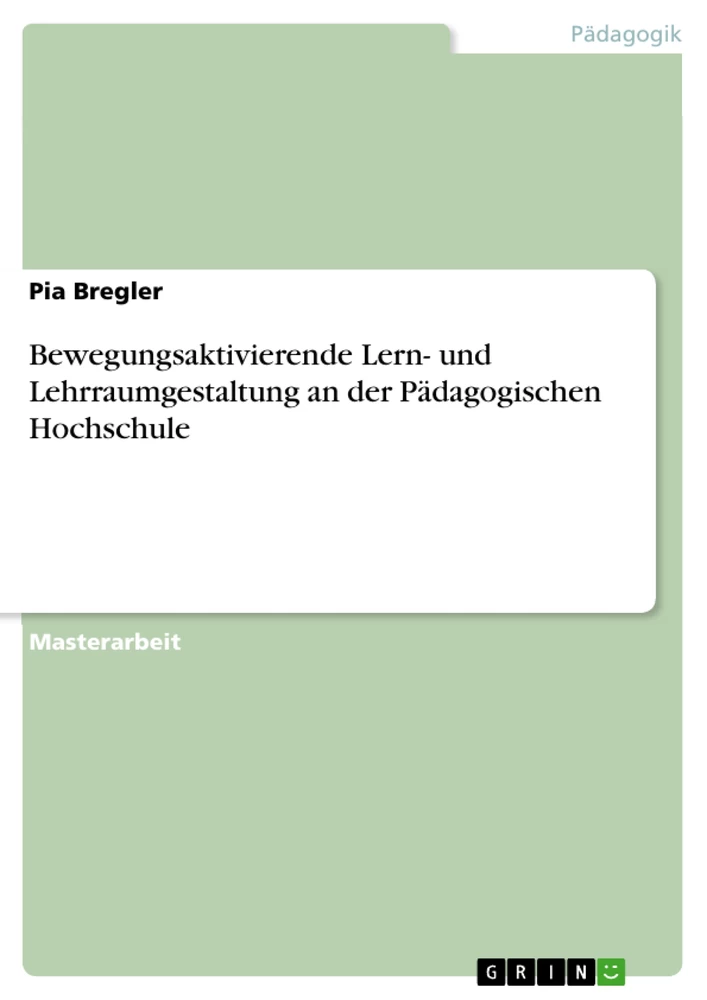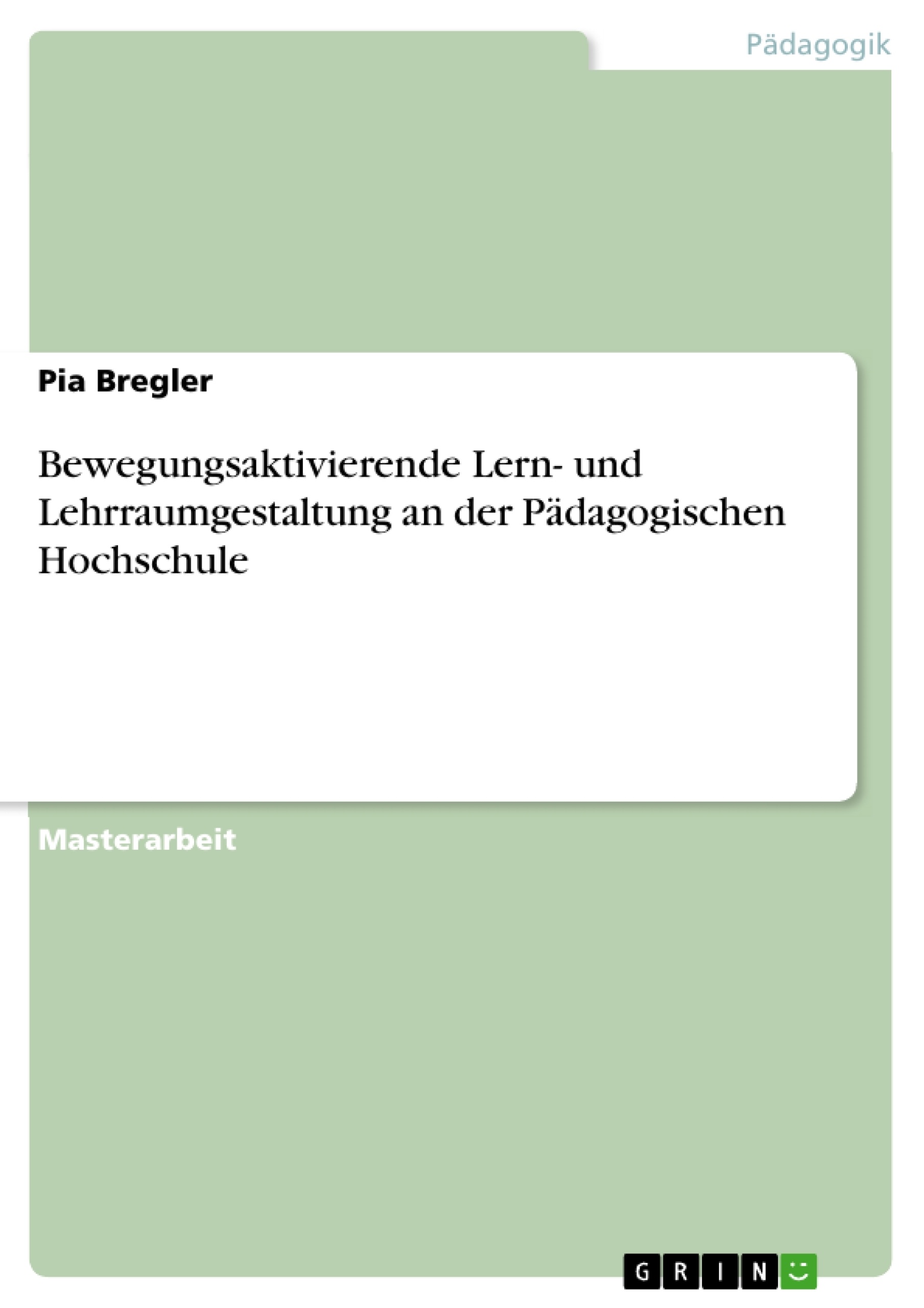Erziehung und Bildung finden immer innerhalb räumlicher Ensembles statt. So kommen täglich zahlreiche Lernende in Bildungseinrichtungen in dafür vorgesehenen Räumen zusammen. Deshalb ist das Wissen über den Einfluss von Räumen und der Raumgestaltung auf das Handeln von Menschen von zentraler Bedeutung - vor allem in Hinblick auf deren Bedingung und Beeinflussung von Bildungsprozessen.
Dem Thema Raum und der Wechselwirkung von Räumen auf Menschen wurde jedoch bisher in der Bildungswissenschaft eher wenig Beachtung geschenkt. So konstatiert der Erziehungswissenschaftler und Journalist Reinhard Kahl, dass der Raum bisher in seiner Bedeutung für die Bildung unterschätzt wurde. Gleichzeitig postuliert er, den Raum als "dritten Pädagogen" zu sehen. Schon der Begründer der Reggio-Pädagogik, Loris Magaluzzi erkannte, dass Lern- und Lebensräume den Lernenden die Möglichkeit bieten, auf der Grundlage von (selbst)gesetzten Zielen selbstorganisiert zu lernen und sich wohlzufühlen. Der "Raum" als dritter Pädagoge kann so neben den Erwachsenen oder Lehrkörpern und den Kindern oder Jugendlichen betrachtet werden.
Mit der Betrachtung von Raumgestaltungen in Bildungseinrichtungen wird schnell deutlich, dass eine Typologie des Lernraumes nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch in der Erwachsenenbildung vorherrscht. Dagegen wird eine Gestaltung nach individuellen Bedürfnissen sowohl im schulischen wie auch im hochschulischen Bereich oft vermisst und es wird eine eher normierte Umgebung für Schüler: innen in schulischen wie hochschulischen Lehr- und Lernräumen vorgefunden: standardgemäß ist vorne beispielsweise eine Tafel oder Leinwand vorzufinden, vor dieser Tische mit Stühlen, die weder höhenverstellbar, noch anders körperlich anpassbar wären. Dabei ist nicht nur in vielen Schulen eine standardisierte, normierte Lernraumgestaltung vorzufinden, auch in der Erwachsenbildung: Während sich unter dem Einfluss reformpädagogischer Perspektiven Anfang des 20. Jahrhunderts eher eine Öffnung von Raumkonzepten abzeichnete, kann nun von einer Schließung gesprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. THEORETISCHE HINFÜHRUNG
1.1. Gesellschaftliche Entwicklungen
1.2. Lehr- und Lernräume
1.2.1. Definition
1.2.2. Wechselwirkung Mensch und Raum
1.3. Lernen und Bewegung
1.3.1. Schäden durch Bewegungsmangel
1.3.2. Positive Auswirkungen von Bewegung
1.3.3. Bewegungsaktivierend(er)e Didaktik
1.4. Zwischenfazit theoretische Hinführung
2. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
2.1. Entwicklung der Forschungsfrage
2.1.1. Forschungsinteresse
2.1.2. Kriterien qualitativer Forschung
2.2. Forschungsdesign
2.2.1. Datenerhebung
2.2.2. Datenauswertung
2.3. Ergebnisdarstellung
2.3.1. Falldarstellung
2.3.2. Interpretative Auswertung
2.4. Reflexion und Limitation der Arbeit
2.5. Zwischenfazit Empirie
3. GESAMT-ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Literaturverzeichnis
ANHANG
Begriffs- und Abkürzungserklärungen
Ausführlich(er)e Falldarstellung
Transkriptionsregeln
Transkripte
Interview Luisa (w.)
Interview Lisa (w.)
Interview Anna (w.)
Interview Alex (m)
Interview Miena. (w.)
Interview Frau M
Interview Max (m.)
Arbeitsvorgänge in MAXQDA
Ausschnitt Mural Board SeminarLernräumegestalten
Selbstexperiment: Lernwanderin in Bewegung
Bildanhang
Vorwort
„Aber bitte, setzen Sie sich doch!“ Wer würde einer so höflichen Aufforderung mit „Nein, danke, ich möchte lieber stehen“ entgegentreten? Nicht viele nehme ich an. Die Möglichkeit sitzen zu können wurde ursprünglich und wird zu oft immer noch in unserer Gesellschaft als ein Luxus gesehen, der gerne angenommen wird. Wer kennt nicht die Streitigkeiten um einen Sitzplatz in einer überfüllten Bahn? Jene Sicht auf das Sitzen sollte sich ändern.
Denn: eine zu hohe tägliche Sitzzeit schädigt den inneren Organen, dem Bindegewebe, den Muskeln, dem Stoffwechsel und vielem mehr (siehe etwa Glöckl & Breithecker, 2018). Sitzen Sie denn gerade während Sie diese Arbeit lesen? Stehen Sie besser zwischendurch auf. Denn vielerlei Erkenntnisse zeigen, dass sich durch mehr Bewegung nicht nur besser konzentriert werden kann, sondern die Stimmung erhöht wird und der Muskelapparat sich freut (siehe Kapitel 1.3.2. dieser Arbeit). Diese Masterarbeit schreibend, stehe ich deshalb gerade an einem Stehtisch des Außenlernraumes an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, der neben einem „normalen“ Tisch steht und mir als Positionswechsel dient und überlege, wie ich bald meine nächste Bewegungspause angehe. Das Wissen, dass ich mir durch die Recherchen im Zuge dieser Arbeit aneignen durfte, hat mein Verhalten nachhaltig verändert. Wie genau, finden Sie unteranderem auch bei meinem beschriebenen Selbstexperiment als „Lernwanderin in Bewegung“ im Anhang.
Vordergründig möchte ich mit dieser Arbeit den theoretischen und wissenschaftlichen Hintergrund zu den Chancen und Grenzen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen liefern, den ich mir im Laufe der letzten Monate angeeignet habe. Außerdem werde ich im empirischen Teil dieser Arbeit Kommilitoninnen der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, wie eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus der Prävention und Gesundheitsförderung mit ihren Bedürfnissen und Erkenntnissen in den Fokus stellen.
Als Abschluss meines langen Studiums an der Pädagogischen Hochschule hat mir dieses Thema zwar durch das viele Schreiben doch auch mal Nackenschmerzen, aber vor allem auch sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe mit dieser Arbeit einen Anstoß zu mehr Aufmerksamkeit auf die Lehr- und Lernraumgestaltung in Hochschulen geben zu können und die zahlreichen implizierten Chancen einer bewegungsaktivierend(er)en (Um-)Gestaltung aufzuzeigen.
Ich danke recht herzlich Frau Isolde Rehm für die Unterstützung, den Entwicklern des Heidelberger Modells der Bewegten Lehre und allen weiteren Akteur:innen, die sich für ein be- wegungsaktivierend(er)es und gesünderes Studieren einsetzten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Pia Bregler,
Heidelberg 2022
Einleitung
Erziehung und Bildung finden immer innerhalb räumlicher Ensembles statt (Mein & Rieger- Ladich, 2004, S. 27). So kommen täglich zahlreiche Lernende in Bildungseinrichtungen in dafür vorgesehenen Räumen zusammen. Deshalb ist das Wissen über den Einfluss von Räumen und der Raumgestaltung auf das Handeln von Menschen von zentraler Bedeutung - vor allem in Hinblick auf deren Bedingung und Beeinflussung von Bildungsprozessen.
Dem Thema Raum und der Wechselwirkung von Räumen auf Menschen wurde jedoch bisher in der Bildungswissenschaft eher wenig Beachtung geschenkt. So konstatiert der Erziehungswissenschaftler und Journalist Reinhard Kahl (2009), dass der Raum bisher in seiner Bedeutung für die Bildung unterschätzt wurde. Gleichzeitig postuliert er, den Raum als „dritten Pädagogen“ zu sehen. Schon der Begründer der Reggio-Pädagogik, Loris Magaluzzi erkannte, dass Lern- und Lebensräume den Lernenden die Möglichkeit bieten, auf der Grundlage von (selbst)gesetzten Zielen selbstorganisiert zu lernen und sich wohlzufühlen (vgl. Koeritz et al. 2022, S.7). Der „Raum“ als dritter Pädagoge kann so- neben den Erwachsenen oder Lehrkörpern und den Kindern oder Jugendlichen betrachtet werden (ebd.).1
Mit der Betrachtung von Raumgestaltungen in Bildungseinrichtungen wird schnell deutlich, dass eine Typologie des Lernraumes nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch in der Erwachsenenbildung vorherrscht. Dagegen wird eine Gestaltung nach individuellen Bedürfnissen sowohl im schulischen wie auch im hochschulischen Bereich oft vermisst und es wird eine eher normierte Umgebung für Schüler: innen in schulischen wie hochschulischen Lehr- und Lernräumen vorgefunden: standardgemäß ist vorne beispielsweise eine Tafel oder Leinwand vorzufinden, vor dieser Tische mit Stühlen, die weder höhenverstellbar, noch anders körperlich anpassbar wären.2Dabei ist nicht nur in vielen Schulen eine standardisierte, normierte Lernraumgestaltung vorzufinden, auch in der Erwachsenbildung: Während sich unter dem Einfluss reformpädagogischer Perspektiven Anfang des 20. Jahrhunderts eher eine Öffnung von Raumkonzepten abzeichnete, kann nun von einer Schließung gesprochen werden: „Seminarräume in der Erwachsenenbildung sehen - bis auf Ausnahmen im Kreativ- oder Gesundheitsbereich - fast normiert aus“ (Bernhard et al., S. 22).
Dabei ist im Besonderen ein Faktor zentral: nämlich der der Raumgestaltung und des Einflusses auf die Gesundheit. Durch die mobiliare Anordnung und Ausstattung wird begünstigt, dass in vielen Bildungsinstitutionen ein akuter Bewegungsmangel durch exzessives Sitzen stattfindet. So herrscht Studien zufolge sowohl im schulischen wie im hochschulischen Kon- text herausgefunden worden, eine hohe Sitzzeit vor (siehe etwa Huber & Köppel, 2017 oder Rupp et al. 2020).
Bewegungsarmut in Bildungsinstitutionen, die oft täglich mindestens die Hälfte einer Tageszeit von Nutzer: innen aufgesucht werden, in Kombination mit einer durch die Digitalisierung und Technisierung verursachte und voranschreitende Bewegungsarmut verursacht gesundheitsschädliche Schäden. Nicht umsonst befassen sich viele Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperten,3mit den Folgen von physischer Inaktivität. Nach Prof. Dr. Elmar Wienecke (2017) muss sich unser Bewegungsverhalten dringend ändern, denn 53,8 Milliarden US Dollar direkte und indirekte Kosten durch Arbeitsausfälle verursachte die körperliche Inaktivität in etwa 142 Ländern (ebd., S. 14). Das Plädoyer „Das Sitzen ist das Rauchen der Gegenwart“, welches gegebenfalls gerne als flapsiger Spruch gesagt wird, hat dabei eine wissenschaftliche Grundlage, die durchaus sehr ernst zu nehmen ist. Darüber hinaus wurden bereits Zusammenhänge von Sitzzeiten und akademischen Leistungen festgestellt, Felez-Nobrega et al. 2018 fanden beispielweise heraus, dass eine Unterbrechung der Sitzzeit nach 10- 20 Minuten zu besseren akademischen Leistungen führt (S.5).
Da jedoch „konkrete Räume [...] vielmehrdurchdas Handeln von Menschen in sozialen Kontexten“ entstehen (Kraus et al. 2015, S. 12; Hervorhebung im Original) kann die Entwicklung und Durchführung von bewegungsaktivierend(er)en didaktischen Konzepten - gleich ob im schulischen, oder hochschulischen Kontext - dem entgegenwirken.
Dennoch kann behauptet werden, dass bewegungsaktivierende Didaktik oft nur eine Symptombekämpfung der Hauptursachen ist. So hat nämlich das typischerweise in Lernräumen anzufindende Mobiliar nicht gerade eine positive Auswirkung auf die aktuellen bewegungsarmen Entwicklungen. Wie bereits angesprochen, zieht sich in Bildungsinstitutionen eine Lernraumgestaltung mit Mobiliar durch, welches einem bewegungsarmen Aufforderungscharakter innewohnt (wie etwa zum Sitzen).4Die Wechselwirkung der Lernraumgestaltung und dem Einfluss des typisch vorzufindenden Mobiliars begünstigt eine bewegungsarme Didaktik. Stattdessen würde eine mobiliare Umgestaltung mit bewegungsaktivierende(re)m Mobiliar in Bildungsinstitutionen auch eine bewegungsaktivierende(re) Didaktik begünstigen und unterstützen.
Betrachtet man die Forschung wie auch vielerlei Projekte, zeichnet sich im schulischen Kontext bereits vermehrt ein Fokus auf die Wechselwirkung von Lernraum-Gestaltung und Lernen, die Effekte von Umstellungen auf Kabinett-Systeme, eine Umgestaltung der Räume nach raumpädagogischen Prinzipien - wie dem Resonanzmodell (vgl. Mehnert 2020) oder das Konzept der „bewegten Schule“ (siehe etwa Laging 2017) ab. Der hochschulische Kontext bleibt von jener Forschung bislang jedoch weitestgehend unberührt. Es besteht ein zu gering entwickelter wissenschaftlicher Diskurs zur bildungstheoretisch begründeten Gestaltung von Bildungshäusern (vgl. Ludwig 2012, S. 26) und besonders in der Erwachsenenbildung gibt es bezogen auf die Raumthematik deutlich einen Nachholbedarf. Diese Forschungslücke schließt Hochschulen mit ein. Besonders hier ist speziell der Zusammenhang der Lernraumgestaltung auf die Gesundheit bislang nicht ausreichend untersucht worden. Die Wichtigkeit dieser kann in Zeiten vorherrschender Bewegungsarmut dagegen nicht abgesprochen werden.
Es wird sich deshalb in dieser Arbeit der vorhandenen Forschungslücke angenommen, indem durch einen qualitativen Ansatz und der Befragung von Studierenden als Expert: innen und einer Mitarbeiterin im Bereich Gesundheitsförderung eine hochschulische Darlegung von Chancen und Grenzen einer bewegungsaktivierende(re)n Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen exemplarisch gezeigt wird. Die vorliegende Arbeit setzt sich dabei aus einem theoretischen und einem empirischen Teil zusammen:
Der theoretische Teil beginnt einleitend in Kapitel 1.1. mit einer Darlegung von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu einer Tendenz zu Bewegungsarmut.
In Kapitel 1.2. wird sich, mit dem Ziel zu der Erkenntnis zu gelangen inwiefern die Lehr- und Lernraumgestaltung Bewegungsarmut begünstigen oder verhindern kann, zuerst der Definition von Lehr- und Lernräumen gewidmet. Danach wird die wechselseitige Beeinflussung von Räumen und den sich dort aufhaltenden Menschen unter Einbezug verschiedener Wissenschaftsdisziplinen dargelegt.
Schließlich wird sich in Kapitel 1.3. der Thematik von Lernen und Bewegung angenommen. Es werden wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Schäden von Bewegungsmangel erläutert, so wie positive Auswirkungen von Bewegung.
Kapitel 1.3.3. ist bewegungsaktivierend(er)er Didaktik und damit zwei Ansätzen gewidmet, der Trennung von Bewegung und Lernen und einer Kombination von Bewegung und Lernen. Dabei werden bewegungsaktivierend(er)e Methoden und Didaktiken, für den schulischen und hochschulischen Kontext vorgestellt und darauf eingegangen, wie Lernräume anhand von Mobiliar und Ausstattung bewegungsaktivierend(er) gestaltet werden können. Als Abschluss dieses Kapitels wird das Heidelberger Modell der bewegten Lehre als Grundbasis für eine bewegt(er)e Lehre im Hochschulkontext eingeführt.
Anschließend wird ein erstes Zwischenfazit der theoretischen Hinführung vorgenommen.
Im empirischen Teil dieser Arbeit werden anhand der Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprozesses die Chancen und Grenzen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von Lehr- und Lernräumen im hochschulischen Kontext, exemplarisch anhand Student:innen und Absolvent:innen einer Pädagogischen Hochschule aufgezeigt. Dabei wird erörtert, inwiefern der demnach typische Aufbau von Lernräumen, sich mit den Bedürfnissen von Studierenden als Nutzer:innen deckt.
Für einen Nachvollzug der Entwicklung der Forschungsfrage werden dabei zuallererst in Kapitel 2.1. das zugrundeliegende Forschungsinteresse und die Kriterien qualitativer Forschung dargelegt. Das Forschungsdesign mit der genauen Art der Datenerhebung und Datenauswertung wird schließlich in Kapitel 2.2. beschrieben.
Darauffolgend kann der oder die Leserin in Kapitel 2.3. eine Ergebnisdarstellung in dem Sinne vorfinden, als dass eine Übersicht der Fälle vernommen wird, mit einer anschließenden interpretativen Auswertung der sich daraus ergebenen Chancen und Grenzen einer bewe- gungsaktivierend(er)en Lehr- und Lernraumgestaltung für Studierende. Es wird ein Zwischenfazit der Empirie vorgenommen, bevor es in die Reflexion und Limitation dieser Arbeit geht.
Zu guter Letzt wird mit einer Gesamtzusammenfassung von Theorie und Empirie, wie eines Gesamt-Fazits abgeschlossen.
Im Anhang finden sich neben Begriffs- und Abkürzungserklärungen, den Transkripten Transkriptionsregeln und einer ausführlicheren zusammenfassenden Falldarstellung, eine Dokumentation der Arbeitsvorgänge in MAXQDA einen kurzen Einblick in das Seminar „Lernräume gestalten“, wie den Bildanhang mit unteranderem bewegungsaktivierend(er)em Mobiliar.
1. THEORETISCHE HINFÜHRUNG
Um herauszustellen, warum eine Befassung mit einer bewegungsaktiverend(er)en Lehr- und Lernraumgestaltung relevant ist, ist zunächst eine theoretische Einordnung notwendig. In der theoretischen Hinführung dieser Arbeit wird deshalb eine theoretische Rahmung, als Grundlage für das Interesse einer empirischen Untersuchung, geliefert.
1.1. Gesellschaftliche Entwicklungen
Diverse gesellschaftliche Veränderungen, die in einer kurzen Zeit stattfanden, haben dazu beigetragen, dass sich im privaten wie Arbeits-Bereich immer weniger bewegt wird (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 65). Mangelnde physische Aktivität ist bei der Mehrheit der Bevölkerung in den meisten industrialisierten Ländern festzustellen, was weltweite Gesundheitsprobleme mit sich bringt (Ekkekakis, P., Parfitt, G. & Petruzzello, S. J., 2011, S. 641).
Ein Faktor, der die Bewegungsarmut hervorruft, ist neben der Weiterentwicklung der Technik, eine zunehmende Digitalisierung in beruflichen und privaten Bereichen. So fand innerhalb der letzten 20 Jahre eine rasende Entwicklung statt, die gleichzeitig weniger Aufwand für Nutzer:innen bedeutet. Das alltägliche Verhalten hat sich dabei verändert und immer bewegungsarmer werdende Handlungen schlagen sich nieder: Es ist immer weniger Bewegung nötig, um eine Aktion in Gang zu setzten. Oft reicht die kurze Benutzung der Finger für eine Ausführung auf einem Bildschirm. Für Einkäufe muss sich immer weniger aus dem Haus bewegt werden. Mittlerweile kann alles im Internet eingekauft werden, nicht nur Kleidung sondern sogar Lebensmittel und Essen aus dem Restaurant (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 64). Doch nicht nur das: Selbst die Partnersuche kann schon bequem von dem Sofa aus geschehen (vgl. ebd.), so muss man nur auf seinem Handy nach rechts oder links wischen, oder sich an den Computer setzen. Zudem werden auch im privaten Umfeld heutzutage viele Maschinen automatisch geregelt, sei es ein Saugroboter, oder ein SMART-Home. Wege werden vermehrt mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, wofür sich nicht mehr extra ein Ticket am Schalter gekauft werden muss - es kann alles bequem online gekauft werden. Das „Sich-Hin-Bewegen“ findet oft in einer bewegungsarmen, sedentären Position im Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln statt, selten durch eine längere Laufoder Fahrradstrecke (vgl. ebd.).5
Auch im Arbeitswesen wird sich vermehrt weniger bewegt. Nach Glöckl und Breithecker (2018) hat „[d]er Wissensarbeiter, der kommuniziert und koordiniert, [.] den körperlich arbeitenden Menschen im Berufsleben Großteils abgelöst.“ (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 51). Diese Bewegungsarmut wird in vielen Arbeitsbereichen etwa dadurch verursacht, das schwere körperliche Arbeiten immer mehr von Maschinen verrichtet werden. So sind in der Produktion immer mehr überwachende und steuernde Tätigkeiten gefragt und Bürotätigkeiten in einem immer größerem Umfang mit Bildschirmarbeit verbunden (vgl. Glöckl und Breihecker 2018, S. 50-51). In Büros muss nicht mehr zu Kolleg:innen gegangen werden, um etwas zu besprechen, alles kann digital ablaufen, was oftmals dazu führt, dass sich kaum vom Schreibtischstuhl bewegt wird. Schon vor der Pandemie minimierten sich in vielen Arbeitsbereichen persönliche Treffen und als schnellere und kostengünstigere6Alternative schlug sich die Kommunikation über Internet oder Mobiltelefon durch (ebd). Ein geringer Energiebedarf durch ständig abnehmende körperliche Belastung und ein Überangebot an Nahrungsmitteln führt schließlich dazu, dass ein großer Teil der Bevölkerung dem eigenen Körper regelmäßig mehr Energie zuführt, als dieser verbraucht (vgl. S. 35).7
Die Notwendigkeit sich zu bewegen, steckt jedoch immer noch in den Genen von Menschen. Das menschliche Genom verändert sich nur um etwa ein Prozent durch Mutation und natürliche Selektion, bedarf nämlich eines Zeitraums von ungefähr einer Million Jahre (Glöckl & Breithecker, 2018, Vorwort IX). Genetisch sind die Menschen immer noch auf dem Stand der Ausdauer-Jäger und Sammler, während sich die Umwelt aber verändert hat: Büroangestellte, Wissenschaftler:innen, Schüler:innen, Student:innen und viele mehr sitzen heutzutage viel an einem Schreibtisch, arbeiten am Computer, Laptop, Smartphone, Tablet, oder benutzen das Telefon sitzend.8Beispielsweise führten Huber und Köppel (2017) eine Analyse der Sitzzeiten von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 20 Jahren durch und kamen zu dem Ergebnis, dass die mittlere Sitzzeit der Kinder und Jugendlichen bei 10,58h (SD=2,68) pro Werk- und 7,52h (SD=2,20) pro Wochenendtag liegt und demnach 71% der Wachzeit an Werktagen bzw. 54% der Wachzeit an Wochenendtagen im Sitzen verbracht wird (S. 101). Dabei sind vor allem schulbezogene Sitzzeiten dominant. Außerdem zeigt eine Kontrastanalyse die proportional zur Klassenstufe angenommene, stetig monotone Entwicklung der Sitzzeiten durch die Klassenstufe (Huber & Köppel, 2017, S. 101). Ebenfalls wurde im hochschulischen Kontext von Rupp et al. (2020) festgestellt, dass sedentäres Studieren „ein der Norm entsprechendes und breit akzeptiertes Studieren“ zu sein scheint (VII).9
Der Bewegungsmangel scheint demnach nicht auch im Bildungssystem prominent zu sein.
Anbetracht dieser Erkenntnisse ist nicht verwunderlich, dass das „Sedentary Death Syndrome“, kurz „SeDS“ genannt, im Vormarsch ist. Damit wird das Krankheitsbild bzw. Phänomen der „Auswirkungen des exzessiven Sitzens“ bzw. die tödlichen Folgen von zu vielem Sitzen bezeichnet (vgl. S. 31).10Es handelt sich um ein durch den Lebensstil in industrialisierten Ländern geprägtes Syndrom (vgl. S. 35). Das SeDS wird als (mit)verantwortlich angesehen für zahlreiche Zivilisationskrankheiten11und für Millionen frühzeitiger Todesfälle pro Jahr, zusätzlich zu hohen Kosten des Gesundheitswesens (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 35). Mit der „Immobilitätsforschung“ hat sich dabei sogar ein neuer Forschungszweig entwickelt, wobei sich Forscher: innen mit den Auswirkungen des exzessiven Sitzens auf die Gesundheit unserer Gesellschaft beschäftigten (ebd., S. 31). Sie haben die vielfältigen negativen Folgen unter der Bezeichnung „Sedentary Death Syndrome“, kurz SeDS, zusammengefasst (ebd.).
Die heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen gleichzeitig, dass Möglichkeiten für mobiles und flexibles Lernen nicht nur an Wichtigkeit gewonnen haben, sondern auch gefordert werden. Die Entwicklung neuester Technik ermöglicht nicht nur eine zunehmende Flexibilität von Raum und Zeit, sie eröffnet auch Chancen zu mehr Mobilität und damit bewe- gungsaktivierende(re)m Arbeiten oder Lernen. Zusätzlich eröffnen sich durch bewegungsaktivierendes Mobiliar Chancen, mehr Bewegung in einen Arbeits-, Lern- oder Studieralltag zu bringen.
1.2. Lehr- und Lernräume
Da festgestellt wurde, dass aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu einer Hinterfragung eines konventionellen Lernraum-Begriffs rütteln, wird in diesem Kapitel näher auf die Definition von Lehr- und Lernräumen näher eingegangen und definiert, was im Rahmen dieser Arbeit darunter verstanden wird. Anschließend werden Perspektiven aus Soziologie, Architekturpsychologie und Pädagogik auf das Konzept des Raumes und die Wechselwirkung dessen mit Menschen vorgestellt. Dem anschließend wird auf die in der Wissenschaft häufig rekurrierte relationale Raumtheorie von Martina Löw (2001) eingegangen, welche in der Soziologie prominent zutage tritt - so ist ihre Definition des relationalen Raumbegriffs ist zu einer zentralen Referenzgröße im deutschsprachigen Diskurs geworden (Kraus et al. 2015., S. 13).
Im Anschluss wird eine architekturpsychologische Perspektive dargelegt. Der Wechselwirkung von Architektur und menschlichem Verhalten, widmet sich Antje Flade (2008) in ihrem Buch „Architektur - psychologisch betrachtet“ unter Mitarbeit von Friedrich Dieckmann und Richard Röhrbein, aus welchem einige Erkenntnisse zusammengetragen werden.
Schließlich wird die pädagogische Perspektive auf Lehr- und Lernräume untersucht. Hierbei wird unteranderem auf Lernraumgestaltungsmöglichkeiten wie Kabinettsysteme und eine pädagogische Architektur nach Holzbrecher (2012) eingegangen, die zwar auf den schulischen Kontext beschrieben wurden, aber auch auf den hochschulischen Bereich übertragen werden können.
1.2.1. Definition
Grob gefasst könnte gesagt werden, dass ein Lernraum ein Raum ist, in dem gelernt wird und ein Lehrraum ein Raum, in dem gelehrt wird. Allerdings sind die beiden Begrifflichkeiten nicht haarscharf voneinander zu trennen, kann man schließlich in vielen Räumen oder Orten an denen gelehrt wird auch lernen, oder lernt gleichzeitig während gelehrt wird.
In der Wissenschaft wurde sich dem Thema Raum im Zusammenhang und der Wechselwirkung mit Lernen sehr lange Zeit rudimentär gewidmet. Nach Kraus et al. (2015) hat sich die Erziehungswissenschaft erst seit den 1990er Jahren jener Thematik zugewandt (S. 11). Zu dieser Zeit entstand der „Spatial turn“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften, den Nuissl (2006) als eine Rückkehr und Neubewertung des Begriffs „Raum“ sieht (ebd., S. 29).
Was genau als Lernraum definiert wird kann perspektivisch unterschiedlich von einer „Begrenzung zwischen einem pädagogisch definierten Raum und einer Außenwelt“ (Kraus et al. 2015, S. 16) gesehen werden, wie auch weiter gefasst von Lernorten vom klassischen Schulungsraum, über Museen, Bibliotheken oder den Arbeitsplatz bis hin zum Waldlehrpfad und zu virtuellen Lernumgebungen (DIE, 2022). Otto Herz (2005) geht noch weiter und postuliert, dass Lernen nicht per se an bestimmte Räume gebunden ist, sondern überall gelernt werden kann (GEW 2007, S. 15, zit. nach Herz 2005).12
Lehrräume können etwa im hochschulischen Kontext als Arbeitsplätze und Lernorte für Studierende wie für Lehrende gesehen werden, in denen sie einen beträchtlichen Teil ihres Alltags verbringen (Rupp et al. 2020, S. 21).
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein fließender Übergang von einem Lehrraum zu einem Lehrraum gesehen, die Tatsache umfassend, dass es zahlreiche Räume gibt, in einem Gebäude, wie auch außerhalb, an denen gelernt und gelehrt werden kann.13Dazu zählen besonders bei dem Aspekt des Lernens auch von Lerner:innen eigens gewählte Orte zum Lernen außerhalb einer Institution, wie auch eher nicht typischerweise als Lernräume bezeichnete Räume wie Gemeinschaftsräume einer Mensa14und im Zusammenhang von Lernen und Lehren neben traditionellen Seminar-, und Vorlesungsräumen auch Außenlehr und -lernräume bei oder auf dem hochschulischen Campus.15
So wird in dieser Arbeit deshalb jeglicher Raum oder Ort, der auch außerhalb einer Hochschule genutzt wird, um zu lehren oder etwas zu lernen, in die Begriffe des Lehr- und Lernraums mit eingefasst.
1.2.2. Wechselwirkung Mensch und Raum
1.2.2.1. Architektur-Psychologische Perspektive
Es steht außer Frage, dass die Architektur eines Gebäudes großen Einfluss darauf hat, wie schulisches Lernen erlebt wird (vgl. GEW 2007, S. 15, zit. nach Herz 2005). Mit der der Architekturpsychologie, die das Erleben und Verhalten des Menschen in planvoll entworfenen und hergestellten Räumen zu definieren bemüht, können Erkenntnisse dazu beigetragen werden, wie optimale Umwelten entstehen und ungünstige Umweltbedingungen vermieden oder beseitigt werden und an deren Stelle etwas Besseres gesetzt werden kann (vgl. Flade, 2008, S. 13-14). Während die Architektur sich dabei der Kunst und Fertigkeit des „planvollen Entwurfs und Herstellens von den Menschen dienenden Räumlichkeiten“ widmet und Kunst im Zusammenhang mit Architektur für „eine ästhetisch ansprechende Gestaltung, Fertigkeit und Funktionalität“ steht, ist die Psychologie die Wissenschaft, die sich mit der „Erforschung des Erlebens und Verhaltens des Menschen befasst“ (vgl. S. 13).
Eine Kombination dieser beiden Stärken ist in der Architekturpsychologie vorzufinden, welche als Wissenschaft nach Manfred Sack (2008) erst vor gut vier Jahrzehnten entstand, als sich zum ersten Mal Architekten mit Psychologen berieten, nachdem sie „bemerkt hatten, dass sie beide, eine jede Profession auf ihre Weise, das Wohl von Menschen gleichermaßen im Sinn haben, [nämlich] ihre Lebensqualität“ (Manfred Sack in Flade 2008, S. 10). Die Ar- chitekturpsyhcologin Antje Flade (2008) hat sich unteranderem mit der Gestaltung von Bildungsinstitutionen befasst,16wobei zahlreiche psychologische Prozesse in Bezug auf gebaute Umwelten stattfinden (vgl. Flade, 2008, S. 86). Grundlegend ist dabei, dass günstige Umweltbedingungen die Voraussetzung für optimale Beziehungen und Ergebnisse sind (vgl. S. 85).17
Emotionen
Weiterhin spielen Emotionen in dem Sinne eine Rolle, als dass Individuen unteranderem mit emotionalen oder ästhetischen Reaktionen auf die gebaute Umwelt reagieren. Jede:r reagiert dabei anders, so unterscheiden sich für Individuen „[g]ebaute Umwelten im Hinblick auf ihre emotionalen Qualitäten, sie werden als schön und anregend oder auch als hässlich und monoton wahrgenommen“ (Flade, 2008, S. 86). Nämlich übertragen Menschen nicht nur Gefühle auf die Umwelt, die Umwelt löst auch Gefühle in Menschen aus (Flade, 2018, S. 77). Menschen bauen außerdem emotionale Bindungen zu Orten auf, die für sie wichtig sind. Diese können schließlich zu einem Teil ihrer Identität werden, was als „Orts-Bindung und OrtsIdentität“ bezeichnet werden kann (ebd., S.86).
Gebaute Umwelten können bei Menschen Gefühle auslösen und je nachdem wie eine Umgebung erlebt wird, werden Hinwendungs- oder Abwendungsreaktionen ausgelöst (vgl. Flade, 2008, S. 107). Dabei wird sich emotional günstige Umwelten, die als angenehm empfunden werden, zugewendet (Flade, 2008, S. 109). Außerdem werden gerne Umwelten mit dem richtigen Reizvolumen aufgesucht, also solche die weder zu erregend noch zu reizarm sind (ebd.). Von Umwelten, die als unangenehm und als zu erregend oder auch als zu monoton erlebt werden, wird sich dagegen eher abgewendet (ebd.). Folglich ist damit der weitere Handlungsverlauf absehbar, denn wenn sich eine Person erst einmal von einer Umwelt abgewendet hat, wird sie der betreffenden künftig kaum mehr Aufmerksamkeit schenken: „Die wahrgenommene oder erinnerte affektive Qualität eines Ortes“ hat einen längerfristigen Effekt auf das Verhalten, wie auf die Verweildauer und welche Tätigkeit dort ausgeführt wird (Flade, 2008, S. 109).
Umweltaneignung
Ein dem Menschen innewohnendes Bedürfnis, ist jenes nach „Umweltkontrolle und Umweltaneignung“ (Flade, 2008, S. 86). Flade (2008) beschreibt, dass der Mensch sich durch Umweltaneignung eine persönlich passende und für ihn bedeutsame Umwelt schafft (S. 86). Eine mögliche Aneignung von den sie umgebenden Umwelten spielt für Menschen eine zentrale Rolle. So wird etwa ein Haus derart gestaltet, dass es als „Zuhause“ gesehen wird, um sich zu verorten und damit zu identifizieren (vgl. Manfred Sack in Flade 2008, S. 9).
Elementar ist dafür jedoch, dass auch genügend Spielräume für Menschen vorhanden sind, damit sie Einfluss ausüben und sich die Umwelt aneignen können (vgl. ebd.). Ist dies nicht der Fall, kann es sein, dass sich von der Umwelt abgewandt wird. Umweltaneignung hängt zudem mit Umweltkontrolle eng zusammen (vgl. Flade, 2008, S. 136). Als Beispiel, kann jene eine Person in der Bahn haben, wenn sie ihren Sitzplatz mit Licht versorgen kann, indem sie einfach einen Schalter anknipst (ebd., S. 136).
Oft können Menschen sich ihre Umwelt allerdings nicht passend machen, oder deren Nutzung ist eingeschränkt (vgl. Flade, 2008, S.136). Beispiele hierfür können sein, dass in einem Museum bestimmte Dinge unberührbar und verrückbar bleiben, oder bestimmte Tische und Stühle nicht der eigenen Körpergröße entsprechend eingestellt werden können. Darüber hinaus können Gegenstände und Umwelten einen gewissen „Aufforderungscharakter“ haben (vgl. Flade, 2008, S. 62) und somit beeinflussen, wie die einen sich umgebende Umwelt angeeignet wird. So kann ein Stuhl zum Sitzen einladen oder ein Tisch dazu auffordern etwas darauf zu stellen oder zu legen (vgl. ebd.).
Individuelle Umweltwahrnehmung
Die Wahrnehmung einer Umwelt ist je Individuum unterschiedlich. Warum Menschen eine bestimmte Umwelt anders wahrnehmen als andere hat mit individuellen und innerpsychischen komplexen Vorgängen zu tun. Die Wahrnehmung beginnt Flade (2008) zufolge als sensorischer Prozess und setzt sich bei kognitiven Prozessen fort, bei denen während der Verarbeitung der Informationen aus der Umwelt auf das im Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissen zugegriffen wird (Flade, 2008, S. 87). Der Zusammenhang von kognitiven Prozessen und der Wahrnehmung bestimmter Umwelten ist dabei maßgebend, denn die Umweltwahrnehmung ist sehr stark an Gedächtnisprozesse gebunden (ebd., S.87). Die räumliche Kognition, als das Erkennen räumlicher Relationen und Strukturen, spielt zusätzlich eine erhebliche Rolle (ebd.).
Architektonische Planung und Entwürfe
Bezüglich der architektonischen Entwürfe von Gebäuden, kann zwischen formalistischen und nutzer:innen-orientierten Entwürfen unterschieden werden.
Bei formalistischen Entwürfen steht primär der künstlerische Aspekt im Fokus. Menschen sind dann meist keine aktiven Nutzer:innen sondern eher Bewunderer:innen (vgl. ebd. S. 28). Bei nutzerorientierten Entwürfen steht die Frage im Vordergrund, welchen Zwecken die gebaute Umwelt dient und ob diese zu den intendierten Funktionen und der geplanten Nutzung passt (ebd., S. 29). Nach Flade (2008) sind bei einem gelungenen Bauwerk Ästhetik und Funktionalität im Einklang (S. 27). Wenn die Nutzbarkeit zu wenig beachtet wird oder der Schönheit eines Bauwerks vernachlässigt wird, kann dagegen ein Missklang entstehen (vgl. ebd. S. 27).
Jedoch ist es auch für Architekten nicht immer einfach, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. So beschreibt Flade (2008): „Bevor ein Architekt mit der Planung eines Bauwerks beginnen kann, muss er in Gesprächen und Verhandlungen mit dem Bauherrn möglichst viel über die zu bauende Umwelt in Erfahrung bringen und sich mit ihm über dessen Zwecke, den passenden Gebäudetyp, die funktionalen Anforderungen an das Bauwerk, die Art und Anzahl der Räume, den Kostenrahmen, das Baugrundstück usw. verständigen“ (Flade, 2008, S. 33). Eine weitere Hürde ist dabei, dass Architekt:innen nicht immer die Möglichkeit bekommen, mit allen Akteur:innen in Dialog treten zu können. So wird derweilen auch erlebt, dass sie bei Einblicken in die Entscheidungsfindung der Hochbauämter von Landkreisen und Städten im Bereich Bau von öffentlichen und privaten Schulen „[w]eder Lehrerkollegium noch Schulleitung und Elternbeirat, schon gar nicht die Schülerschaft [.] dabei mit einbezogen w[u]rden“, sondern als Architekt sogar die Kontaktaufnahme zur Schulleitung und zu Fachlehrern untersagt wurde (Tischer 2007, S. 17). Der Kölner Architekten Roland Dorn berichtet ebenfalls davon, dass Architektur und Pädagogik viel zu selten miteinander vereint werden (Lüke, 2007, S. 7).18
1.2.2.2. Soziologische Perspektive
Auch in der Soziologie wird sich seit einigen Jahren wieder mit der Raumthematik befasst (vgl. Löw & Sturm, 2016, S. 2). Doch dem war nicht immer so: über viele Jahrzehnte hinweg gab es nur wenige Ausarbeitungen, die explizit räumliche Strukturen und Prozesse zum Ge- genstand der Analyse machten (ebd.).19Lange Zeit wurden Räume hauptsächlich als materielle Objekte begriffen und viele soziologische Projekte schenkten der Thematik von Räumen nicht weiter Beachtung oder schrieben ihr gar eine Wichtigkeit zu (vgl. Löw 2001, S. 9). Schließlich wurde jedoch immer mehr gefordert, eine „erneute Betrachung von Raumphänomenen mit einer Theoriediskussion um den Raumbegriff zu verbinden“ (ebd., S. 11).
Um die angesprochenen Wechselwirkungen des Sozialen mit dem Räumlichen genauer zu untersuchen, forschte Martina Löw (2001) und entwarf den „relationalen Raumbegriff“, welcher auf „das Verhältnis von Struktur und Handlung“ hinweist und damit den deutschsprachigen Diskurs prägte (vgl. Kraus et. al 2015, S. 13). Löw‘s Konzept des relationalen Raumes entstand durch „das Schaffen einer Verbindung diverser Theorien und Positionen zu Raum, wie etwa von Bourdieu, Foucault, Giddens und Simmel, wodurch eine Raum-Definition entstand, die nicht nur materielle Gegebenheiten, sondern auch subjektive Leistungen in der Beschaffenheit und Gestaltung von Raum miteinbezieht“ (S. 13). Martina Löw (2001) untersucht in ihrer Publikation über „Raumsoziologie“, wie Raum als Grundbegriff der Soziologie präzisiert werden kann, um aufbauend auf dieser Begriffsbildung eine Raumsoziologie zu formulieren (S.12). Denn: zumindest in der Soziologie kann nicht auf den „Begriff des Raums“ verzichtet werden, da mit ihm „die Organisation des Nebeneinanders“ aufgezeigt wird (ebd.). Normativ besetzte Einheitlichkeitskonstruktionen werden dabei hinterfragt. Löw (2001) verwendet den Terminus Raum dagegen als eine „begriffliche Abstraktion, die den Konstitutionsprozeß [sic!] benennt“ (S. 131). Sie wendet sich gegen eine Vorstellung, dass es sich bei „Raum“ und „Handeln“ um zwei verschiedene Realitäten handelt und stellt die Arbeitshypothese auf, dass Raum eine relative Ordnung oder Anordnung deutlich macht (vgl. S. 131), anknüpfend an relativistischen Raumvorstellungen. Damit sind jene Raumvorstellungen gemeint, dass Raum als eine „relationale (An)Ordnung von Körpern“ verstanden wird, welche unaufhörlich in Bewegung sind (ebd., S. 131). Dies führt dazu, dass sich die (An)Ordnung selbst ständig verändert (ebd.). Demnach kann festgehalten werden, dass der Raum hier als Raum im Handlungsbedarf integriert zu bertrachten ist und als ein dynamisches Gebilde gefasst wird (vgl. S. 13).
Wechselwirkung Handlungen und Räume
Löw (2001) analysierte die räumlichen Dimensionen sozialer Prozesse, die Konstitutionen von Räumen und deren gesellschaftliche Veränderungen und entwarf einen theoretischen Ansatz, in welchem die Konstitution von Raum in den Prozess des Handelns direkt eingebunden ist (S. 132). Bei der Bildung von Räumen wird demnach eine bestimmte Konstruktionsleistung vorgenommen und Raum existiert abhängig von sozialen und materiellen Verhältnissen (ebd., vgl. S. 131). Räumen wohnt dabei nicht nur eine Ordnungsdimension inne, die auf gesellschaftliche Strukturen verweist, sondern auch eine Handlungsdimension, also ein Prozess des Anordnens (ebd., S. 131). Hierbei braucht die Mikrosoziologie den Raumbegriff um solche Gebilde benennen zu können, die sich durch „die Verknüpfung verschiedener sozialer Güter bzw. Menschen herausbilden und die als solche Handeln strukturieren“ (Löw, 2001, S. 12). Zudem kann die Makrosoziologie mit dem Raumbegriff relationale Verknüpfungen begrifflich erfassen, die aufgrund technologischer Vernetzungen oder städtischer Umstrukturierungen entstehen und Lebensbedingungen prägen (ebd. S. 12). Für Löw (2001) kann dabei jedoch nicht unbedarft auf bereits bestehende Raumbegriffe zurückgegriffen werden, es können vielmehr Ansatzpunkte genutzt werden (ebd.).
Dabei wirken verschiedenen Faktoren wie räumliche Strukturen, Handeln, Symbolik und die theoretischen Vorstellung, wie Räume entstehen und reproduziert werden zusammen (vgl. ebd. S.13). Wenn jedoch ein Raum oder Ort als bereits bekannt vorausgesetzt wird, bleiben die einzelnen Aspekte des komplexen sozialen Prozesses, in dessen Folge Räume entstehen oder reproduziert werden unerkannt (vgl. Löw, 2021, S. 13). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei der Infrage-Stellung bekannter Normen und Muster einzelne Aspekte dieser komplexe soziale Prozesse bewusst gemacht werden können.
Geht man von einer absolutistischen Raumkonzeption aus, wird der Raum als starre Folie gesehen auf und vor der sich bewegtes Handeln abspielt (S. 130) und es wir der Raum gesehen,_in dem die Körper sind (S.18). Aus einer anderen, relativistischen Perspektive hinaus betrachtet, stellt die Entstehung von Räumen selbst „ein Moment sozialer Prozesse“ dar (S. 130) und der Raum wird aus der Anordnung der Körper abgeleitet:
„Da sich diese Körper (Handlungen) immer in Bewegung befinden, sind auch die Räume in einen permanenten Veränderungsprozeß eingebunden. Räume exisiteren demnach nicht unabhängig von den Körpern. Während im absolutistischen Denken Räume die unbewegte und für alle gleichermaßen existente (deshalb homogene) Grundlage des Handelns sind, geht im relativistischen Denken die Aktivität des Handelns unmittelbar mit der Produktion von Räumen einher“(Löw, 2001, S. 18).
Weiter untersuchte Martina Löw (2001) wie alltägliches, routiniertes Handeln und Raumgestaltung zusammenhängen. Nach Löw (2001) handeln Menschen repetitiv und haben eine Reihe von gewohnheitsbedingten Handlungen entwickelt, die ihnen dabei helfen, ihren Alltag zu gestalten (Löw, 2001, S. 161). Bezug auf Gidden's Erkenntnissen nehmend, sieht auch Löw (2001), dass „in der gewohnheitsmäßigen Wiederholung alltäglichen Handelns [.] die gesellschaftlichen Strukturen rekursiv reproduziert [werden].“ (Löw, 2001, S. 163). Das alltägliche, menschliche Handeln ist oft in hohem Maße repetitiv und so werden auch Räume in Routinen immer wieder auf die gleiche Weise hergestellt (Löw, 2001, S. 166). Diese Routinen werden oft von Kind an gelernt (ebd. S. 166).
Räume und gesellschaftliche Strukturen
Das Bestehen von gesellschaftlichen Institutionen hängt im hohen Maße mit der Reproduktion von alltäglichem Handeln zusammen (vgl. S. 166). Gründe dafür sind unteranderem, dass die „Konstitution von Raum im Handeln in Wechselwirkung zu gesellschaftlichen Strukturen“ steht und nicht völlig frei von Handeln betrachtet werden können (ebd. S. 166). Daneben kön- nen Strukturen nicht nur Handeln möglich machen, sondern es auch verhindern (ebd., S. 166).20
Das Räumliche ist nicht schwer gegen das Gesellschaftliche abzugrenzen, eher stellt es eine spezifische Form dessen dar (S. 167). Damit zusammenhängend besteht eine wechselhafte Beziehung zwischen räumlichen Strukturen und Handeln:
„Räumliche Strukturenmüssen, wie jede Form von Strukturen, im Handelnverwirklicht werden, strukturieren aber auch das Handeln. DieDualität von Handeln und Struktur stellt sich damit auch als dieDualität von Raum heraus. Das bedeutet,daß [sic!]räumliche Strukturen eine Form von Handeln hervorbringen, welches in der Konstitution vonRäumen eben jeneräumlichen Strukturen reproduziert.“(Löw, 2001, S. 172; Hervorhebung im Original).
Denn: Räume existieren nicht einfach nur, sondern werden durch, in der Regel repetitives, Handeln geschaffen und räumliche Strukturen, die eingelagert in Institutionen vorzufinden sind, steuern in gewisser Weise auch Handeln steuern (Löw, 2001, S. 172). Daran anschließend sichern institutionalisierte Räume auf eine gewisse Weise die geregelte Kooperation zwischen Menschen (Löw, 2001, S. 172).21
Dies wird deutlicher, wenn sich bewusst gemacht wird, welche typisierende Vorstellung von Räumen - oft unbewusst - Institutionen innewohnen: „Stellt man sich spontan einen Raum vor, so denkt man häufig an Türen, Wände, Fenster, Regale, Tische etc., aus deren (An)Ordnung Räume entstehen“ (Löw, 2001, S. 153). Zudem beeinflusst das Vorhandensein und die Anordnung von bestimmtem Mobiliar in einem Raum auch, wie Menschen sich in einem Raum verhalten oder wie sie ihn wahrnehmen. Ein Mensch kann etwa durch die Anordnung von Stühlen an der Wand und der eventuellen Bereitstellung von Zeitschriften in einer Arztpraxis annehmen, dass es sich um einen Warteraum handeln muss und wird sich dementsprechend verhalten, wie etwa sich zu setzten und zu warten. Löw (2001) beschreibt noch als weiteres Beispiel, aber dass auch die Anordnung von Menschengruppen entscheidend ist.
Doch können auch Menschen in die Konstitution von Räumen integriert werden. Mobiliar wird etwa erst durch die Nutzung von Menschen sinnhaft, wie allerdings auch die bestimmte Anordnung von Mobiliar Menschen beeinflussen kann, bestimmte Handlungen vorzunehmen. Stelle man sich etwa,22eine Diskothek ohne Menschen vor, wäre es lediglich ein Raum mit einer Anlage, Lichtmaschine einer Bar etc., aber er hat erst seine volle Zweckmäßigkeit erfüllt, wenn sich Menschen darin befinden, die tanzen, sich begegnen und eventuell die Bar nutzen. Die Menschen sind also an der Konstitution des Raumes beteiligt, wenn nicht mit ihrem Handeln in dem Raum sogar elementar und maßgebend. Wie sich Menschen in einem Raum gruppieren, wird einerseits auch durch die Beschaffenheit und Ausstattung des Raumes beeinflusst. Ein Neuankömmling in einem Raum, indem sich Menschen schon positioniert haben, wird andererseits dadurch beeinflusst, wie sich Menschen bereits angeordnet haben.23Es wird deutlich, wie Menschen zwar durch bestehende Konstitution von Räumen beeinflusst werden, aber auch durch ihr Handeln wiederum die Konstitution beeinflussen. Räume werden nicht nur unter Einbeziehung von anwesenden Menschen gestaltet, angeordnet und oder geschaffen, sondern können auch „Elemente dessen sein [...] was zu Räumen zusammengefaßt [sic!] wird.“ (ebd., S. 155). Denn: „Menschen werden zum einen durch Handlungen anderer Menschen positioniert, zum anderenpositionierensie sich aktiv“ (Löw, 2001, S. 154; Hervorhebung im Original).24Eine normative Konstruktion von Raum und Sicht auf Raum als etwas, das einheitlich oder ganz zu sein hat, verhindert dagegen, einen Veränderungsprozess mit allen Chancen sehen zu können (vgl. Löw, 2001, S.130 -131).
1.2.2.3. Pädagogische Perspektive
Nachdem bisher architekturpsychologische und soziologische Perspektiven beleuchtet wurden, erscheint darauf aufbauend die pädagogische Perspektive für die vorliegende Arbeit zentral. In diesem Kapitel wird demnach die Bedeutung der Wechselwirkung und des Einflusses von Architektur und Raumgestaltung auf pädagogische Möglichkeiten beleuchtet.
Wechselwirkung Architektur und Pädagogik
Pädagogisches Denken und schulische Sozialisation basieren nicht nur stark auf räumlichen Vorstellungen (Priem, 2004, S. 39), Pädagogik und Architektur können sich gegenseitig bedingen (vgl. Schratz, 2007). So beeinflusst die Raumbeschaffenheit, welche Didaktik überhaupt von Lehrenden angewandt werden kann. Ein zu kleiner Klassenraum kann unweigerlich dazu führen, dass nur frontal unterrichtet werden kann. Im Kontrast können, wenn die Raumgestaltung es zu lässt, Schüler: innen in Klassenzimmern für ihre unterschiedlichen Bedürfnisse einen Platz finden. „Träumen und Toben, einzelnes und gemeinsames Lernen, Möglichkeiten, Musik und Theater zu machen, Räume zum Üben und Experimentieren und immer wieder Orte zum Lesen, Sprechen, Schreiben. [.]“ beschreibt Schratz (2007) etwa Räume der preisgekrönten GrundschuleKleine Kielstraßein Dortmund, wo auch Lernen in Kombination mit Bewegung stattfindet, wenn die Kinder „ganz nebenbei“ beim Treppensteigen lernen Zahlen zu lesen, „aufwärts, abwärts und zu überspringen“ und sogar Flure Lernumgebungen sind, da die Herkunftsländer der Familien in einer gemalten Weltkarte an den Wänden markiert sind und auf den Gängen deshalb regelmäßig „Flurlesen“ durch Lehrkräfte stattfindet (vgl. ebd. S.16).
Nach Schratz (2007) wird deutlich, dass wenn Architektur wirksam sein soll, diese auch die physischen, emotionalen und spirituellen Bedürfnisse miteinschließen sollte - gerade in Bildungseinrichtungen (ebd. S.16). Nach Hildebrandt-Stramann et. al. (2017) beruht Bildung auf Lernen, weshalb zu den pädagogischen Grundlagen einer Schule auch ein Konzept des Lernens gehört, das sich, wenn die Bildungsziele erreicht werden sollen, an den Kriterien der Individualität, Mündigkeit und Sozialität orientieren sollte (S. 8). Dies kann nur erreicht werden, wenn auch bei der Lernraumgestaltung auf individuelle Bedürfnisse der Lernenden eingegangen wird.
Dies ist besonders wichtig, wenn betrachtet wird, wieviel Zeit in Lernräumen verbracht wird. Die meisten Schüler:innen sind einen Großteil ihrer täglichen Zeit in Schulräumen (Albers, 2020, S. 6). In Schulen, in denen eine „Pädagogische Architektur“ verwirklicht wird, kommt es, wie die Begrifflichkeit bereits vorausdeutet, zu einer engen Zusammenarbeit von Pädagogik und Architektur (Holzbrecher 2012; Montag-Stiftungen). Einzelne Räume und deren Gestaltung sowie das Raumensemble geben dabei das pädagogische Profil einer Institution wieder (ebd.). Räume können inszenierbar sein und in Übereinstimmung von bestimmten pädagogischen Notwendigkeiten bespielt werden (ebd.). Überschaubare Lerngemeinschaften können dabei durch Architektur gesichert werden. Dazugehörig wird eine bauliche Form verstanden, welche ihre Organisation und gestalterische Kraft aus einer pädagogischen Konzeption heraus entwickelt.
Wechselwirkung Raumgestaltung und Didaktik
Wenn institutionelle Lernorte hauptsächlich als Lehr- und Lernräume gesehen werden, kann eine Problematik entstehen, da diese oft durch ihre Gestaltung vorgeben, wie dort gelehrt und gelernt wird (vgl. DIE, 2022). Räume müssen außerdem, wie von der wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hamburger Schulinspektion am Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung Dr. Andrea Albers (2020) beschrieben, über den Tag verteilt unterschiedlichen Ansprüchen, wie verschiedenen Bedürfnissen von Lernenden an Räumlichkeiten gerecht werden (ebd.). Manche Nutzer:innen wollen sich etwa bewegen oder brauchen Orte zur Ruhe und Entspannung, andere lernen eher in Gruppen und wollen sich eher austauschen (vgl. ebd). Zusätzlich sollten Raumstrukturen Phasen, in denen alle gemeinsam arbeiten, aber auch und Phasen, in denen alleine oder in Kleingruppen gearbeitet wird, wenn möglich unterstützen können (vgl. ebd.). Im besten Falle besteht ein ausbalanciertes Verhältnis von Bedürfnissen der Lernenden und den Räumlichkeiten (vgl. ebd.).
Für verschiedene angestrebte Sozialformen kann es also unterschiedliche räumliche Konsequenzen geben (vgl. Holzbrecher, 2012). Wenn es wechselnde soziale Lernformationen geben soll, wie etwa, dass alleine, aber auch zu zweit und in verschiedenen Gruppengrößen gelernt werden kann, braucht es z.B. teiloffene Räume und oder Nischen (vgl. Holzbrecher, 2012.). Die Gestaltung von Räumen hängt dabei in starkem Maße mit dem Verständnis von Lernen zusammen.
Wird Lernen etwa als lediglich kognitive Vermittlung durch den Lehrer verstanden, kann die räumliche Konsequenz auch eine Optimierung von Instruktionsräumen sein (vgl. Holzbrecher 2012) und daraus resultieren, dass lediglich gelehrt wird, wobei eventuell das Umwenden des 21
Oberkörpers und das Verlassen der vorgesehenen Aufmerksamkeitsrichtung nicht erwünscht ist und mit der Einnahme der Sitzplätze auch eine körperliche Stillstellung erfolgt (vgl. (Brei- denstein, 2004). Wird jedoch ein Verständnis von Lernen vorausgesetzt als „aktive selbstständige Aneignung mit allen Sinnen“, bei welchem auch die Bewegung, das Verweilen, wie spielerisches eine Rolle spielen, ist die Konsequenz eine räumliche Gestaltung, die dies auch zu lässt (vgl. Holzbrecher, 2012).25
Unterschiedliche Gestaltungen können Möglichkeiten bieten, wie im schulischen Kontext schon an vielerlei Orten erprobt wurde: Frank Mehnert, der als Koordinator für Raumpädagogik am Walddörfer Gymnasium in Hamburg arbeitet und seine Kolleg:innen haben sich beispielsweise entschieden, das Kabinettsystem einzuführen. Dabei besuchen Schüler: innen die Lehrer:innen als Gastgeber: innen in ihrem jeweiligen Fachraum, welcher entsprechend der fachlichen Ansprüche eingerichtet ist (Albers, 2020, S. 6-7). Für die Gestaltung nutzt das Kollegium ein selbst entwickeltes Modell für resonante Lernräume, welches hilft die komplexe Wechselbeziehung zwischen Raumgestaltung und dem Lernen der Schüler: innen im Fachunterricht zu analysieren. In der Praxis entstehen nach dieser Klärung vielfältige, jeweils einzigartige Lernräume, die zu den Bedürfnissen der Lerngruppe, zum Unterrichtsstil der Lehrperson und zum Lerninhalt passen (Albers, 2020, S. 6).
Das Kabinettsystem führt auch dazu, dass die Bewegung zwischen den Stunden dem Lernen zugutekommt, da die Schüler: innen einen Raumwechsel nach jedem Fach vornehmen müssen. Zusätzlich führt dies zu einem bewussten Umschalten und zu nachhaltigeren Verknüpfungen im Gehirn, weil das Erlernte im neuen Raum mit spezifischen Bildern und Emotionen abgespeichert wird (S.12).
Die Umstellung auf Kabinette macht allerdings noch keine lernförderlichen Räume aus. Viel zentraler ist die Umgestaltung der Räume nach raumpädagogischen Prinzipien, etwa nach einem Resonanzmodell, meint Frank Mehnert (2020):
„Füreine schulweiteQualitätsentwicklung ist das Resonanzmodell deshalb hilfreich, weil sich aus ihm Standards guterLernräume ableiten lassen, die nicht mehrbloß Fragen desGeschmacks thematisieren, sondern die didaktische Bedeutung von Raumentscheidungenfür den eigenen Unterricht in den Mittelpunkt stellen.(S. 9)
Um zu einem resonanten Lernraum zu gelangen, hat sich nach Mehnert (2020) ein Vorgehen mit fünf Schritten bewährt. Zuerst sollte jedoch gedanklich komplett der eigene Lernraum geleert werden und alles Bisherige rausgeschmissen, selbst die Tafel (Mehnert, 2020, S. 11). Als erstes wird sich dann dasMotto des Raumesüberlegt, also wie das didaktische Leitmotiv des Raumes sein soll, worum es im Kern des Unterrichts gehen soll (ebd.).26
Als zweiter Schritt wirdder Arbeitsplatz der Lehrpersonins Auge gefasst und dabei beispielsweise Steuerimpulse der Lehrperson, also wo zum Beispiel der Arbeitsplatz verortet wird.27Weiter wird sich etwa überlegt, was für ein Schreibtisch genutzt werden soll (ebd.). Als dritter Schritt werden dieBildungsimpulse fokussiert,was bedeutet, dass bewusst noch bei den Steuerimpulsen des Lehrkörpers verweilt wird und sich nach Bildungsimpulsen gefragt wird, wie zum Beispiel was bezogen auf die eigenen Fächer signifikant ist, was unbedingt im Raum repräsentiert werden soll. Nach Mehnert (2020) kam durch Nachfragen heraus, dass viele Kolleg:innen sehr klare Vorstellungen davon haben, was sie gerne in ihrem Raum hätten: „heimliche Traume kommen da zum Vorschein: eine Bühne für szenisches Spiel im Deutschunterricht. Ein Flügel oder zur Not auch ein Klavier, um morgens mit einem Chanson beginnen zu können“ (ebd., S. ll).
Als viertes sind dieSchülerarbeitsplatzean der Reihe, wobei sich zum Beispiel überlegt wird, wo präsentiert wird, oder wo Materialien aufbewahrt werden, wo die Arbeitsplatze für die Schüler: innen eingerichtet werden, oder in welcher Sitzordnung gearbeitet werden soll. So wirkt etwa größer, wenn die Mitte freigehalten wird (vgl. ebd., S. 11-13). Im letzten, fünften Schritt wird sich um dieLernatmosphäregekümmert, was etwa beinhaltet, es sich mit der Balance im Raum verhält und wo das Zentrum liegt. Dabei geht es auch darum, wo eventuell ein Teppich helfen kann, wo Zonen zu markieren sind oder welcher Stil zu dem Raum und den Farben passt. So kann ein individueller Hingucker im Raum sein, bestimmtes Mobiliar wie ein Ohrensessel gewählt werden, oder ein prächtiger Teppich (ebd., S. 13)
Bezüglich der Finanzierung wurden laut Mehnert (2020) gute Erfahrungen mit antiken Möbeln gemacht, die qualitativ hochwertig sind, nachhaltig und günstig, für die Quittierung derer auch Unterstützung durch den Schulverein, ebenfalls des allgemeinen Einbindens der Eltern (vgl. ebd.). Sind Schüler:innen mit in die Gestaltung involviert,28zeigte sich außerdem, dass sie diese mehr wertschätzen (vgl. ebd., S. 13). Damit bestätigen sich Erkenntnisse aus der Architekturpsychologie, dass wenn das menschliche Bedürfnis nach Umweltaneignung erfüllt ist, eine Identifikation mit dieser und deshalb positiveren, emotionalen Bezug geschehen kann (vgl. Flade 2008).
Ein weiteres Beispiel ist die von dem Architekten Dorn gestaltete Schule: unteranderem werden an den Klassenraum grenzende separate, gut einsehbare Zimmer, für gemeinsame Aktivitäten wie Mahlzeiten, auch zur Entspannung von Konfliktsituationen, wie sogar Rückzugsort für individuelle Pausen genutzt (vgl. Lüke 2007, S. 7). Hier wird sichtbar, wie durch Architektur emotionaler Rückhalt, das Gefühl von Verbindlichkeit und Respekt „durch unterschiedlichste architektonische ,Hilfsmittel‘ [wie] [...] Ordnung und Übersichtlichkeit [durch Garderoben, Einbauschränke und Sideboards]“ geschaffen werden können (ebd.). Letzteres hat zudem den positiven Nebeneffekt, dass Eigentumskonflikte vermieden werden, da alle Schüler: innen ein persönliches Schließfach erhalten, für das sie verantwortlich sind (ebd.).
Ebenfalls sich einsetzend für eine neue Lernkultur in der Schüler:innen sich selbststandig entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse mit Lerninhalten auseinandersetzen können, entschieden Patrik Gerecke und Silke Henningsen mit ihrem Kollegium für eine neue Raumge- staltung Tafeln abzuschrauben, neue Tisch- und Stuhlanordnungen anzuschaffen und offene Regale mit Lernmaterialien zu systematisieren (2020, S. 6-7).
Dr. Alfred Holzbrechers (2012) Ansicht nach, der sich als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Freiburg ebenfalls der Thematik widmete, haben Räume in jedem Fall Wirkungen, wenn nicht sogar Auswirkungen (ebd. 2012). Wichtig ist auch die Beziehung zur Umgebung, welche stark durch räumliche Gestaltung beeinflusst werden kann. Wenn eine Bildungsinstitution als „Eigenwelt“ geschaffen wird und die Grenzen nach außen deutlich sind, sich dagegen nach innen orientiert wird (vgl. Holzbrecher 2012), hat das oft zur Folge, dass die natürliche Lebenswelt nicht genügend in das Lernen miteingebunden wird und an lebensnaher und authentischer Lernumgebung eingebüßt wird. Als Gegenmodell dazu beschreibt Holzbrecher (2012) eine „Öffnung“ zur Umgebung, welche sich dadurch äußert, dass zentrale Funktionen in den Randbereich verlagert werden, die eine gemeinsame Nutzung zulassen, wie Aula, Bibliothek, Werkstätten, Sportanlagen, Mensen etc. Dabei kann die Pädagogik sich die Räume in und mit denen sie arbeitet zu eigen machen (vgl. Holzbrecher 2012; MontagStiftungen). Licht und Farbe spielen etwa eine wichtige Rolle bei der Gestaltung, nebst Akustik, Luft und Raumklima (vgl. Holzbrecher 2012; Montag-Stiftungen). Die Räume haben dabei eine eigene Identität und Individualität, wie auch ein Ambiente, welches umhüllt, aber gleichzeitig frei lässt (vgl. Holzbrecher 2012; Montag-Stiftungen).
Erkenntnisse Erwachsenenbildung
Der Raum wird auch in der philosophischen und erziehungswissenschaftlichen Diskussion überwiegend mit einer Doppeleigenschaft wahrgenommen (Ludwig, 2012, S. 26)29und in dem Zuge Bildungshäuser als „sozio-technische Gebilde“ (ebd.), wobei die Architektur als gesellschaftliches Subsystem dem Menschen ein raumbildendes Sinnangebot bereitstellt, welches nicht nur Zwecken (z.B. Wohnen, Lernen, Arbeiten usw.), sondern zugleich auch Ausdruck einer Lebenshaltung ist, die wiederum einen Einfluss auf die Handlungen der Nutzer: innen hat (Ludwig 2012, S. 26). Darlegungen Kraus et al. (2015) zufolge, ist das Verhältnis von räumlichen Strukturen, symbolischen Zuweisungen und handelnden Lehrenden sowie Lernenden „ein konstitutives Element pädagogischer Praxis“ (ebd., S.15).
Der Zusammenhang von Struktur und Handlung ist also auch in der Erwachsenenbildung als doppelter Verweiszusammenhang zu denken: Die Raumpraxis der Erwachsenenbildung strukturiert Raum und trägt damit zu Raumstrukturen bei, die zugleich Rahmenbedingungen für das professio-nelle Handeln darstellen (Bernhard et al., S. 21). Ebenfalls ist in puncto Erwachsenenbildung und Raum das Zusammenspiel von Struktur und Handlung grundlegend (vgl. Kraus et al. 2015, S.15). Demnach gestaltet Erwachsenenbildung einerseits durch professionelles Handeln räumliche Bedingungen, orientiert sich andererseits jedoch auch an raumbezogenen Rahmenbedingungen, die durch die politische, materielle und symbolische Dimension des Raumes vorhanden sind und in die wiederum die Erwachsenenbildung mit ihrer Praxis eingreift (ebd.). Raumordnungen tragen demnach auch in der Erwachsenenbildung zur Strukturierung von Handeln und Gesellschaft bei, während soziales Handeln wiede- rum Raumordnungen reproduziert (Kraus et al. 2015, S. 15). Jedoch hängt die „Konstitution und Aneignung von Räumen“ wiederum auch von der gesellschaftlichen Position und Lebenslage von Individuen oder sozialen Gruppen ab (Kraus et al. 2015, S. 12).
Auch in der Erwachsenenbildung kommt es vor, dass die architektonische Grundstruktur bloß das Prinzip herkömmlichen Lernens abbildet (vgl. Schratz, 2007, S. 16).30So kommen in Hochschulen zuhauf vorstrukturierte Lernraumsettings vor. Dies ist insofern relevant, als dass Student:innen - auch wenn sie durchaus selbstständiger lernen als Schüler:innen - in ihrem Studium ebenfalls meist in Abhängigkeit von vorhandenen Räumlichkeiten oder Institutionen stehen.31Auch hier gilt: die Raumkultur bestimmt die Lernkultur (Schratz 2007, S. 16). Modelle und Konzepte speziell zur Wechselwirkung von Raumgestaltungen und -strukturen in Hochschulen mit pädagogischen Ansätzen sind im Vergleich zum schulischen Kontext rudimentär vorhanden. Die oben für den schulischen Kontext vorgestellten liefern jedoch Anregungen für den Hochschulkontext.
Für den hochschulischen Bereich öffnen sich ebenfalls mit neuester Technik die Schranken für mobile Lerner oder auch „Lernwanderer“, wie nach Brandt und Bachmann (20l4) ein Student schon selbst sein Studierverhalten bezeichnete (S. 17). Nach Brandt und Bachmann (2014) hätte er treffender den Kern aktueller Entwicklungen nicht bezeichnen können (ebd.). Die Bezeichnung „Lernwanderer“ passt gut zu möglichem und oft bereits ausgeführtem Studierverhalten von heute. So können Student:innen zum Lernen unterwegs auf dem Campus, aber auch außerhalb sein und sich als Lernwanderer für die jeweilige Tätigkeit optimale Umgebung, suchen, wie auch „Zwischenzeiten“ etwa beim Pendeln oder zwischen Lehrveranstaltungen (ebd.). Brandt und Bachmann beschreiben: „Lernwanderer sind sie einerseits dank mobiler Geräte, digitaler Literatur und Online-Lernmaterialien, andererseits verbringen sie aber auch wegen ihres dichten Stundenplans den Studienalltag vermehrt auf dem Campus und wechseln die physischen und virtuellen Orte zwischen Lehrveranstaltungen, Lernzeiten und ,Leerzeiten‘ häufig“ (Brandt & Bachmann; 2014, S. 17). Dadurch ergeben sich Chancen für mehr Bewegung.32
Doch Lehre und Lernen sollte sich höchstens in einem gesunden Maß auf Technik beruhen und oder portablen Gerätschaften gestützt werden. Einerseits ersetzen technische Lösungen wie Lernplattformen, Videokonferenzen, nicht klassische Lernsituationen wie die physische Präsenz von Lehrer und Lernenden, sondern sind immer nur Hilfe und Erweiterung oder Ergänzung zum klassischen Lernen, (vgl. etwa Schmidt et al., 2004), anderseits zeigen Erkennt- nisse über elektromagnetische Strahlung dessen negativen Einflussfaktor und aktuelle Studien negative Effekte elektromagnetischer Strahlung auf die Gehirnaktivität, wie etwa durch Mobilfunkexposition (vgl. Stiftung für Gesundheit und Umwelt, etwa Hefel und Henz, 2017, S. 4-5 und 11). Dies schließt aus, sich völlig auf technische Geräte zu verlassen, sie jedoch zu integrieren in eine Didaktik in Schulen und Hochschulen, bei welcher zusätzlich weiterhin die Haptik trainiert wird und ästhetische Lerner sich wiederfinden: kurzum kann mit und ohne digitale Geräte eine bewegungsaktivierende Didaktik erfolgen, die durch bewegungsaktiver- ende(re)s Mobiliar oder eine flexiblere Lernraumgestaltung unterstützt wird.
Leitlinien des Stifterverbandes als Orientierung
Koeritz et al. (2022) sehen eine „zukunftsorientierte Lernarchitektur“ für Hochschulen, wobei sie Lernarchitektur als theoretischen Überbegriff sehen, welcher „die Wechselbeziehung von Architektur und Pädagogik - oder auch pädagogischer Architektur“ erfasst (S. 2). Bauliche Umsetzungen sollten sich demnach auf der Grundlage pädagogischer Prinzipien stützen (ebd.). Unter Lernarchitektur wird hier verstanden, dass die Architektur der Pädagogik anpasst - und es nicht umgekehrt passiert, dass sich die Pädagogik der Architektur anpassen muss (vgl. Koeritz et al. 2022, S. 2). Koeritz et al. (2022) beziehen sich dabei auch auf Darlegungen Prof. Dr. Alfred Holzbrechers (2012).
Der Stifterverband und die Dieter Schwarz Stiftung starteten die gemeinsame Förderinitiative „Raumlabore - Experimentierräume für zukunftsorientierte Lernachitekturen“, welche es Hochschulen ermöglichen soll, in bereits bestehenden Räumen innovative Konzepte umsetzten zu können (Groß 2022). Mit dem Programm wird Hochschulen die Möglichkeit gegeben, einen bereits verfügbaren Raum zu einem Raumlabor umzugestalten und dort schließlich mit innovativen Lehr- und Lernformaten zu experimentieren (vgl. ebd.)33Das aktuelle Positionspapier des Stifterverbandes liefert überdies zehn Leitlinien für zukunftsorientierte Lernräume, wie Hochschulen vorgehen können, um mit neuen Lernarchitekturen die Lehre der Zukunft fördern zu können (vgl. Groß 2022). Da sich durch den empirischen Teil dieser Arbeit einige der Vorschläge, Postulate und Anregungen als durchaus praxis- und realitätsnah darstellten, werden die Leitlinien kurz vorgestellt.
Der Stifterverband um die die Autor: innen Judith Koeritz, Lara Kolbert und Mathias Winde (2022) will damit Orientierung geben wie Hochschulen mit neuen Lernarchitekturen die Lehre der Zukunft fördern können. Koeritz et al. (2022) stellten sich die Frage, wie zukunftsorientierte Lernräume aussehen könnten, wobei nach den Autor: innen dabei drei wesentliche Dimensionen hervorstechen: der lernende Mensch, der Raum und die zu gestaltende Zukunft. Die Autor: innen sich dabei auch auf die relationale Raumtheorie von Martina Löw (2001), welche in Kapitel 1.2.2.2. dieser Arbeit vorgestellt wurde.
Die erste Leitlinie scheint dabei gleichzeitig ein Postulat: „Es braucht Räume, die für aktive Lernsettings ausgerichtet sind.“ (Koeritz et al. 2022, S.2). Die Autor: innen fordern, dass der sich immer weiter entwickelnde „Shift from Teaching to Learning“ sich auch in der Raumgestaltung widerspiegeln sollte, denn selbstgesteuertes Lernen erhöht den Bedarf an mehr Raum für Kooperation und Kollaboration (ebd.).34Gebraucht würden nebst dem zusätzlich vermehrt aktive Lernsettings mit Lernräumen die vielfältig, aktivierend und flexibel gestaltet sind (ebd., S. 2-3). Eine interdisziplinäre Ausrichtung und Einrichtung der Räume sehen die Autor: innen als elementar an, folglich ist auch die Anordnung der Räume in diesem Zusammenhang signifikant (vgl. Koeritz et al. 2022, S. 3). Nämlich wächst die Anforderung, dass Lernräume auch als interdisziplinäre Begegnungs- und Diskursorte fungieren (ebd.)
Die zweite Leitlinie die der Stifterverband (2022) postuliert, umfasst, dass es „mehr Selbstorganisationsmöglichkeiten und Autonomie bei Räumen für Lernende in Hochschulen“ geben sollte (Koeritz et al., 2022, S. 3).35
Koeritz et al. (2022) sehen den geringen Gestaltungsspielraum und die wenigen Adaptionsmöglichkeiten als Grund, warum eine niedrige Reichweite und ein niedriger Nutzungsgrad von bestehenden Räumen vorherrscht (S. 3). Darüber hinaus sehen sie als Grund die zu geringe Einbindung von Lernenden in die bisherige Ausgestaltung bestehender Lernräume (ebd.).36Ein weiterer Aspekt, den die Autor: innen des Stifterverbandes ansprechen, ist die Zugänglichkeit zu Räumen. Die Idee ist etwa, Schlüsselkarten einzuführen, damit Räume jederzeit verfügbar und zugänglich sind (vgl. ebd.). Eine niedrigschwellige Zugänglichkeit würde gleichzeitig dazu führen, dass auch eine inklusive Nutzung erfolgen kann (vgl. Koeritz et al., S. 2-3.).
Die dritte Leitlinie als Vorschlag für zukunftsorientierte Lernräume des Stifterverbandes ist, dass es „eine Vielfalt an verschiedenen Lernräumen“ braucht (Koeritz et al. 2022, S.4). Die Thematik der Vielfalt umfasst den Bedarf an verschiedenen Lernraumtypen, welche mit Blick auf der bereits genannten Lernarchitektur zu zukunftsorientierten Lernräumen werden können (ebd.). Lernräume die zukunftsorientiert sind sollten demnach multifaktoriell und multifunktional gestaltet sein. Lernräume sollten überdies Kommunikation und Kollaboration über Machen und Entdecken, aber auch forschendes Lernen, ermöglichen (Koeritz et al. 2022, S. 4). Doch auch die Regeneration sollte nicht zu kurz kommen (ebd.). Die Umwelt um Lernende wandelt sich ständig und da eine nachhaltige Nutzung zukunftssichernd ist, so sollten auch Lernräume in der Hinsicht flexibel genutzt werden können. Außer der Nutzung von Außenbereichen kann es zudem sehr ertragreich sein, Raumkooperationen mit hausinternen Instituten, anderen Studiengängen, Fakultäten oder sogar Unternehmen zu schließen (vgl. Koeritz et al., 2022, S. 4). Synergien im Bereich der Lernraumgestaltung können in einer höheren Vielfalt und Nutzungsmöglichkeit resultieren (vgl. ebd.). Es wird betont, dass „Außenbereiche der Hochschule auf dem Campus und Raumkooperationen mit anderen Bestandsangeboten“ als Erweiterung mit anderen Bestandsangeboten bereits zu Beginn mitgedacht werden können (Koeritz et al., 2022, S.4).
Mit der vierten Leitlinie machen die Vertreter: innen des Stifterverbandes in ihrem Positionspapier deutlich: „Es braucht Räume für hybride Lehr-/Lernsettings und (Post-) Corona Lösungen“ (Koeritz et al., 2022, S. 4). Zukünftig sollte neben Schulen auch an Hochschulen vermehrt eine didaktische Gestaltung von physischen und virtuellen Lernräumen in der Verknüpfung stattfinden (vgl. ebd. S. 5). Studierende sollten den Modus, indem sie ihre Lerninhalte bearbeiten, selbst auswählen können und Lehrende für die Durchführung entsprechender Lehr-Lern-Angebote mediendidaktische und technische Unterstützung dafür bekommen (vgl. ebd.). Studierende sollten diese aktiv mitgestalten und partizipieren können. hinzufügend wird erläutert, dass vermehrt sogenannte Arbeitsplätze entstehen sollten, welche für Studierende mit eigenen Endgeräten ausgestattet sind (ebd.).
Mit der fünften Leitlinie werden Möglichkeiten nachhaltiger Gestaltung aufgezeigt, welche Koeritz et al. (2022) als einen wichtigen, zukunftsorientierten Faktor bei der Lernraumgestaltung sehen (vgl. S. 6). Sie beschreiben zwei verschiedene Ebenen von Nachhaltigkeit. So zählen neben einem ressourcenschonenden und biodiversen Verbrauch auch nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten in Neu- und Umbauten dazu (S. 6). Dabei sind nicht nur ressourcenschonende Materialien, sondern auch nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten, wie auch Nutzungsbedingungen mit Flexibilität und Agilität von hoher Wichtigkeit (ebd.). Es sollten nachhaltige Lernräume geschaffen werden, was auch bedeutet, dass Räume in der Lage sein sollten, das Feedback von Nutzer: innen miteinzubeziehen und notwendige Änderungswünsche oder andere Nutzungsarten ressourcenschonend, schnell und nutzerorientiert umsetzen zu können (S. 6). Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte außerdem an Hochschulen praktiziert werden. Dies schließt das Lehren von Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung mit ein, wie auch einen Fokus darauf so zu leben, dass so gelebt wird, dass planetarische Grenzen berücksichtigt werden (vgl. Koeritz et al. 2022, S. 6). Hinzu kommt, dass nachhaltiges Handeln auch bedeutet, vorhandene Ressourcen, Materialien und Ausstattungen zu nutzen (vgl. Koe- ritz et al. 2022, S. 6).37
Weiterhin ist es von Nöten „ein erhöhtes Bewusstsein für Lernraumarchitektur in Hochschulen“ zu schaffen (Koeritz et al., 2022, S. 7). Diese Thematik wird auch durch die sechste Leitlinie des Stifterverbandes erfasst. Koeritz et al. (2022) halten es dabei für relevant, die Anerkennung des Raumes als „dritten Pädagogen“, wie von Loris Malaguzzi angeregt, zu realisieren (S. 7). Die Realisierung der „Wechselwirkung von Didaktik und Architektur aller Akteure“ fehlt oft noch an Hochschulen, weshalb eine größere Aufmerksamkeit für das Konzept der Lernarchitektur - wie eingangs beschrieben als theoretischer Überbegriff verwendet, der die Wechselbeziehung von Architektur und Pädagogik - oder auch pädagogischer Architektur - erklärt und eine bauliche Umsetzung auf Grundlage pädagogischer Prinzipien einbindet- stattfinden sollte (ebd.). Dabei spielt vor allem die bereits angesprochene Partizipation eine große Rolle, denn durch das Miteinbeziehen von Student: innen können Anreize und Perspektivwechsel geschaffen werden und Hochschulen mehr den Bedürfnissen von Nutzer: innen nach aufgebaut werden (vgl. Koeritz et al., 2022, S. 7).
Dies schließt das Postulat der siebten Leitlinie mit ein, dass es „partizipative, interdisziplinäre Planungsprozesse mit organisationsweiten Konzepten“ braucht (Koeritz et al., 2022, S. 8). Es wird von den Vertreter: innen des Stifterverbandes bemängelt, dass die Kultur der Beteiligung innerhalb einer Hochschule in den meisten Fällen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht wirklich darauf angelegt ist, eine erhöhte Partizipation zu forcieren (ebd.). Oft ist es dagegen so, dass neu entwickelte Konzepte nur mit wenigen, bestimmten Akteur: innen geplant und umgesetzt werden und es bei Hochschulbauten oft keine bis wenig nutzerzentrierte Bedarfsplanungen gibt (vgl. S. 8). Nutzer: innen sollten auch der Ansicht Koeritz et al.‘s nach bei Neubauprojekte bereits von Anfang an partizipativ eingebunden werden (vgl. S. 8). Judith Koeritz, Lara Kolbert und Mathias Winde (2022) schlagen deshalb „ein organisationsweites, konzeptionelles Zusammendenken aller Akteure von (digitalem) Lernen, physischen Lernräumen und Nachhaltigkeit“ vor (S. 8). Um dies zu verwirklichen, sollte nach einem „Multi- Stakeholder-Ansatz“ vorgegangen werden, bei welchem in der Konzeptionsphase der Lehr- und Lernräume neben der Hochschulleitung etwa auch Architekt:innen, Pädagog:innen und Umweltpsycholog: innen mitwirken (ebd.). Dabei sollten die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer: innen deutlich berücksichtigt werden. Überdies ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen Interessenvertreter: innen elementar. Durch Beteiligungsworkshops, Feedbackrunden, Gremiensitzungen oder anderen Partizipationsmöglichkeiten kann diese gefördert werden (vgl. ebd. S. 8).
Mit der achten Leitlinie wird in dem Positionspapier des Stifterverbandes ein „Aufbau an personellen Ressourcen und eine Flexibilisierung der Rahmenbedingungen“ gefordert (Koeritz et al. 2022, S. 9). Die Vertreter: innen des Stifterverbandes reklamieren, dass systemische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Lernraumgestaltung bzw. Lernarchitektur ermöglichen (ebd.). Koeritz et al. (2022) nach finden sich für neuartige Raumkonzepte, die eine Vielfalt an Lernraumtypen vorsehen etwa in der gewöhnlichen Landesfinanzierung keine entsprechende „Flächenart“ - stattdessen müssten bislang für jedes Bauprojekt in einer aufwendigen Weise etablierter, genehmigungsfähiger Raumarten als Ausnahme begründet und abgestimmt werden (Koeritz et al., 2022)
Zukünftig wird deshalb eine Flexibilisierung dieser Rahmenbedingungen von Nöten sein (Koeritz et al., 2022). Hochschulen sollten zusätzlich mehr Kompetenzen im Bau- und Immobilienmanagement erhalten und Zuständigkeiten dafür diskutiert werden (Koeritz et al., 2022). Grundsätzlich muss die derzeit noch fehlende Fachexpertise im Baubereich dazu erst einmal aufgebaut werden. Schließlich braucht es auch mehr Fachkräfte, finanzielle Mittel sowie organisationsweite Konzepte „um die Hochschulen im Bereich der Entwicklung und Umsetzung zukunftsorientierter Lernarchitekturen zu befähigen“ (Koeritz et al., 2022). Koeritz et al. (2022) schlagen dafür die Ernennung und Einstellung sogenannter Lernraumagentinnen und - agenten (Koeritz et al., 2022).
In der neunten Leitlinie gehen Koeritz et al. (2022) deutlicher darauf ein, wie wichtig „Sichtbarkeit und eine nachhaltige Strategie zur Nutzung von Lernräumen an Hochschulen“ ist (S. 11). Sie zeigen dabei auf, dass vorhandene Räume, die nicht auf die Bedarfe der Nutzenden angepasst sind, von der primären Zielgruppe wie Lehrende und Studierende nicht wahrge- nommen und genutzt werden und es deshalb in der Prozessgestaltung eine nachhaltige Strategie des Raumkonzeptes braucht, bei welcher auch die Zugänglichkeit gewisser Räume in den Fokus rückt (Koeritz et al., 2022). Ideen dafür sind für eine höhere interne Sichtbarkeit zum Beispiel Raumbuchungssysteme, Infopoints oder digitale Türschilder mit farblicher Anzeige, die dazu dienen anzuzeigen, welche Lernräume aktuell frei nutzbar sind und welche belegt (Koeritz et al., 2022). Für eine externe größere Sichtbarkeit schlagen Koeritz et al. (2022) vor, Kooperationen mit anderen Einrichtungen wie Wissenschafts- und Kultureinrichtungen, aber auch Start-Ups zu schließen (S. 11).
In ihrer zehnten Leitlinie gehen Koeritz et al. (2022) auf die Wichtigkeit der Notwendigkeit von Experimentierräumen ein, welche als aktive Weiterentwicklung von Lernräumen genutzt werden können. Dabei steht vor allem die Anpassungsfähigkeit von Räumen an neue Gegebenheiten im Fokus (Koeritz et al., 2022). Der Stifterverband sieht somit die Möglichkeit und Notwendigkeit der Weiterentwicklung ist als Grundvoraussetzung für einen erfolgskritischen Aufbau eines Lernraums (ebd., S. 12). Es sollte demnach räumliche Gelegenheiten geben, um aktives Experimentieren zu ermöglichen, die aktive Weiterentwicklung und das Wechselspiel von Raum und Didaktik ausgetestet werden kann (Koeritz et al., 2022)38
1.3. Lernen und Bewegung
Die Erkenntnisse des Einflusses der Umwelt auf Menschen, wie der Lernraumgestaltung auf pädagogische Prozesse im Blick behaltend, werden im Folgenden verschiedene pädagogische Perspektiven auf Lernen und wie Lernen stattfindet untersucht, im Hinblick darauf, inwieweit es eine Rolle spielt, dass nicht nur der Geist, sondern auch der Körper eines Menschen beim Lernen aktiv ist oder aktiviert wird.
Nach einer phänomenologischen Perspektive wird Lernen als Erfahrung gesehen und das erfahrende Lernen oft in Kontrast gestellt zu Positionen in der kognitiven Neurowissenschaft, wobei der Mensch nicht nur als ein Denker, der auch einen Körper hat gesehen wird, sondern ein leibhaftiges Wesen, das denkt. Lernen wird von Vertreter:innen dabei als Erkennen gesehen, wobei die Dinge nicht passiv gegeben sein sollten, sondern aktiv aufgenommen werden (Faulstich, 2009, S. 815-819; zit. nach Käte Meyer-Drawe). Der moderne Lernbegriff umfasst überdies „Lernen als aktiv-produktive Leistung“ (Hildebrandt-Stramann, 2017, S.8). Dabei wird eine holistische Sicht vertreten mit der Leib und Seele als eine Einheit aufgefasst werden (ebd.). Jene Ansichten liegen auch der hier vorliegenden Arbeit zugrunde, so wird das Eingebundensein des Körpers in den Lernprozess als zentral erachtet.
Bewegungsmangel bringt allgemein und speziell für Lernprozesse zahlreiche negative Folgen mit sich und mehr Bewegung wiederum wirkt sich positiv auf das allgemeine körperliche Befinden und Lernprozesse aus. Im Folgenden werden einige Beispiele dieser aufgeführt.
1.3.1. Schäden durch Bewegungsmangel
Durch Bewegungsmangel entstehen nicht nur oft Schmerzen, die arbeitende oder lernende Menschen daran hindern ihren alltäglichen Aufgaben und Pflichten nachzugehen, der ganze Körper nimmt seinen Schaden davon. Nachweislich führt Bewegungsmangel im Arbeitskontext wie im Bildungswesen eher zu einer Ineffizienz, zu Ausfall wegen körperlicher Beeinträchtigung und zu schlechterer Arbeitsleistung. Nicht wünschenswert weder für Arbeitnehmer oder Lernende sind die im Folgenden dargelegten Auswirkungen, die durch Bewegungsmangel und zu langen Sitzzeiten verursacht werden.
Laut Glöckl und Breithecker (2018) wird durch das Beibehalten einer bestimmten Körperhaltung über einen längeren Zeitraum muss etwa die Muskulatur statische Haltearbeit leisten, wofür sie von der Natur nicht geschaffen ist (vgl. S. 12). Doch die Muskulatur ist nicht das Einzige, was am Körper darunter leidet. Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen haben sich bereits mit den Auswirkungen von hohen Sitzzeiten auf den Körper beschäftigt. So bestätigt der Neuropsychologe Niedeggen in einem ausführlichen Bericht im Deutschlandfunk, dass Stillsitzen geistige Kräfte hemmt, während Gehen das Denken fördert (vgl. Kuban 2020). In diesem Kapitel wird auf die Auswirkungen auf einige Körperregionen und Organe, wozu auch das Gehirn gehört, beispielhaft dargelegt. Daran anknüpfend wird genauer auf die Zusammenhänge von Bewegung und Lernprozesse eingegangen.39
Muskuläre Schmerzen und Verspannungen
Glöckl und Breithecker (2018) zufolge sind die menschlichen Gelenke perfekt dazu ausgebildet, ein aktives Leben mit Belastungen auszuhalten, die wie bei unseren Vorfahren beim Sammeln und Jagen auf die Gelenke wirkten (vgl. S. 11). Dazu gehören Beanspruchungen wie beim Laufen, Klettern Springen und Gehen40, auch über längere Entfernungen, aber genauso kurzfristige, intensive Anstrengungen(ebd.).Wenn jedoch Muskulatur, wie etwa die Rücken- und Bauchmuskulatur lange Zeit durch eine sehr häufig sitzende Haltung durch eine Lehne ruhiggestellt wird, werden Rücken- und Bauchmuskeln abgebaut, weil sie nicht aktiv gebraucht werden. Rückenschmerzen entstehen etwa deshalb, weil die geschwächte Muskulatur durch die fehlende Bewegung schlecht versorgt wird und die Dauerspannung nicht mehr halten kann. Nach Glöckl und Breithecker (2018) entstehen etwa 80 Prozent der Rückenschmerzen genau aus diesem Grund (S. 12).
Als Folge entstehen schließlich sehr oft Verspannungen, die schmerzen. Tatsache ist, dass ein verspannter Muskel im Vergleich zu einem bewegten, gut durchbluteten Muskel nur zehn Prozent der Sauerstoffzufuhr erhält (S.12). Wichtig ist dabei: Untrainierte Muskulatur verspannt schneller als gut trainierte (ebd.) Bewegungsmangel hat auch einen Einfluss auf Faszien, es entstehen „Verklebungen“ die die Bewegung verhindern und Schmerzen verursachen (5.15) . Überdies ist der Lendenmuskel, der Hüftbeuger, während einer solchen Sitzhaltung in einer verkürzten Position ruhiggestellt und der Lenden-Darmbein-Muskel, bleibt über längere Zeiträume in einer verkürzten Stellung (ebd.). Wenn man nun aufsteht, wird dieser gestreckt aber setzt der Dehnung Widerstand entgegen und zieht die Wirbelsäule zum Bauchraum hin (ebd.). Dadurch entstehen die typischen Schmerzen, die man beim Aufstehen „im Kreuz“ verspürt, wenn man etwa nach längerem Sitzen auf einer bequemen Couch oder auch auf einem konventionellen Bürostuhl sitzt (S. 22). Wer Schmerzen hat, kann folglich auch nicht gut arbeiten, oder lernen. Bewegungsmangel verursacht jedoch nicht nur Schmerzen durch einen Untergang der Muskulatur. Durch Bewegungsmangel werden Knochen und Gelenke41geschädigt und das ganze Skelett und viele Organe werden in ihrer Funktion beeinträchtigt.42
Beeinträchtigte kognitive Leistungen
Bewegungsmangel führt nachgewiesenermaßen dazu, dass Lernen und Arbeiten unproduktiver und ineffektiver ausgeführt werden können, da der Stoffwechsel, der Kreislauf und die Sauerstoffzufuhr negativ beeinträchtigt werden und somit das Gehirn weniger leisten kann: Wenn etwa die Bewegungsfreiheit des Zwerchfells eingeschränkt ist, wie bei einer vorgebeugten Haltung im Sitzen, wird die Bauchatmung behindert, denn das Zwerchfell kann den Unterdruck im Brustraum und den Überdruck im Bauchraum nicht mehr richtig regulieren (5.16) . Das Resultat ist eine verminderte Sauerstoffversorgung des Körpers, was schließlich besondere Auswirkungen auf unser Gehirn hat, da dies allein etwa ein Viertel des Sauerstoffs des gesamten Körpers benötigt. Fällt die Sauerstoffsättigung im Blut ab, so sind auch die kognitiven Leistungen beeinträchtigt (ebd.)
Dadurch dass sich durch Bewegungsmangel der Stoffwechsel verschlechtert43und weil durch das Verharren in einer Position wie beim bewegungsarmen, konventionellen Sitzen dafür sorgt, dass Kreislauf, Atmung und Stoffwechsel heruntergefahren werden, findet auch viel schneller eine Ermüdung statt (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 42-43).
Erhöhte Wahrscheinlichkeit zu erkranken
Bewegungsarmes Lernen und Arbeiten können außerdem die Wahrscheinlichkeit erhöhen krank zu werden: Der Lymphkomplex, welcher zum Immunsystem gehört, schützt uns Menschen gegen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile wie Tumorzellen (ebd., S. 20). Neben den Lymphbahnen gehören die lymphatischen Organe dazu: Milz, Thymus, Rachen-, Gaumen- und Zungenmandeln, die Lymphfollikel im Dickdarm und zahlreiche Lymphknoten (ebd.). Durch exzessives Sitzen und einem Mangel an Bewegung können Stauungen im lymphatischen System entstehen, wodurch dies in seiner Funktion unterdrückt wird. Überdies funktioniert die menschliche Immunabwehr bei Inaktivität schlechter (ebd., S.21). Einen Einfluss auf Lernen und oder Arbeiten im Allgemeinen hat dies in dem Sinne hat dies, da es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, krank zu werden.
Sport- und oder Bewegungseinheiten können außerdem Stress reduzieren und zu wenig Bewegung dafür sorgen, dass Stress nicht abgebaut wird. Bei Stresssituationen werden nämlich die Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus den Nebennieren ausgeschüttet (ebd., S. 27). Auch gestresste Menschen werden schneller krank. Diese Hormone sorgen unteranderem für eine schnelle Bereitstellung von Brennstoffen wie Glukose und Fettsäuren. Blutdruck und Herzfrequenz steigen an und es kommt zu einer Verengung bestimmter Gefäßgebiete (ebd.). Durch Bewegung kann ein hoher Adrenalinspiegel abgebaut werden, wenn Arbeit oder Lernen allerdings bewegungsarm ist und bedeutet, an den Schreibtischstuhl gefesselt zu sein, kann dies nicht geschehen - dagegen wird eher Bluthochdruck und in der Folge eine Arteriosklerose begünstigt (S.27).
Außerdem kann es schneller zu Bandscheibenvorfällen kommen. Damit die Bandscheibe ihre Elastizität behält und gut versorgt wird, ist eine regelmäßige Be- und Entlastung der Wirbelsäule unersetzlich, was auch beim Gehen, Laufen oder Springen passiert. Dies wird bei langanhaltender sitzender Tätigkeit verhindert. Eine Relevanz ergibt sich insofern daraus, als dass ein Mensch der frühzeitig einen Bandscheibenvorfall erlangt hat, oft lange eingeschränkt ist, ausfällt und oft erst recht nicht mehr lange, sitzende Tätigkeiten einnehmen kann. Darüber hinaus werden Gefäßerkrankungen durch ausgedehntes Sitzen begünstigt oder sogar hervorgerufen, wie Probleme mit Venen und Waden, folglich etwa Krampfadern (S.16-17).44
1.3.2. Positive Auswirkungen von Bewegung
Es gibt dagegen zahlreiche Auswirkungen von Bewegung, die sich positiv nicht nur auf den gesamten Organismus, sondern auch auf Lern- und Arbeitsprozesse auswirken. So kann gesagt werden, dass mehr Bewegung beim Lernen oder Arbeiten dazu führt, dass sich besser konzentriert werden kann und im Umkehrschluss auch mehr geleistet. Weiterhin führt mehr Bewegung zu einer Erhöhung des Wohlbefindens, positiveren Gefühlen und allgemein einer besseren Gehirnleistung, wie verbesserter Motorik. Die muskulären körperlichen Schmerzen wie eingangs beschrieben, werden verhindert, da physische Aktivität zahlreiche verschiedene Reize oder Impulse hervorrufen kann, die die Stärke und Ausdauer-Leistung von Muskeln verbessern können (Zoladz, J.A. & Pilc, A., 2010, S. 533).
Im Folgenden werden weitere Beispiele von wissenschaftlichen untersuchten positiven Auswirkungen von Bewegung auf Körper und Geist dargelegt.
Verbesserte kognitive Leistungen
Wie viele Studien und Untersuchungen, wie praxisnahe Beispiele zeigen, besteht ein enger Zusammenhang zwischen Bewegung und besseren Gehirnleistungen und verbesserten kognitiven Leistungen, die zu mehr Konzentration und Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistungen und insgesamt einen positiven Effekt auf Lernprozesse führen können.
Nach Prof. Dr. Wolfgang Schöllhorn (2017), Leiter des Instituts für Sportwissenschaften der Universität Mainz, hat ausreichend Bewegung einen gesundheitsfördernden Einfluss und regt nicht nur den (Fett-)Stoffwechsel und die Herzkreislauforgane an, sondern führt auch zu einer stärkeren Durchblutung des Gehirns (Stiftung für Gesundheit und Umwelt, 2017, S. 10-11). Bei einer Untersuchung von Chaddock et al. (2011) wurde festgestellt, dass Athleten schnellere Verarbeitungs-Geschwindigkeiten bei einem computerbasierten Test mit einfacher Reaktionszeit im Gegensatz zu Nicht-Athleten vorwiesen. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass kognitive Fähigkeiten, die beim Sport trainiert werden auf alltägliche Handlungen übertragen werden, bei denen schnelle Multitasking- Fähigkeiten gebraucht werden (Chaddock et al., 2011, S. 1920).
Nach dem Neuropsychologen Niedeggen haben besonders langanhaltende körperliche Übungsprogramme positive Effekte auf das Denken (ebd.). Genauer wird dadurch vor allem die Verarbeitungsgeschwindigkeit besser, das Gedächtnis, man lernt schneller, der Abruf klappt besser und die exekutiven Funktionen werden besser; in dem Sinne, dass man besser planen kann, wie auch die Umstellungsfähigkeit und das abstrakte Denken besser sind (vgl. Kuban 2020).
Nach einer Studie von Pietsch und Jansen (2012) kann zudem angenommen werden, dass sportliche oder musische Langzeitaktivitäten, wie das Spielen eines Instruments oder SportTreiben für viele Jahre einen verstärkten; verbesserten Effekt für kognitive Aufgaben hat, die geistige Rotationsfähigkeiten verlangen (S. 159; Übersetzung von Bregler).45
Bei der Durchführung von Bewegungsaktivierung im Rahmen einer „Bewegte[n], gesunde[n] Schule“ im Landkreises Oldenburg in Wildeshausen, konnte die zu beobachtende Bilanz gezogen werden, dass die teilnehmenden Schüler:innen dadurch aufmerksamer und konzentrierter, wie auch motivierter für den Unterricht sind (vgl. Rohdenburg, 2019). Kathrin Wunderer (2011-2012) hat zudem durch ihre Laureatsarbeit als Antwort auf die Frage, wie sich Bewegtes Lernen auf die kurzfristige und langfristige Merkfähigkeit von Gelerntem bei Jungen und Mädchen in der Grundschule auswirkt festgestellt,46dass es besonders auf die durchschnittliche längerfristige Behaltensleistung der Kinder positive Auswirkungen von Bewegtem Lernen gab. Die Mädchen profitierten sowohl kurzfristig als auch langfristig davon, die Jungen eher längerfristig (Wunderer, 2011-2012).
Hinzuzufügen sind überdies die Ergebnisse von Sabrina Pöpping von der Universität Bremen, die in ihrer Arbeit an der Konzentrationsfähigkeit und Mathematikfähigkeiten der Schüler: innen forschte (Kuban, 2020). Anhand eines Pre- und Posttest-Verfahrens wurden Schü- ler:innen auf Konzentration und Mathefähigkeit getestet. Dabei wurden Schüler:innen genommen, die die Ergometer noch nie genutzt hatten. Für den Pre-Test wurde direkt vor der Ergometer-Nutzung getestet. Eine randomisierte Gruppe nutzte dann das Ergometer für eine Unterrichtsstunde, eine andere Gruppe jedoch nicht. Danach erfolgte der Post-Test, also ein ähnlicher Test, anschließend wurden beide Ergebnisse verglichen (ebd.). Sabrina Pöpping beschreibt, dass diese eindeutig waren, denn sie ergaben, dass Schüler: innen die während des Unterrichts, also während des Lernens, dieses Ergometer hinzuzogen, sowohl in der Konzentrationsfähigkeit als auch bei ihren mathematischen Fähigkeiten eine viel bessere Leistung erzeugten als die SchülerInnen, welche dies nicht taten (Kuban, 2020).
Reduzierung von Stress und Verbesserung des sozialen Miteinanders
Stephanie Goddard von der Universität Oldenburg stellte in ihrer Masterarbeit den positiven Effekt von Ergometern fest: Die Nutzung dieser kann beim Abbau von Stress helfen und das soziale Miteinander fördern (vgl. Kuban 2020).
Zusätzlich sagt der Sportlehrer Harald Wolf zu der Integration von Sportgeräten wie Ergometer oder auch Laufbänder in seiner Schule aus, dass die Schüler: innen nicht nur ruhiger und konzentrierter seien, sondern sich sogar das Sozialverhalten geändert habe (vgl. Kuban 2020). Ein interviewter Schüler sagt aus, dass es zwar zu Beginn schon komisch gewesen sei, gleichzeitig zu treten und zu schreiben, er sich aber mit der Zeit daran gewöhnt hätte und es ihm es jetzt „auch echt Spaß“ mache, sogar in den Pausen. Bemerkenswert ist, dass er selbst sogar bezeugt, dass es ihm bei der Konzentration und beim Stressabbau helfe (Kuban, 2020).
So berichtet auch der Sonderpädagoge Dirk Baumgartner einer Bremer Schule, wie dadurch der Schulalltag vereinfacht wurde (vgl. Kuban 2020). Positives Schüler:innen-Feedback zu Sportgeräten im Klassenzimmer findet sich dabei zu Hauf: ein 14-Jähriger Schüler beschreibt, dass es ihm gut tue, sich auszupowern und es hülfe, wenn man in der Pause nicht genug Sport gemacht hätte und deshalb etwas hibbelig sei (ebd.). Ein weiterer Schüler berichtet, dass er sich zwar meist im Unterricht konzentrieren könne, er aber die Abwechslung durch das Nutzen des Laufbandes genieße (ebd.). Eine Schülerin gibt die Rückmeldung durch die Nutzung des Laufbandes eine Lockerheit zu empfinden, sie lese auch mal ein Buch dabei - und es eben anstrengend sei, wenn man die ganze Zeit in der Schule nur sitzen würde, besonders für die Schüler:innen die ansonsten viel Sport treiben sei das schwer (vgl. ebd.).
Bewegung und Emotionen
Überdies ist der Einfluss von Bewegung auf emotionale Prozesse mittlerweile zahlreich erforscht und belegt worden. Ekkekais et al. (2011) haben durch einen Review, in dem sie 33 Artikel von 1999 bis 2009 studiert haben, herausgefunden, dass die aktuellsten Beweise für einen Zusammenhang zwischen der Intensität von Bewegung und affektiven Antworten (S. 642). Nach den Erkenntissen der Durchsicht der Studien, fassen Ekkekais et al. (2011) zusammen, dass die Stimmung während körperlichen Aktivitäten tendenziell verbessert, solange nicht die aerobe Schwelle überschritten wird (vgl. ebd.). Bewegung hilft zudem bei Therapieansätzen zur Regulierung von Emotionen (vgl. Eberhard-Kaechele 2016-2017). Beispielsweise finden Bewegungstherapien erfolgreich Anwendung bei Angststörungen (vgl. etwa Eber- hard-Kaechele, Gotthard (2016). Die Wahrnehmung des Körpers spielt zum Beispiel bei der Bewegungstherapie von Angststörungen eine Rolle (vgl. ebd., S. 155). So kann etwa bei körperlichem Kompetenztraining „eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht, Geschicklichkeit oder Schnelligkeit zu einer Verbesserung der Beziehung zum eigenen Körper, zu mehr Selbstbewusstsein und zu positiven Kontrollüberzeugungen führen“ (ebd., S. 156).
Zusammenhang Stimmung und Nerven
Die Auswirkungen auf Stressreduzierung und besserem sozialen Miteinander hängen vermutlich auch damit zusammen, dass sich das allgemeine Wohlbefinden durch Bewegung erhöht. Regelmäßige physische Aktivität kann nicht nur das Auftreten von verschiedenen Stoffwechselerkrankungen verzögern, es ist außerdem bekannt, dass körperliche Betätigung die Stimmung und kognitive Funktionen von aktiven Menschen verbessern, obwohl die physiologischen Hintergründe dafür unklar bleiben (Zoladz, J.A. & Pilc, A., 2010, S. 533).
In den letzten Jahren konnte vermehrt gezeigt werden, dass körperliche Aktivität die Expression von dem neurotrophen Faktor47BDNF in Rattengehirnen erhöht (ebd.). Zahlreiche Untersuchungen wurden unternommen, um die Verbindung von Neurothrophin und der der Verbesserung der Stimmung und kognitiven Funktionen nach dem Training oder Bewegung bei Menschen zu zeigen (ebd.). Dabei konnte demonstriert werden, dass körperliche Anstrengung oder Betätigung „Plasma und oder Serum BDNF-Konzentrationen“ bei Menschen erhöhen können (ebd.).
BDNF, der "brain-derived neurotrophic factor", gehört zu den Wachstumsfaktoren und der Familie der Neurotrophine, die eine entscheidende Rolle bei der Gehirnentwicklung spielen (vgl. Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Anatomie und Zellbiologie, 2022).
Wie als aktuelle Erkenntniszusammenfassung des Instituts für Anatomie der Universitätsmedizin in Greifswald (2022) zu lesen, übernehmen diese Faktoren nicht nur wichtige protektive Funktionen im Gehirn, wie beispielsweise im Zusammenhang mitMorbus Parkinson, sie sind auch „unter physiologischen Bedingungen [.] an Lern- und Gedächtnisvorgängen beteiligt. Fehlregulationen der Wachstumsfaktorsysteme scheinen an Depressionserkrankungen beteiligt zu sein“ (ebd.). BDNF stellt dabei einen der wichtigsten Mitglieder der Familie der Neu- rotrophine dar und ist an der Regulation zahlreicher essenzieller Prozesse wie der Neurogenese, der neuronalen Plastizität sowie dem Überleben und der Differenzierung von Neuronen beteiligt. All diese Prozesse sind essenziell für Lern- und Gedächtnisvorgänge. Wie aktuell erforscht, scheint BDNF außerdem an der Essensregulation beteiligt zu sein (vgl. Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Anatomie und Zellbiologie, 2022).48
Zolac und Pilc (2010) begutachteten den aktuellen Forschungsstand bezüglich der Auswirkungen von Bewegung und Training auf die BDNF Expression im Gehirn, in den arbeitenden Muskeln wie auch die Konzentrationen im Blut (S. 533; Übersetzung von Bregler). Sie schlussfolgerten, dass es potenzielle Vorteile von der durch Bewegung induzierte Erhöhung der BDNF-Expression und der Freigabe im Gehirn wie außerdem dem peripheren Gewebe kommt, was zu der Verbesserung der Körperfunktion führt (ebd.). Jedoch muss dieser Effekt, vor allem bei Menschen, noch eingehender untersucht werden.
1.3.3. Bewegungsaktivierend(er)e Didaktik
In folgendem Kapitel wird sich mit Anlehnung an schulischen Erkenntnissen, im Besonderen hochschulischen, methodischen und didaktischen Möglichkeiten gewidmet, wie bewegungsaktivierend gelehrt und gelernt werden kann.
Die Wichtigkeit einer Umgestaltung und eines Umdenkens an Hochschulen ist nicht zu leugnen, wenn bedacht wird, dass neben einer bundesweiten Studie eine Erhebung des Sitz-, Steh- und Bewegungsverhaltens bei Studierenden der Pädagogischen Hochschule (PH) in Heidelberg gezeigt hat, dass die Studierenden den größten Teil Ihres Tages im Sitzen verbringen, einige von ihnen sind sogar 20 von 24 Stunden körperlich komplett passiv (Pädagogische Hochschule Heidelberg, 2021) und Stimmen von Studentinnen nach der Teilnahme der Untersuchung zum Sitz-, Steh- und Bewegungsverhalten von Studierenden an der PH Heidelberg waren: „Ganz ehrlich: ich bin erschrocken, wie viel Zeit ich jeden Tag im Sitzen verbringe“, oder „Alles im Studium veranlasst zum Sitzen“ (ebd., 2021).
Der Lehrvortrag gilt als die Standardmethode der universitären Bildung und Wissensvermittlung (Rupp et al., 2020, S. 24). Dabei besteht ein starkes Ungleichgewicht der Aktivitätsniveaus von Lehrenden und Studierenden. Während Lehrende bei der Vermittlung von Fachwissen in der Regel geistig wie körperlich hoch aktiv sind, wird die Aktivität der Studierenden auf ein kognitiv forderndes Zuhören in körperlich passiver Sitzhaltung reduziert, was körperliches Wohlbefinden wie auch geistige Aufmerksamkeit und Konzentration über die Unterrichtseinheit schnell schwächt (Rupp et al., 2020, S. 24)
Im Folgenden wird sich deshalb bewegungsaktivierend(er)en Didaktik und der Thematik gewidmet, wie die Gestaltung von Lernräumen einschließlich des sich dort befindenden Mobiliars, beeinflussen kann, ob und in welchem Umfang bewegungsarm oder bewegungsaktivierend gelehrt und gelernt werden kann, um einer sedentären Nutzungsnorm entgegenzuwirken. Es werden zwei Ansätze gezeigt, die ähnlich schon für den schulischen Kontext beschrieben wurden (siehe etwa Hildebrandt-Stramann et al. 2017):
Ansatz 1: Bewegung getrennt von Lernen.Einerseits kann eine Trennung von Lernen und Bewegung49erfolgen, sodass sich nach, oder vor dem Lernen, wie auch in einer Pause vom Lernen bewegt wird.
Ansatz 2: Bewegung in Kombination mit Lernen.Andererseits kann als ganzheitlicher Ansatz Lernen mit Bewegung kombiniert werden, sodass sich beim oder während des Lernens bewegt wird.
Für beide Ansätze wird auf verschiedene Methoden eingegangen und wie die von Lehrenden praktizierte Methodik und Didaktik diverse Lernraumanordnungen und Mobiliar nutzen können, welche(s) Bewegung entweder integriert oder anregt.
1.3.3.1. Trennung von Bewegung und Lernen
Unterbrechungen der Lehre zugunsten einer kurz-zeitigen Bewegungseinheit, können je nach Ausrichtung zur Aktivierung, Auflockerung, Kräftigung, Dehnung, Entspannung oder Konzentrationsförderung dienen (Rupp et al. 2020, S. 22-23).
Vorteile sind dabei, dass Bewegung zwischendurch als Impuls oder Pause in eine Veranstaltung gebracht werden kann, unabhängig von der gewählten hochschulischen Didaktik davor oder nach jener Einheit. Dazu zählen etwa geplanten Unterbrechungen durch zum Beispiel gezielte Bewegungspausen oder instruiertes Aufstehen.
Diese Unterbrechung kann jedoch auch als Störung gesehen werden und Lernende wie Lehrende aus in ihren kognitiven Prozessen unterbrochen, oder „rausgebracht“ werden. Als weiterer Nachteil kann gesehen werden, dass durch eine Unterbrechung von Lehre zugunsten von Bewegung die Sicht der klassischen Körper-Geist-Trennung unterliegt, also entweder Lehre im Sinne von „Geist“ oder Bewegung im Sinne von „Körper“. Es findet keine Integration von Bewegung in den Lernprozess stattfindet, das Bewegen wird vom Lernen zeitlich entkoppelt. (Rupp et al. 2020, S. 16).
Darüber hinaus gibt es unterschiedliche, empirische Untersuchungsergebnisse zu den Effekten von Bewegungspausen oder täglichen instruierten Bewegungszeiten (vgl. Hildebrandt- Stramann, 2017, S. 24).Während Dordel und Breithecker (2003)50durch ihre Studie unteranderem herausfanden, dass wenn „den Kindern erlaubt wird, bzw. sie motiviert werden, die Pausen bewegungsaktiv zu nutzen, und wenn ihnen dazu Möglichkeiten eröffnet werden, zum Beispiel durch eine (gemeinsame) Gestaltung des Schulhofes, u. U. Eröffnung weiterer Bewegungsräume“ die Aufmerksamkeitsleistung im Verlauf des Schulvormittages nicht nur erhalten, sondern sogar noch gesteigert werden kann (S. 13), sind Fessler et al. (2008), die die Studie replizierten, zu einem anderen Ergebnis gekommen. Fessler et al. (2008) probierten „fächerübergreifend implementierbare Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Bewegungspausen im Unterricht; Bewegter Unterricht)“ (S.250) aus und kamen zu anderen Ergebnissen: „Ein Blick auf die Ergebnisse der Gesamtstudie führt jedoch nicht zum Schluss, dass vor allem Hauptschülerinnen und Hauptschüler von zusätzlichen Bewegungsangeboten profitieren.
Die Entwicklung der Konzentrationsleistungs- Werte in der hier gezeigten sechsten Klasse konnte nämlich in den anderen Klassen nicht in gleichem Ausmaß festgestellt werden. Dies beweist, dass die Ergebnisse der Pilotstudie von Dordel und Breithecker keineswegs verallgemeinerbar sind.“ (S. 254).
Grundsätzlich gilt gerade bei Vorlesungen oder Phasen in denen nur zugehört werden muss, dass das eigenständige, individuelle Bewegen wie etwa aufstehen, das keine explizite Benennung oder Aufforderung bedarf, wiederum einen weniger unterbrechenden Charakter hat, vor allem, wenn dies als Norm etabliert ist und dementsprechend nicht mehr auffällt.51
Bewegungsimpulse oder Bewegungstrigger
Impulse zur Bewegung können mit bestimmten Wörter oder Bilder zu Veranstaltungsbeginn als „Bewegungstrigger“ definiert werden, bei dem alle Teilnehmenden aufstehen (Dold, 2020). Sobald das Wort oder Bild schließlich auf einer Präsentationsfolie auftaucht, können alle Veranstaltungsteilnehmende eine Bewegung vornehmen und z.B. aufstehen und sich strecken. Dies lasse sich nach Dold (2020) sehr gut in Powerpoint-Präsentationen einbauen, z.B. mit dem vorab kommunizierten Vermerk, “Wann immer Sie auf einer der Folien XY sehen, stehen Sie kurz auf” (Dold, 2020). Darüber hinausgehend kann bei bestimmten inhaltlichen Tagesordnungspunkten oder Lehrveranstaltungsphasen eine Stehphase eingebaut werden (Dold, 2020)
Stand-Up-Phases bei Vorlesungen/ langen Input-Phasen
Verschiedene Methoden eigenen sich besonders für Veranstaltungen mit viel Input, wie Vor- lesungen(Dold, 2020).52Wichtig ist dabei, dass die Teilnahme an Steh- und Bewegungsphasen immer freiwillig sein sollte. Allerdings: wo vorher “Sitzzwang” oder zumindest eine wahrgenommene Sitznorm herrschte, sollte zwischen Sitzen und Stehen oder Bewegen gewählt werden können (Dold, 2020)
Dold (2020) beschreibt, wie zwischen einzelnen inhaltlichen Abschnitten Steh- oder Bewegungsphasen erfolgen können. Ein „Timer“ könne dabei helfen, dadurch, dass etwa alle 30 Minuten an eine Sitzunterbrechung erinnert wird (Dold, 2020).
Bevor Meetings oder Veranstaltungen startet, kann dargelegt werden, dass lang andauerndes Sitzen ermüdet und gesundheitsriskant ist. Anschließend wäre es hilfreich eine moderierende oder ein bis zwei Freiwillige zu mobilisieren die Rolle einer oder eines „Steh- oder Bewegungsbeauftragten“ während des Meetings oder der Veranstaltung zu übernehmen und regelmäßig ein Signal zum Aufstehen zu geben, wie die Einhaltung der Pausenzeiten zu überwachen (Dold, 2020).
Dold (2020) postuliert, dass bei Veranstaltungen, bei denen es lediglich um die Vermittlung von Informationen geht und Teilnehmende hauptsächlich aufmerksam zuhören und sich gelegentlich Notizen machen müssen, wie etwa bei Online- Veranstaltungen, mit ausgeschaltetem Bildschirm verfolgt und mit Bewegung kombiniert werden wie durch Umhergehen, ein paar Kniebeugen, Dehnübungen (Dold, 2020), oder wie von der Autorin dieser Arbeit angemerkt, ebenfalls bei Präsenz-Versanstaltungen, bei denen hauptsächlich referiert wird. Hier ist lediglich darauf zu achten, dass Bewegungen gewählt werden, durch die sich der oder die referierende nicht zu abgelenkt fühlt, was jedoch auch von dem Referierenden abhängt, dies kann jedoch im Vorfeld geklärt werden.
Bewegungspausen
Mit Bewegungspausen kann mehr Bewegung in einen Student:innen-Alltag gebracht werden. Diese können einerseits organisiert sein, oder auch selbstständig vorgenommen werden.
Organisiert
Die Freie Universität (FU) in Berlin geht mit ihrem „Pausen-Express“ mit gutem Beispiel voran, welcher ein fünf- bis siebenminütiges Sportprogramm darstellt, welches Bewegungen enthält, die Mobilisation und Koordination ansprechen (Kuban 2020). So beginnt etwa ein von Gaschler (2019) beschriebener Pausenexpress, indem eine Trainerin des Hochschulsports das Auditorium mit dem Aufdrehen eines rhytmischen, aktuellen und schnellen Liedes beginnt, die Student: innen auffordert, sich in den Reihen zu verteilen und schließlich um die 100 junge Student: innen dazu animiert „eine einfache Choreografie aus Schritten, Armschwingungen und Drehungen“ zu tanzen, wie „leichte Dehnungs- und Kräftigungsübungen“ auszuführen (Gaschler, 2019). Den Beobachtungen von Gaschler (2019) zufolge, wirkten die Student: innen danach „deutlich aufmerksamer“ (ebd.). Es handelt sich dabei um ein fünf- bis siebenminütiges Sportprogramm, das Studierende „nach oft stundenlangem Sitzen“ dazu animieren kann, geistig und körperlich wieder fit werden zu lassen (Gaschler 2019). Jene Bewegungspausen sind für inmitten einer Vorlesung oder eines Seminars angedacht (ebd.).
Der Pausenexpress soll nicht nur kreativ und abwechslungsreich mit einem flexiblen Schema und etwa bestimmten flexiblen Energizer-Übungen zum Wachwerden, gefolgt von Kraftübungen aus dem Fitnessbereich und Entspannungsübungen als krönender Abschluss (vgl. Gaschler 2019). Besonders ist auch, dass das Ganze als „Peer- to- Peer Projekt“ gedacht ist und Student: innen durch eine Schulung dazu befähigt werden sollen, Bewegungspausen irgendwann selbstständig leiten zu können (Gaschler 2019).
Tatsächlich kann für Gymnastik als Pause auch ein Blick in die Musikpädagogik hilfreich sein, Stimm-Aufwärmübungen wie „Stimmbildungsgeschichten“ oder Atemübungen für die Öffnung der Lunge, das Zwerchfell und die Hüfte sind dabei ideal, wie sie aus der Musikpädagogik bekannt sind.
Eigenständig
Gerade in der Erwachsenenbildung oder dem Hochschulbereich kann Eigenständigkeit und eigene Verantwortung erwartet werden, wenn räumliche und austattungstechnische Möglichkeiten für eigenständige Bewegungspausen für Studierende zahlreiche Möglichkeiten eröffnen. So wurde bei der FU Berlin wurde ein „Spielemobil“ angeschafft, welches im Prinzip ein Lastenfahrrad darstellt, in welchem verschiedene Sport- und Spielgeräten enthalten sind, auch Fuß-, Basket- und Footbälle sowie Badmintonschläger stellt der Hochschulsport bereit, Boccia, Riesenmikado oder das skandinavische Wikingerschach soll es geben (vgl. Gaschler 2019). Dieses „Spielemobil“ steht regelmäßig in der Woche zu bestimmten Uhrzeiten bereit, der genaue Standort wird zu Beginn des Sommersemesters bekanntgegeben. Gegen Pfand - idealerweise die Campuscard - können Studierende und Beschäftigte die Geräte ausleihen. (Gaschler, 2019)
Als Idee wäre ein bestimmter Raum als Gymnastikraum mit Yogamatten und kleinen Sportgeräten sinnvoll, oder ein simpler Zugang auch außerhalb von Veranstaltungszeiten zu Räu- men mit bewegungsaktivierendem Mobiliar (worauf speziell im Sinne des zweiten Ansatzes genauer drauf eingegangen wird).
Enstprechende Lehr- und Lernraumgestaltung
Um Bewegungsimpulse oder Stand-up-Phases wirksamer durchführen zu können, wäre zukunftsorientierend anzupeilen für Veranstaltungen nur noch Räume zu nutzen oder in Zukunft solche zu bauen, in denen das Mobiliar verrückt werden kann.53
Es könnte außerdem Räume geben, in denen Isomatten oder kleine Gerätschaften zur Verfügung stehen, wie Thera-Bänder, Springseile, einzelne Gewichte u.ä. zur Verfügung stehen, damit entweder geplante Bewegungspausen in der Gruppe oder individuelle, freiwiliige Bewegungspausen durchgeführt werden können.
Für eigenständiges Bewegen wurden im Rahmen eines Seminars zu Lernraumgestaltung an der Pädagogischen Hochschule von Lehramts-Student: innen im Master in Gruppen Ideen gesammelt, wobei (Um-)gestaltungs-Ideen für den Campus einer Hochschule gesammelt wurden, wie Isomatten oder Decken für Gymnastik-Übungen drinnen in Bereichen drinnen oder auch in einem Außenlernraum, einem Barfußlauf-Pfad draußen, eine Kletterwand, Tischtennisplatte, oder der Bereitstellung von (E-)Skateboards oder Ballspielen, die in einer oder mehreren Boxen im Sinne eines „Spielemodells“ der FU Berlin, bereitstehen und von jedem genutzt werden können (vgl. Bregler et al., WiSe 2020-2021).
Besonders gute Beispiele für die von Glöckl und Breithecker (2018) postulierten komplexen, spontane, intuitive Bewegungen können beim als Lernpause auf dem Campus bei verschiedenen Ballspielarten oder Klettern ausgeübt werden, da Körper und Geist ständig auf neue Reize und Situationen reagieren müssen und die Bewegungen spontan erfolgen, um ein Ziel zu erreichen.
Zusätzlich wurde in einer der Arbeitsgruppen des Seminars etwa speziell für die Bibliothek überlegt, dass QR Code Scanner auf Tische geklebt werden können, die nach dem Scannen Übungen zeigen, die eigenständig als Bewegungspause gemacht werden können (vgl. Bregler et al., WiSe 2020-2021).54
1.3.3.2. Kombination von Bewegung und Lernen
Lernen durch Bewegung nimmt eine lernerschließende Funktion ein (vgl. Hildebrandt- Stramann, 2017, S. 25) Argumente für eine Kombination von Bewegung und Lernen gibt es viele. Schließlich kann Gelerntes umso besser behalten werden, umso mehr Sinne beim Lernen beteiligt sind. Für die Verknüpfung von Lernen in Zusammenhang mit Bewegung spricht etwa beim Textlesen, dass, bereits bekannt ist, dass je etwa durch die Bewegung wie dem Anstreichen oder Herausschreiben von Textstellen, oder der Farbe eine Stiftes Verknüpfungen im Gehirn fokussiert angelegt werden und je mehr Verknüpfungen stattfinden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gelesene ins Arbeitsgedächtnis und dann auch ins Langzeitgedächtnis gelangt (Hoffacker, 2020)
Die Forschung bestätigt längst, dass die Art der Informationsaufnahme die Merkfähigkeit beeinflusst. Dabei behält das Gehirn am wenigsten von dem, was nur gelesen wurde, am meisten behält es von dem, was selbst gemacht wurde. Klar ist: „dass man mit allen Sinnesorganen lernt: Das Gelernte laut sprechen, wesentliche Aussagen aus dem Gedächtnis heraus aufschreiben, Notizen machen, Zeichnungen, Schemata oder Zusammenfassungen anfertigen. Wichtiges bzw. Bedeutendes mit Farben hervorheben. So konnten, anhand moderner bildgebender Verfahren, Forscher in den letzten Jahren die interaktive Verflechtung von körperlichen und geistigen Prozessen nachhaltig belegen. (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 142)
Der Sportlehrer Harald Wolf führt aus, dass bewegtes Lernen schon im Grundschulalter stattfinden sollte und es gemeinsame Aktionen bräuchte, damit „Bewegung einen ganz anderen Akzent bekommt“ (Kuban 2020, Interview Wolf). Bewegung sollte seiner Meinung nach in jedem Unterricht stattfinden: „Ich kann durch Ecken rechnen, durch andere Organisationsformen, weg von der rein sitzenden Tätigkeit. Ich kann auch dort bewegt fächerspezifisch Aufgaben thematisieren, dass Schüler eben nicht auf dem Platz verharren, sondern sich dann arrangieren müssen: ,Stadt, Land, Fluss‘ zu spielen, oder man bewegt sich dabei, man wirft sich den Würfel zu, man stellt sich hinten an. Das wäre meine Vision, dass man Bewegung und Lernen ganz selbstverständlich miteinander verbindet“ (Kuban 2020, Interview Wolf).
Auch ohne technische Geräte und digitalen Zugängen können Lernende dazu gebracht werden, ihren Körper während Tätigkeiten zu aktivieren, wie einen Text ausgedruckt farbig zu markieren, unterstützend bei gewissen Aufgaben auch noch mit der Hand geschrieben werden muss und kann, oder Plakate erstellt, Modelle gebastelt und von Student: innen interaktive und bewegungsaktivierende Didaktik, gestaltet werden.
Stationen oder Lernzirkel
Aufgaben können, wie bei Stationenarbeit, verteilt im Lernraum an verschiedenen Orten, wie Stehtischen oder auch gemütlichen Sitzecken, wie eventuell auch mal an Lernplätzen draußen, zu bearbeiten sein. Gruppenarbeiten, Stationenarbeiten, Lernzirkeln u.ä. bereits bekannten Methoden können durch weitere Bewegungsimpulse erweitert werden.
Das Lernen ist somit bewegungs- und abwechslungsreicher. Studierende können eine Auswahl an Aufgaben bekommen, unterstützend einer Differenzierung. Die Wahrscheinlichkeit ist so höher, dass unterschiedliche Lerner-Präferenzen und Lerner-Typen angesprochen und berücksichtigt werden.
Szenische Interpretationen
Um alle Sinne anzusprechen, können Methoden des „darstellenden Spiel[s] und szenische Interpretationen“ herangezogen werden (vgl. Spinner 2010, 230-231). Gerade für die Geisteswissenschaften kann dies Anwendung finden. Perspektiven können besonders gut durch Standbilder eingenommen werden, bei denen sich auf eine hineinfühlen in einen anderen Standpunkt konzentriert wird. Während gewisse Gruppen ein Standbild vorstellen, können Kommoliton: innen raten, welche Szene gerade gespielt wurde. Das Darstellen und Spielen zwingt zum Textverständnis. Für den sprachlichen Kontext eignen sich „Lesetheater[s]“: Hier wird das wiederholte Lautlesen in einen kreativen Kontext integriert (Rosebrock/Nix 2011, 37-38). Literarische Texte werden dabei in einfache „Lese-Scripts“ umgewandelt, in denen Figurenreden oder die des Erzählers, in „direkter Rede“ wiedergegeben werden (ebd.).
Videoformate
Ähnlich können Gestaltung von Videoszenen geschehen, durch die Darlegung von Inhalten, der Zusammenfassung eines Themas, indem neben Sprechstimme noch gestische und mimische Gestaltungsmittel hinzu kommen.
Generell können Video-Erstellungen, die Thematiken durch visuelle und auditive Reize darlegen müssen (also keine reine Power-Point-Präsentationen), für die Ersteller: innen ein ganzheitliches Lernen ermöglichen. Stop-Motion-Filme als Erklärvideos sind dabei auch sehr gewinnbringend, dabei kann jedoch kreativ und individuell vorgegangen werden. Für Studienfächer wie Geschichte oder Politik kann etwa an Orten des Geschehens gefilmt und erklärt werden, eine Führung gemacht werden etc.
Walk and Talk
Generell kann die Methodik des „Walk an Talk“ angewendet werden, welche Dold (2020) auch als „Moving while Listening“ beschreibt: Input kann auch aufgezeichnet und als AudioAufnahme wie als Podcast zur Verfügung gestellt werden. Dieser kann dann etwa im Rahmen eines Spaziergangs angehört werden (Dold 2020). Am besten ist, wenn der Inhalt auch herunterladbar und an Portablen Geräten speicherbar ist, um auch offline anhören zu können. Der Vorteil von solchen Formaten ist, dass sie zu individuell geeigneten Zeitpunkten angehört und beliebig abgespielt werden können. Für das Anhören und eventuelle Beantworten von Fragen dazu kann eine Frist gesetzt werden (Dold, 2020).55
Die Methode „Walk and Talk“ kann während der Lehre in Seminaren so genutzt werden, dass durch auditive, nebenher anzuhörende Anweisungen, im Gebäude rumgelaufen werden muss, bestimmte Stellen und Orte aufgesucht werden müssen, um eine Aufgabe zu bewältigen, oder eine Anforderungen zu erfüllen. So kann gefordert werden zu einer bestimmten Station hinzugehen und dort einen Text zu lesen, oder im sprachlichen Kontext etwas beschreiben zu müssen was gesehen wird. Biologie-Student: innen könnten beispielsweise durch einen Audio-Guide Kommoliton: innen bestimmte Flora und Fauna erklären
Alternative, bewegungsaktivierende(re) Prüfungsformate
Auch extrem bewegungsarme Abschlussprüfungen an Schulen oder Hochschulen in schriftlichen Formaten am PC wie lange Abschlussarbeiten, Bachelor-, Master und Doktorarbeiten könnten alternativ auch als bewegungsaktivierende(re) Formate angeboten werden, wie das Halten von Vorträgen, die im besten Fall interaktiv und gruppenaktivierend gestaltet sind, oder es könnte eine wissenschaftlich fundierte Audio-Präsentation oder Podcast-Sendung oder ein praktisches Projekt mit direkter Ausführung an einer Hochschule als Prüfungsleistung akzeptiert werden.
Eigenständiges Bewegen durch bewegungsaktivierende(re)s Mobiliar und Ausstattung
Eine wichtige Rolle dabei, welche Didaktik vorgenommen werden kann, spielt das vorhandene und genutzte Mobiliar in Lehr- und Lernräumen. Denn: In Vorlesungssälen, Seminarräumen, Bibliotheken und diversen anderen Sitzmöglichkeiten wird in den meisten Hochschulen - wie der Name es schon andeutet - hauptsächlich zum Sitzen angeregt.
Deshalb ist es wichtig, dass Studierende sich eigenständig durch bewegungsaktivierendes Mobiliar bewegen können. Dies gibt Ihnen auch Selbstständigkeit und kann das Selbstwirksamkeitserlebnis erhöhen.
Nach Rupp (2010) hat „Insbesondere der Einsatz bewegenden Mobiliars, wie das haltungsalternierende Lernen an Sitz-Stehpulten [...] das Potenzial, ein Bewegen in der Lehre lernzeitschonend mit dem Lernprozess zu synchronisieren“ (S. 21).
Bewegungsaktivierendes Mobiliar spielt eine entscheidende Rolle wenn es darum geht, mehr Bewegung in den hochschulischen Alltag zu bekommen. Stühle gehören definitiv nicht dazu. Auch wenn sie schön bequem sind denn desto höher aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Besitzer stundenlang darauf sitzen bleibt und damit die für seine Gelenke notwendige, ständige leichte Bewegung vernachlässigt und körperliche Probleme bekommt.
In dieser Masterarbeit wird unter bewegungsaktivierendem Mobiliar solches Mobiliar verstanden, welches Nutzer: innen dazu animiert, mindestens von seinem Platz aufzustehen und die Position zu wechseln, also den Körper auch wirklich aktiv in Bewegung zu bringen, und- zwar mehrmals während der Lernzeit und nicht nur als Pause.
Neben bewegungsaktivierendem Mobiliar sollte eine ergonomisch kongruente Arbeits- und Lernumwelt selbstverständlich sein. Ist Mobiliar nicht ergonomisch kongruent gebaut, wäre dies nämlich wiederum gesundheitsschädlich. Also sollte das Mobiliar in der gebauten Umwelt, wie Sitzmöbel, Treppenstufen, Greifweiten, Stuhl-, Tisch-, Fenster-, Tür- und Raumhöhen zu den körperlichen Maßen und Bewegungen passen Flade, 2008, S. 61-62). Nur dann sind sie auch komfortabel (ebd., S. 61-62).
Susanne Mayer, die das Teilprojekt „Leicht Bewegt“ als studentische Hilfskraft unterstützt beschäftigte sich etwa mit ergonomischem Arbeiten im Homeoffice (Mayer, 2021). Sie weiß: „Die Oberfläche des Tisches sollte reflexionsfrei und nicht zu kontrastreich sein, um die Augen zu schonen. Zudem sollte sie aus Kunststoff oder Holz gefertigt sein, damit man seine Unterarme gerne darauf ablegt“ (Mayer, 2021). Zudem sollte die Tischplatte ausreichend groß sein.
Sicherheit und Stabilität haben auch bei der Herstellung und Nutzung von Mobiliar höchste Priorität, weshalb unteranderem eine Gewährleistung des 90°-Winkels zwischen Oberarmen und Unterarmen gewährleistet werden sollte, um eine Anspannung der Schulterpartie zu vermeiden (Mayer, 2021).
Um sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt zu entscheiden, sollte auf Prüfsiegel geachtet werden, wie die CE-Zertifizierung, welche Mayer (2021) für obligatorisch hält, da diese aussagt, dass das Produkt die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union erfüllt (ebd.). Zudem zeige das „GS-Zeichen“ die Mindestanforderungen der elektrischen und mechanischen Sicherheit an und das Qualitätszeichen „Quality Choice“ versichere höchste Anforderungen beim Qualitätsnachweis (ebd.). Weiterhin stellen diverse DIN-Normen eine Rolle (Mayer, 2021)56
Höhenverstellbare (Steh-)tische und Stühle
Mayer (2021) sieht einen Sitz-Stehtisch als optimale Lösung, da er regelmäßige Haltungswechsel begünstige, welche elementar für die Durchblutung des Körpers seien (ebd.). Mayer (2021) empfiehlt dabei Verstell-Mechanismen durch Elektromotor oder Gasfedern, wie auch eine Verstellbarkeit zwischen 62 und 120 cm (Mayer, 2021).
Die einzustellende Größe stellt bei jedem Mobiliar ein unumgängliches Kriterium. Die Höhe sollte so einstellbar sein, dass die Unterarme flach auf der Tischplatte liegen können, ohne dass die Schultern angespannt werden müssen (ebd.). Wenn das Pult hauptsächlich für den Gebrauch des Lesens von Papierdokumenten oder des Schreibens mit der Hand gebraucht wird, wäre zudem eine Neigefunktion der Platte hilfreich (Mayer, 2021).
Die Tischplatte eines Stehpults sollte dabei nach Mayer (2021) mindestens 30 x 42 cm groß sein sollte und in der Höhe zwischen 95 und 135 cm verstellbar sein (ebd.).
Allgemein sollte darauf geachtet werden, dass sich das Stehpult in der Nähe des Hauptarbeitstisches befindet, damit es regelmäßig genutzt wird (Mayer, 2021). Schließlich sorgt ein regelmäßiges Wechseln zwischen Stand- und Spielbein für Entlastung eine der Wirbelsäule und der Gelenke (Mayer, 2021)
Eine etwas platzsparende und kostengünstigere Variante ist ein „Stehaufsatz“, der auf dem Arbeitstisch platziert und einfach zusammengefaltet werden kann, wenn er nicht gebraucht wird (Mayer, 2021).
Nach Glöckl & Breithecker (2018) sei dies zwar ein guter Ansatz doch wenn auch stehend eine statische Haltungen eingenommen wird, kann das genau so problematisch sein, denn zu langes unbewegtes Stehen ist auch nicht gerade förderlich. Die Beine können anschwellen, was auch als „Verkäuferinnen-Krankheit“ bezeichnet wird, die Bildung von Krampfadern wird begünstigt, und man wird schnell müde (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 23). Um einen signifikanten gesundheitlichen Nutzen zu erzielen, reicht das Verstellen der Schreibtischhöhe mehrmals pro Tag auch nicht aus. Ziel sollte grundsätzlich sein, einen bewegungsreichen Alltag zu haben.
Für kleine Personen gäbe es alternativ zum höhenverstellbaren Tisch die Möglichkeit, einen höhenverstellbaren Stuhl und eine Fußstütze zu verwenden, um die angestrebte Haltung einnehmen zu können (Mayer, 2021) Schließlich fördert bewegungsfördernde Ausstattung regelmäßige Haltungswechsel und reduziert gesundheitliche Risiken, welche durch lang andauerndes, ununterbrochenes Sitzen entstehe (Mayer, 2021)
Sportgeräte
Die positiven Effekte von Sportgeräten in Lernräumen zeigen bereits einige Beispiele:
Die sportbetonte OberschuleRonzelenstraßein einem Vorort Bremens macht es vor (vgl. Kuban 2020): der Sportlehrer Harald Wolf arrangierte, dass ein Sportgeräte-Hersteller, drei Heimtrainer zur Probe in einer Klasse aufstellte. Mittlerweile können hier Schüler: innen zahlreiche Ergometer mit integriertem Pult oder Laufbänder -die sich unter einer Tischplatte befinden - beim Lernen im Unterricht genutzt werden (ebd.).
Gaschler (2019) lässt in ihrem Bericht „Die Freie Universität bewegt sich“ auch den Privatdozent und Psychologen Burkhard Gusy zu Wort kommen, der das Projekt „Healthy Campus“ leitet und die „University Health Reports“ organisiert und dazu sagt: „Wir möchten erreichen, dass sich die Studierenden der Freien Universität Berlin ähnlich viel bewegen, wie es die Weltgesundheitsorganisation vorschlägt: Pro Woche zwei Stunden Ausdauersport und eine halbe Stunde Körperkrafttraining. Momentan tun das 65 Prozent der Studierenden leider nicht“ (Gaschler, 2019).
Angeregt durch eine Bachelorarbeit über lernfördernde Angebote am Lernort von Janet Wagner gibt es in der Bibliothek der Freien Universität (FU) Berlin57nun einen Ergometer (vgl. Kuban 2020). Bei Benutzung kann man durch den dadurch produzierten Strom sogar sein Handy aufladen (ebd.). Durch Wagner's Initiative wurde ein „Leserad“ in der philologischen Bibliothek aufgestellt. Janet Wagner, die auch Bibliotheksmitarbeiterin der Philologischen Bibliothek ist, organisierte dieses Fahrrad-Ergometer bei der belgischen Firma „WeWatt“ (ebd). Dies ist mit einem kleinen Bücherlesetisch ausgestattet und erzeugt Strom zum Aufladen von Handys oder Laptops. Wagner initiierte dies unteranderem auch, da sie der Meinung ist, dass die Student: innen, die viel Zeit in der Bibliothek verbringen, diese nicht nur „absitzen“ sollten (Gaschler, 2019).
Ein Student der FU Berlin beschreibt seine Erfahrungen mit dem Ergometer so, indem er betont, dass er erst einmal die Geschwindigkeit finden musste, um nebenher richtig schreiben zu können, dass es aber gerade wenn man etwas müde ist eine gute Idee sei, den Ergometer zu benutzen, um dadurch wieder aufwachen zu können (vgl. Kuban 2020). Eine Studentin sieht das Leserad als guten Anfang um dazu animiert zu werden, zwischendurch sportlich aktiv zu sein und könnte es sich vorstellen, während dem Lesen von literarischen Texten zu radeln und ein weiterer Student wünscht sich sogar weitere Räder (vgl. Gaschler 2019).58
Bodenmatten, Balance-Kissen und Balance-Boards
Da sehr langes, vor allem einförmiges, unbewegtes Stehen auf harten, ebenen Untergrund ebenso wenig zu den natürlichen Bewegungsmustern des Menschen gehören, sollte aktives dynamisches Stehen als Alternative zum aktiv dynamischen Sitzen geschehen (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 99)
Balance- Kissen und Balance-Boards, bei welchen sich angestrengt werden muss, Gleichgewicht zu bleiben, erfordert ein sich ständig selbst organisierendes, fein abgestimmtes Zusammenspiel von sensorischer Verarbeitung und angepassten muskulären Reaktionen. Um den größtmöglichen Nutzen aus den Vorteilen des Bewegungsraums zu ziehen, sollte dieser mit mindestens einer Bodenmatte bestückt sein. Die „Active Office Floor“-Matte von Glöckl und Breithecker (2018) etwa, bringt - im Gegensatz zu einem konventionellen, meist harten Fußbodenbelag- taktile und sensorischen Empfindungen, da sie spontane, komplexe Reaktionen auslöst, weil der Körper auf die in der Matte eingeschäumte dreidimensionale Struktur rea- gierteren muss (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 91).
Nudging
Mit Nudging können Menschen durch kleine pschologische Stupser dazu angeregt werden etwas zu tun. Nudging leitet sich von dem englischen „to nudge“ ab und bedeutet zu Deutsch so etwas wie „einen Stups geben, vorsichtig drängen“ bedeutet (siehe DUDEN 2022). Damit sind Gestaltungen oder Maßnahmen gemeint, durch die eine vorsichtige Einflussnahme auf politische, wirtschaftliche o. ä. Entscheidungen von Menschen vollzogen werden.
So können Treppen mit Bewegungsreizen versehen werden. Jede Stufe könnte beim Betreten einen Ton spielen und so die Tonleiter gelernt werden, oder um Zahlen oder die Konjugation eines Verbes zu lernen, müsste Stufe für Stufe hochgestiegen werden, oder würde unbewusst automatisch gelernt, da die Treppe sehr häufig genutzt würde.
Auch die Universität in Bayreuth nutzt Nudging: Hier wurde dazu ein „BeWeg“ eingeführt: Markierungen auf dem Campuspflaster zeigen den Student: innen an, wie viele Schritte sie schon zurückgelegt haben (vgl. Kuban 2020).
1.3.3.3. Das Heidelberger Modell der bewegten Lehre
Dass hochschulische Lehre in bewegten Formaten möglich sind, kann mittlerweile durch viele Beispiele und Arbeiten aufgezeigt werden. Rupp, Bucksch und Dold (2020) bieten dafür das „Heidelberger Modell der bewegten Lehre“. In der Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wurde dafür die Expertise eines Teams aus Pädagogen und Gesundheitswissenschaftler:innen eingesetzt (ebd.).
Durch das Modell kann beispielhaft aufgezeigt werden, wie Sitzzeitreduktion und Bewegungsaktivierung in der Hochschullehre umfassend und nachhaltig ein- und durchgeführt werden kann (vgl. S. 2). Rupp et al. (2020) verfolgen dabei die Idee, bewegungsorientierte Gesundheitsförderung aus der randständigen Position des Hochschulsports in das Kerngeschäft „Lehre“ von Hochschulen hereinzuholen und die sich in der Sitzlehre manifestierende Trennung von Geist und Körper in der hochschulischen Bildung zu überwinden. (Rupp et al., 2020, S. 16). Mit ihrem Modell zeigen sie dabei Möglichkeiten auf, wie Bewegung mit dem hochschulische Lehr- -Lernprozess verknüpft werden kann, ohne dabei dessen inhaltlichen Ablauf zeitlich zu belasten. Dazu werden einfache Alltagsaktivitäten wie (Auf-)Stehen und (Umher-) Gehen fokussiert (Rupp et al., 2020, S. 16-17).
Das Modell wurde anhand von fünf Praxisbausteinen konkretisiert, die dem Heidelberger Modell der bewegten Lehre als Bausteine komponiert wurden, die für sich stehen, aber jeweils in größere Zusammenhänge eingebettet sind. Umgeben werden sie von den Lebenswelten des Studierens und Arbeitens, auf die sie - über die Hochschullehre hinaus - bewegungsförderlich einwirken. Gleichzeitig beeinflussen diese Lebenswelten in umgekehrter Wirkrichtung aber auch deren Umsetzung. (Rupp et al., 2020, S. 18-19). Diese Praxisbausteine werden im Folgenden vorgestellt:
Bewegende Methoden
Ein wichtiger Baustein sind „Bewegende Methoden“, die von Lehrenden in Veranstaltungen angewandt und Studierenden Gelegenheiten geben können, die starre Sitzordnung und - haltung im Lehrraum aufzugeben und sich stattdessen bewegen zu können (vgl. Rupp et al. 2020, S. 19). Mit den angestrebten bewegenden Methoden können Lehre und Bewegung zeitgleich ausgeführt und lernzeitschonend miteinander verknüpft werden (ebd.). Weiterhin besteht die Möglichkeit dies studienfachübergreifend auszuführen, da zwar ein methodischer, aber kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Bewegung und dem Lehr- oder Lerngegenstand vorhanden ist (Rupp et al. 2020, S. 20).
Beispiele für bewegende Methoden können Punktabfragen auf Pinnwänden sein, z. B. als Feedback zur aktuellen Lehreinheit, Menschen außerhalb des Lehrraums zu interviewen, Arbeitsergebnisse durch Wandzeitungen zu sichern, oder auch Podcast Walks im Freien durchzuführen (Rupp et al. 2020, S. 19).
Die bewegende Methode des „Podcast Walks“ etwa, lehnt sich an der bereits vorgestellten Methode des „Walk and Talk“ an. Bei „Podcast Walks“ wird auch mit didaktisierten (Audio-) Podcasts, die von Lehrenden oder Studierenden mit dem Ziel der Wissensvermittlung, - wiederholung oder -überprüfung niederschwellig erstellt werden (Rupp et al. 2020, S. 25). Diese werden auf einer Lernplattform der Hochschule als mp3-Dateien hochgeladen, daran anknüpfend kann ein Spazieren der Studierenden gemeinsam mit dem/der Lehrenden als Gruppe 15 bis 20 min außerhalb des Hochschulgebäudes erfolgen, wobei der Podcast angehört wird (ebd.). Dies kann beispielsweise als einleitendes Impulsreferat zu Beginn einer neuen Lehreinheit genutzt werden. (Rupp et al., 2020, S. 25)
Bewegendes Lehrangebot
Als zweiter Baustein beinhaltet das Modell „curricular verankerte Studienangebote, in denen Studierende Möglichkeiten einer gezielten Bewegungsförderung für studiengang-spezifische Settings und Anwendungsfelder nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern diese im Lehrkontext auch praktisch umsetzen und erproben.“ (Rupp et al. 2020, S. 20)
Ein Beispiel hierfür ist das Modul „Bewegungsaktivierende Schul- und Unterrichtsgestaltung“, kurz BSU, an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Rupp et al. 2020, S. 20 & 26-27). In diesem Modul erwerben Studierende unteranderem Kompetenzen, um das Thema „Bewegung“ lernwirksam und gesundheitsfördernd in späteren berufsbezogenen Situationen wie dem eigenen Studienalltag einzubringen (ebd., S. 20). Außerdem werden, auf theoretischen Erkenntissen beruhend, praxisnahe Situationen aufgezeigt und erprobt, die den Studierenden einen unmittelbaren Praxistransfer ermöglichen (Rupp et al., 2020, S. 26)
Gerade bei Lehramtsstudent: innen liegt den Angeboten ein großes Multiplikationspotenzial zugrunde, da die Studierenden mit ziemlicher Sicherheit später in leitenden und edukativen Positionen zu finden sind, in denen sie nicht nur beruflich entscheiden, wie sie Lernräume nutzen und gestalten, sondern auch als Vorbilder das Gesundheits- und Sitzverhalten anderer Bevölkerungsgruppen beeinflussen (vgl. Rupp et al. 2020, S. 20).
Bewegungsfreundliche Lehrräume
Als wichtiger dritter Baustein zählt zu dem Modell die Lehrraumgestaltung in eine bewe- gungsaktivierend(er)en Richtung, denn: „[d]ie derzeitigen Lehrraumeinrichtungen lassen insbesondere durch die verwendeten Tische und Stühle kaum Bewegung zur Erfüllung des menschlichen Bewegungsbedürfnisses zu.“ (Rupp et al. 2020, S. 21).
Rupp et al. (2020) betonen die Wichtigkeit, „auch die alltägliche Arbeitsumgebung von Studierenden und Lehrenden bewegungsförderlicher zu gestalten“ was etwa durch eine bewegungsfreundliche Raumaufteilung, den Einsatz bewegenden Mobiliars wie rollbare SitzStehpulte, durch die Einbeziehung der Raumwände als Arbeitsflächen für Studierende, oder durch die Einrichtung von Außenseminarräumen mit großzügigem Bewegungsraum geschehen kann (Rupp et al. 2020, S. 21).
Bewegende Weiterbildungen
Damit die Innovation einer bewegten Lehre gelingt, gehören zu dem Modell auch „Bewegende Weiterbildungen“, da es wichtig ist, „Wissen, Sensibilität und Akzeptanz Dozierender für bewegungsaktivierende Maßnahmen zu stärken und sie zugleich in die Lage zu versetzen, diese kompetent in der eigenen Lehre zu realisieren“ (Rupp et al. 2020, S. 22). Durch etwa hochschulinterne Weiterbildungen zu Grundlagen bewegter Lehre, oder hochschuldidaktische Inhouse-Angebote für interessierte Fachabteilungen, Institute oder Fakultäten, könnte dies erfolgen, wie auch durch bewegte Tagungen mit wissensvermittelnden Vorträgen und kompetenzvermittelnden Workshops zur Umsetzung einer bewegten Lehre und dementsprechend gestalteten Video-Tutorials (Rupp et al., 2020, S. 22).
Bewegungspause
Einen zusätzlichen Baustein stellt „Die Bewegungspause“, welche als eine Unterbrechung der Lehre zugunsten einer kurzzeitigen (meist fünf- bis zehnminütigen) Bewegungseinheit gesehen werden kann (ebd., S. 22). Individuell können durch eine Bewegungspause Auflockerungen, Dehnungen, Entspannungen oder Konzentrationsförderungen verfolgt werden. Die Bewegungspause wird jedoch eher ergänzend zu unserer Grundidee einer lernzeitschonenden Verknüpfung und Synchronisation von Lehr-Lernprozessen gesehen- ihr wohnt deshalb eher eine untergeordnete Rolle inne (Rupp et al., 2020, S. 22-23).
1.4. Zwischenfazit theoretische Hinführung
In der theoretischen Hinführung dieser Arbeit wurde gezeigt, dass aktuell in den industrialisierten Ländern eine gesellschaftliche Entwicklung zur Bewegungsarmut vorherrscht, die unteranderem mit fortschreitenden technischen Entwicklungen zusammenhängt. Gesehen werden kann dabei aber auch eine Hinwendung zu mehr Mobilität, welche als wahrgenommene Chance viele Vorteile auch in Bildungskontexten bringt.
Weiterhin wurde festgestellt, dass das Konzept eines Lernraumes nicht immer haarscharf von dem eines Lehrraumes zu trennen ist und über einen bestimmten Innenraum hinausgedacht werden kann. Durch die Beschäftigung mit einer architekturpsychologischen Perspektive wurde gesehen, dass gebaute Umwelten je nach der Art der Gestaltung psychologische Effekte auf Menschen haben, wie auf die Emotionen, die mit der Umwelt verbunden werden und den Grad der möglichen Aneignung einer Umwelt. Zusätzlich wird auch gezeigt, dass Umwelten individuell unterschiedlich wahrgenommen werden können. Durch die Sichtbarmachung einer soziologischen Perspektive wurde deutlich, dass die Raumstruktur beeinflusst, wie gehandelt wird und menschliches Handeln in Wechselwirkung zu der zur Verfügung stehenden Raumstruktur und Mobiliar steht. Anhand eines pädagogischen Blickes auf die Thematik wurde erkannt, dass die Raumgestaltung in Bildungsinstitutionen beeinflusst, welche Didaktik vorgenommen werden kann oder wird. Dabei wurden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt, die unteranderem auch Bewegungsanreize enthalten, wie das Kabinettsystem oder das Resonanzmodell. Dem anschließend wurden sich Erkenntnisse der Erwachsenenbildung gewidmet und festgestellt, dass auch dort Architektur und Raumstrukturen einen Einfluss auf hochschulische Didaktik haben und es einer zukunftsorientierteren Gestaltung dieser bedarf.
Überdies wurde anhand zahlreicher Erkenntnisse und Studien aufgezeigt, welche Schäden Bewegungsarmut und welche positiven Auswirkungen Bewegung auf den Körper hat. Es wurde gesehen, welche Schäden zu wenig Bewegung auf den muskulären Bewegungsapparat hat, dass die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird und die Wahrscheinlichkeit zu erkranken erhöht. Gleichzeitig konnte die Tendenz einer Bewegungsarmut in Bildungssystemen aufgezeigt werden. Daran anschließend wurde eine Betrachtung der gesundheitlich vorteilhaften Einflüsse von Bewegung vorgenommen und festgestellt, dass durch Bewegungsaktivität kognitive Leistungen verbessert werden können, Stress reduziert, das soziale Miteinander fördert, allgemein ein Einfluss auf Emotionen belegbar ist und der Förderung einer positiven Stimmung.
In Hinsicht dieser Erkenntnisse wurde die Notwendigkeit einer bewegungsaktivierenden Didaktik auch für den hochschulischen Kontext erörtert. Dabei wurden zwei Ansätze vorgestellt, wobei besonders die Kombination von Lernen und Bewegung wurde als sehr gewinnbringend gezeigt wurde, da Körper und Geist dabei einheitlich zusammenarbeiten und nicht getrennt voneinander. Im Rahmen dessen wurde bewegungsaktivierend(er)es Mobiliar und Ausstattung wie Ergometer und höhenverstellbare Tische, wie auch bewegungsaktivierend(er)e Methoden wie „Walk and Talk“, theaterpädagogische Möglichkeiten und andere, die zahlreiche Chancen bieten, sich während des Lernens zu bewegen und als Lehr- und Lernformate zu mehr Leistungsfähigkeit, weniger körperlichen Beschwerden und einem gesünderen Studieren beizutragen. Für den Hochschulkontext eröffnet das Heidelberger Modell der bewegten Lehre dabei ein gutes Grundgerüst, an welchem sich für die Gestaltung einer bewegungsaktivieren- de(re)n Lehre orientiert werden kann.
Es zeigten sich jedoch auch Grenzen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von Lehr- und Lernräumen. So wurde anhand der architekturpsychologischen Perspektive festgestellt, dass nicht jede:r das gleiche Bedürfnis an Umwelten hat und es deshalb oft schwer ist, alle Bedürfnisse mit einer architektonischen Gestaltung einzufangen (siehe Kapitel 1.2.2.1. ). Dahingehend wurden Hürden bei architektonischen Neugestaltungen und Umbauten gesehen, wie Rahmenbedingungen und Vorgaben, aber auch fehlende Kommunikationsmöglichkeiten aller Akteur:innen (ebd.). Bei der wissenschaftlichen Untermauerung von empirischen Untersuchungsergebnissen zu den Effekten von Bewegung auf Lernen wurden vor allem Grenzen der Belege bezüglich Bewegungspausen und Bewegungszeiten und einer Didaktik festgestellt, die eine Trennung von Bewegung und Lernen vorsieht (Kapitel 1.3.3.1.).
Den theoretischen wie Erkenntnissen dieser Arbeit nach zu schließen, bringt es mehr Chancen als Grenzen mit sich, abwechslungsreiche Bewegungsmuster in den Studienalltag einer Hochschule zu integrieren und dabei flexiblere und bewegungsaktivierend(er)e Lehr- und Lernräume zu gestalten.
2. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
Im empirischen Teil dieser Arbeit wird ein Praxisbezug vorgenommen. Zuallererst wird in Kapitel 2.1. über den Vorgang der Entwicklung der Forschungsfrage beschrieben und welches zugrundeliegende Forschungsinteresse dazu führte, möglichst realitätsnahe Aussagen über soziale Sachverhalte treffen zu wollen und sich damit für ein qualitatives Forschungsdesign zu entscheiden. Mit der Beschreibung des Forschungsdesigns in Kapitel 2.2. wird die Datenerhebung anhand von Expert:innen-Interviews anhand der genauen Beschreibung der Interviewforschung wie des Samplings dargelegt und beschrieben, wie anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurde. Mit dem Kapitel 2.3 werden abschließend die Ergebnisse näher erläutert.
2.1. Entwicklung der Forschungsfrage
2.1.1. Forschungsinteresse
Das Forschungsinteresse dieser Arbeit entstand durch die Teilnahme an dem von Prof. Dr. Isolde Rehm initiierten SeminarLernräume gestaltenan der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg im Wintersemester 2020-2021. Dadurch entstand ein Vorverständnis der Thematik der Lernraumgestaltung59, welches durch diese Forschungsarbeit vertieft werden wollte.
Dabei wurden wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen über zu wenig Bewegung in Lernräumen kennengelernt (Glöckl, J. & Breithecker, 2018; Dordel & Breithecker, 2003), wie der Unterschätzung von Lernraumgestaltung auf Lehre und Lernen in der Bedeutung für die Bildung (vgl. Kahl, 2009). Diese nebst eigenen Erfahrungen über unzureichend gestalteten Lernräume in Bildungseinrichtungen, welche den Bedürfnissen der Akteur:innen nicht ausreichend nachkommen, führte dazu, dass die Wichtigkeit der Thematik erkannt wurde und eine Forschungslücke für die genannten Aspekte im Hochschulkontext wahrgenommen wurde. Als Problemstellung wurden vier Erkenntnisse notiert:
1. Die Wechselwirkung von Lernraumgestaltung und menschlichem Handeln wie pädagogischen Prozessen in Bildungsinstitutionen bisher unterschätzt wurde und braucht deshalb mehr Aufmerksamkeit und Forschung.
2. In Lernräumen wird eine zu bewegungsarme Verhaltensweise der Akteur:innen eingenommen, die zu Gesundheitsschäden führen kann.
3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht ein Zusammenhang von Lernraumgestaltung und bewegungsarmer oder bewegungsreicher Didaktik.
4. Akteur:innen und Nutzer:innen erfahren viel zu wenig Partizipation in der Lernraumgestaltung
Daraus ergaben sich den ersten Überlegungen nach, folgende leitende Fragen, die im Rahmen einer Forschung beantwortet werden wollten:
-Sind Nutzerinnen ausreichend in die Gestaltung von Lernräumen miteingebunden?
-Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es allgemein?
-Wie können Lernräume gestaltet werden, damit mehr Bewegung in einen Schuloder Studienalltag kommt?
-Inwiefern spielt die Didaktik dabei eine Rolle?
Zu Beginn des Forschungsprozesses für die vorliegende Masterarbeit wurde Literatur recherchiert und sich in die Thematik eingelesen. Dabei wurde festgestellt, dass bezüglich der Lernraumgestaltung bereits einige Forschung für den schulischen Kontext vorliegt, jedoch geringe Hochschulkontext betreffend. Aufgrund dieser erkannten Forschungslücke und der im Rahmen einer Masterarbeit notwendigen Limitation und Fokussierung, wurde sich nicht auf die gesamten Bildungskontexte, sondern vorrangig auf den Hochschulkontext konzentriert. Als erste Idee stand, die Meinung von verschiedenen Expert: innen zu der forschungsleitenden Frage „(Inwiefern) kann die Gestaltung von Lehr- und Lernräumen in Hochschulen zu gesundheitsförderlichem Studieren beitragen?“ einzuholen. Im Laufe eines zirkulären Forschungsprozesses, welcher für die qualitative Forschung üblich ist, wurde festgestellt, dass die Ausrichtung auf Gesundheit zu weit und zu groß gefasst ist, da der Begriff Gesundheit zahlreiche Aspekte umfasst und sich deshalb auf Studierende fokussiert. Es wurde deshalb zuallererst überlegt, sich auf die an der Pädagogischen Hochschule zu diesem Zeitpunkt gerade im Bauungsprozesse befindlichen Außenlernräume zu beschränken. Eine Koordinatorin und Organisatorin eines neuen Außenlernraumes an der Pädagogischen Hochschule war in dem Seminar als Gast aufgetreten und hatte deshalb bei der Forschenden die Neugierde geweckt, folgender Frage nachzugehen:
- Welche Chancen und Grenzen bieten Außenlernräume für die Bedürfnisse Studierender?
Der Autorin dieser Arbeit war jedoch wichtig, auch die Lernraumgestaltung in Innenräumen zu betrachten und so wurde die Forschungsfrage konketitisert zu:
„Welche Chancen und Grenzen ergeben sich aus einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen für Studierende?“
Mit der Formulierung der Fragestellung ist die methodologische Positionierung eng verbunden. Im Folgenden wird diese konkretisiert.
2.1.2. Kriterien qualitativer Forschung
Qualitative Forschung zeichnet sich besonders durch eine Offenheit und Zirkularität im Forschungsprozess aus.
Qualitative Forschung ist demnach offen für das Neue im Untersuchten und das Unbekannte im scheinbar Bekannten (Flick et al. 2016, S. 17). Dabei zeichnet sich qualitative Forschung gerade dadurch aus, dass sie ihre Fragestellungen, Konzepte und Instrumente in Interaktion mit dem Forschungsfeld immer wieder überprüft und anpasst (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 109). So ist nämlich der qualitative Forschungsprozess im Gegensatz zu dem linearen in der quantitativen Forschung ein zirkulärer (Flick 2016, 128)
Da qualitative Forschung den Anspruch erhebt, Lebenswelten von innen heraus aus der Sicht von den handelnden Menschen zu beschreiben und mit quantitativen Verfahren unteranderem subjektive Wirklichkeitskonstruktionen und deren Verankerungen in kulturellen Selbstverständlichkeiten und Praktiken in lokalen und organisationsgeprägten Milieus beschrieben werden (vgl. S. 14-21), wurde sich für ein qualitatives Verfahren entschieden.
Denn: das Forschungsinteresse lag darin, die hochschulische Lebenswelt von innen heraus aus der Sicht der dort handelnden Menschen, also den Studierenden, zu beschreiben und die kulturellen Selbstverständlichkeiten und sozialen Praktiken, die mit der Lernraumgestaltung zusammenhängen in dem organisationsgeprägtem Mileu einer Hochschule zu beschreiben. Für die Beantwortung der Forschungsfrage ergab sich, die subjektiven Sichtweisen von Studierenden und die sozialen Praktiken im Hochschulkontext an den Studierenden als Einzelfälle zu erforschen.
Auf Grundlage des Forschungsinteresses sollten Phänomene untersucht werden, um Aussagen über sozialen Sachverhalte treffen zu können (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 116). Auf jene Weise kann die hier vorliegende Arbeit zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen. Letztlich will qualitative Forschung sich wandelnde subjektive Wahrheit und soziale Sinnstrukturen rekonstruieren und nicht Wirklichkeit einfach abbilden (vgl. Helfferich, 2014, S. 670). Vielmehr wird „das Fremde oder von der Norm Abweichende und das Unerwartete als Erkenntnisquelle und Spiegel“ gesehen und durch Reflexion das Unbekannte im Bekannten und Bekanntes im Unbekannten als Differenz wahrnehmbar gemacht (vgl. Flick et al. 2016, S. 14). So erschien für diese Arbeit ein solch „offeneres“ Vorgehenskonzept im Rahmen der Befragung von Menschen als sinnvoller im Sinne einer ebenso offenen Erkenntnisgenese.60
Steinke (2007) schlägt Kernkriterien zur Bewertung qualitativer Forschung vor61, an welchen sich in dieser Arbeit orientiert wurde. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Kriterien und Prüfverfahren jeweils untersuchungsspezifisch unter Berücksichtigung der jeweiligen Fragestellung, Methode, der Spezifik des Forschungsfelds und des Untersuchungsgegenstandes betrachtet werden sollten und gegebenfalls ergänzt werden müssen (ebd., S. 323-324). Einige davon waren für diese Forschungsarbeit leitend. Es wurde etwa auf die intersubjektive Nachvollziehbarkeit geachtet, was beinhaltet, dass eine Dokumentation des Forschungsprozesses vorgenommen wurde (vgl. ebd., S. 324), die Dokumentation des Vorverständnisses beinhaltet, der Erhebungsmethoden, der Transkriptionsregeln, der Daten, sowie der Auswertungsmethoden und Informationsquellen (S. 324-325).
Eine Interpretation in Gruppen konnte nicht vorgenommen werden, aber es wurde das methodische Vorgehen durch eine systematische Analyse mit der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse und der damit einhergehenden Kodierungsprozesse vereinheitlicht bzw. durch die Einsicht der Lesenden über die Vorgänge in etwa MAXQDA sichtbar gemacht. Zusätzlich wurde eine empirische Verankerung vorgenommen und in Kapitel 2.4 wird eine Reflexion und die Limitation dieser Arbeit beschrieben.
2.2. Forschungsdesign
2.2.1. Datenerhebung
Als Erhebungsinstrument wurde für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Masterarbeit die Durchführung von Interviews gewählt. Es wurde sich für die Interviewform der Expert: innen -Interviews entschieden, da diese Interviewform am geeignetsten für die Beantwortung der Forschungsfrage erscheint.
Expert:innen-Interviews
Das Besondere bei Expert:innen-Interviews ist nach Kruse (2014) weniger die methodische Form der Durchführung als die Zielgruppe: nämlich Expert:innen (S. 166). Hierbei können verschiedene Personen Expert: innen sein (ebd.). Nach Pickel et al. (2009) ergibt sich der Expert: innen-Status aus dem Vorrangwissen über bestimmte Handlungsabläufe und Organisationsstrukturen und nicht aus dem hierarchischen Status der Person heraus (Pickel et al., 2009, S. 441) Das Expert:inneninterview bietet eine gute und breite Informationsquelle über standardisiert nicht fassbare Themen und komplexe Entscheidungsprozesse (vgl. ebd., S.451). Pickel et al. beschreiben, wie es gutes Gespräch zu einem Themenbereich mit jemanden, der sich darin auskennt, sehr hilfreich als eine Form der Informationsgewinnung und dadurch zum Erkenntnisgewinn von Forschern beitragen kann (Pickel et al., 2009, S. 451).
Das Expert: innen-interview ist eines der am häufigsten eingesetzten Verfahren in der empirischen Sozialforschung und wird sehr oft in der industriesoziologischen Forschung, der Organisationsforschung, der Bildungsforschung und der Politikforschung verwendet (Meuser &
Nagel in: Pickel et al., 2009, S. 453). Akteur:innen qualifizieren sich demnach als Expert: innen durch ein Sonderwissen, weil sie über einen privilegierten Zugang zu Informationen verfügen" (ebd., S. 456).
Sampling
Die Entscheidung welche Erhebungseinheiten für die Forschung genutzt werden sollen, ist eng verbunden mit der Frage, worüber man Aussagen zu treffen beabsichtigt, in welche Richtung also eine spätere Generalisierung (oder Theoretisierung) möglich ist (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 114). Das Sampling ist in qualitativen Untersuchungen sinnvollerweise nicht bereits in einem ersten Untersuchungsschritt abzuschließen. Unter Umständen wird auch in späteren Untersuchungsphasen noch einmal Material erhoben, um die Varianten, die man in einem Sample erfasst, zu vervollständigen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 115). Anders als beim Sampling in standardisierten Untersuchungen versucht man in qualitativen Verfahren nicht, ein verkleinertes Abbild der Verteilung in einer Grundgesamtheit zu erreichen, sondern die Vielfalt der in einem Untersuchungsfeld vorhandenen Konstellationen zu erfassen und unterschiedliche Mechanismen auf ihre Bedingungen und Wirkungen hin zu befragen. Die Frage zu beantworten, wie häufig ein Zusammenhang auftritt und ob er mit größerer Wahrscheinlichkeit im Kontext A oder B auftritt, bliebe dann anderen Methoden vorbehalten.
Zuerst wurde als Sampling fokussiert, wissenschaftliche Expertise im Bereich des Gesundheitswesens oder der Hochschullehre zu finden, etwa erfahrene Lehrende oder Mitarbeitende, die bezüglich der Thematik schon publiziert haben. Im Laufe des Forschungsprozesses wurde sich dafür entschieden, sich auf Studierende als Expert: innen der Lern- und Lehrraumgestaltung festzulegen. Dies nicht nur weil sie eine lange Schulbildung hinter sich haben und deshalb eine sehr lange Zeit die Auswirkungen von Lehr- Lernraumgestaltungen gespürt haben, sondern die Thematik, auf die sich in dieser Masterarbeit fokussiert wurde, nämlich der Hochschulkontext, für sie ein alltägliches Erleben sind, in dem sie sich auskennen.
Überdies wurden als bewusst hauptsächlich Lehramtsstudent: innen ausgewählt, da diese wiederum als zukünftige Multiplikator: innen einen Einfluss auf die Lehr- und Lernraumgestaltung an Schulen nehmen und wie bewegungsaktivierend diese sein wird. Die pädagogische Expertise bei und nach einem Studium mit zahlreichen soziologischen, psychologischen und vor allem pädagogischen Inhalten schließt sich dem an.
Um diese größtmögliche Vielfalt, eine größtmögliche Abdeckung unterschiedlichster Perspektiven der individuellen Studierenden mit ihren Eigenschaften und Lebenssituationen, wie Expertisen trotz eines Samplings von sieben Interviewpartner:innen abzudecken, wurde darauf geachtet, vielfältige, unterschiedliche Probanden der Studierenden, neben der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, zu befragen.
So wurden Probanden mit unterschiedlichem Geschlecht gewählt, abgesehen von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule wurden zwei männliche Probanden und vier weibliche Probandinnen gewählt. Zusätzlich wurden Studierende der Pädagogischen Hochschule mit unterschiedlichen Studiengängen gewählt. An der Pädagogischen Hochschule können neben Studiengängen mit Lehramtsoption beispielweise auch Studiengänge für die Bereiche Erziehungswissenschaften oder auch Bildungswissenschaften genannt, Gesundheitspädagogik oder auch Medienpädagogik und mehr studiert werden. Zwei interviewte Personen studierten zu dem Zeitpunkt der Befragung Bildungswissenschaften ohne Lehramtsoption im Master. Dabei handelt es sich um einen Student und eine Studentin, die ebenfalls pädagogische Expertise mitbringen. Die Studentin hat vorher den Bachelor für Lehramt abgeschlossen und sich dann für den Master in Erziehungswissenschaften entschieden. Da jedoch die Wichtigkeit von dem späteren großen Einflusses von Studierenden in Lehrberufen auf die Lernraumgestaltung als Multiplikator:innen gesehen wurde, wurde sich mit vier Lehramts- Absolvent:innen auf diesen Bereich fokussiert, während zwei Studierende Bildungswissenschaften im Master studierten. Innerhalb des Bereiches Lehramt wurde dann nochmal aus jeder an der Pädagogischen Hochschule möglichen Schulart gewählt, so wurde eine Absolventin im Bereich der Sonderpädagogik, ein Absolvent der Sekundarstufe I und eine Absolventin der Primarstufe gesucht und gefunden. Dabei wurde noch darauf geachtet, Studierende aus verschiedenen Semestern oder an verschiedenen Punkten in ihrem Studium auszuwählen, was geglückt ist: Ein Studierender befand sich im 3. Master- Semester, eine Studentin im 1. Master-Semester und eine andere Studentin im 5. Master-Semester, während es sich bei den anderen um Absolvent:innen handelte, die allerdings erst gerade seit ein paar wenigen Wochen (Februar 2022) mit dem Referendariat begonnen hatten.
Auch bei dem Alter wurde auf Vielfalt geachtet. Durch die erste Sampling-Auswahl mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin war automatisch ein höheres Alter als der Studierenden oder Absolventen dabei, doch auch bei den anderen sechs Probanden unterschied sich das Alter zum Zeitpunkt der Befragung: Die jüngste war 22 Jahre alt, der älteste 28 Jahre.
Darüber hinaus konnten Aspekte der Inklusion mit dem Sampling erfasst werden, da ein Studierender Rollstuhlfahrer ist. Er kann zwar selten auch mal aufstehen und stehen ist aber die meiste Zeit im Alltag auf seinen Rollstuhl angewiesen.
Gesprächsführung
Die Interviews wurden im Angesicht der pandemischen Lage alle online über die Platformenzoomoderskypegeführt, aufgenommen und als mp3 Format umgewandelt. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 45 bis 55 Minuten. Die interviewten Personen erhielten eine Datenschutzerklärung, die sie unterschreiben mussten, in der festgelegt wird, dass sensible Daten, die Rückschlüsse auf ihre Person erlauben würden, anonymisiert werden und sechs Monate nach der Fertigstellung der Masterarbeit alle Daten, inklusive der aufgenommenen Interviews, gelöscht werden.
Es wurde also eine Interview- bzw. Gesprächsführungs-Haltung eingenommen, die nicht zu direktiv, also nicht zu steuernd oder strukturierend ist. Während der echten, kommunikativen Situation eines qualitativen Interviews passieren oft zahlreiche und folgenreiche Strukturierungsprozesse und Strukturierungserwartungen (vgl. Kruse, 2014, S. 148). Es wurde darauf geachtet, den Befragten so viel offenen Raum wie möglich zu geben, damit diese so umfangreich wie möglich „ohne fremdgesteuerte Strukturierungsleistungen und theoretische Vorannahmen [...] ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen verbalisieren können“ (Kruse, 2014, S. 148). Deshalb wurde auf die Antworten der interviewten Personen individuell eingegangen. Es wurden Leitfragen im Voraus erstellt, die in Blöcke unterteilt wurden und immer jeweils auch konkrete Nachfragen enthielten.
So war die erste Leitfrage etwa „Wo studierst und lernst du?“. Dafür wurden konkrete Nachfragen erstellt wie „Welcher Ort oder Raum kommt dir spontan in den Sinn, wenn du an einen „Lernraum“ denkst?“, oder „Wo würdest du dich zum Beispiel für eine Prüfung vorbereiten?“, „Kann man in einem Lernraum auch lehren oder würdest du einen Lernraum von einem Lehrraum unterscheiden?“ Die Leitfragen wurden immer gestellt, jedoch wurden die konkreten Nachfragen der Gesprächsdynamik angepasst.
Während bei etwa der ersten Leitfrage beispielsweise die konkreten Nachfragen immer gepasst haben und auch gestellt wurden, musste bei dem fünften Block, also der fünften Frage „Wo an der Pädagogischen Hochschule verbindest du Lernaktivitäten mit Bewegung?“ sehr oft individuell angepasst werden, welche konkreten Nachfragen noch zu der Gesprächsdynamik passen, da für manche Interview-Partner:innen die Thematik Bewegung eben in der Hochschullehre so gut wie nie präsent war und deshalb auch nicht etwa mit „Hast du an der Pädagogischen Hochschule bereits Bewegungsaktivierungen in Seminaren kennengelernt? [...] In Vorlesungen? [...] Bewegst du dich während Vorlesungen oder Seminaren? [...] Wenn ja: Wie sieht die Bewegung aus? [...] Stehst du manchmal auf?“ weiter vertieft.
Zusätzlich gab es Fragen für jeden Block, welche die Gesprächsdynamik aufrecht erhielten, wie „Kannst du das genauer beschreiben?“, „Hast du dafür noch weitere Beispiele?“, die auch individuell passend eingesetzt wurden.62
Leitfaden Studierende und Absolvent:innen
Der Leitfaden für die Studierenden setzt sich aus sieben Fragen bzw. Blöcken zusammen. Da die absolvierten Studierenden erst seit wenigen Wochen nicht mehr offiziell als Studierende galten und aus der Studierenden-Sicht berichten, werden sie bei der folgenden Nennung von Studierenden automatisch miteinbezogen.
Mit jeder Frage wurden bestimmte inhaltliche Aspekte anvisiert, die durch diese herausgefunden werden sollten. Es wurde sich bei der Erstellung des Interviewleitfadens zwar an die Grundprinzipien von Kruse (2014) orientiert und daran anlehnend wurden für den InterviewLeitfaden konkrete Fragen hinsichtlich eines spezifischen Themas formuliert (vgl. Kruse, 2014, S. 166), jedoch wurde darauf geachtet, den Expert:innen durch das Stellen von offenen Fragen so viel Raum wie möglich zu geben, um so viel Inneinsicht wie möglich zu erhalten und den interviewten Personen nicht das Gefühl zu geben, dass eine bestimmte Antwort erwartet wird.
Bei demersten Frage-Blockhandelt es sich um eine Einstiegsfrage mit einem offenen Stimulus: „Wo studierst und lernst du?“. Die inhaltlichen Aspekte, die mit dieser Frage abgedeckt werden sollten, waren etwa eine Student:innen oder Absolvent:innen-Sicht und ein gemeinsamer Konsens des Begriffs-Verständnisses Lehr- oder Lernräume zu finden.
Auch derzweite Frage-Blockbeginnt mit einem offenen Stimulus: „Wenn du an einen typischen Lernraum an der Pädagogischen Hochschule denkst, wie sieht dieser aus?“ Die inhaltli- chen Aspekte, die mit dieser Frage abgedeckt werden sollten, waren Nut- zer:innenperspektiven von der Vorstellung davon, was unter dem Konstrukt „Lernraum“ verstanden wird. Zudem wurde durch Nachfragen anvisiert herauszufinden, welches Mobiliar dabei eine Rolle spielt, wie eine Einschätzung von Studierenden bezüglich des Handlungsbedarfs bei der Raumgestaltung an der pädagogischen Hochschule.
Der offene Stimulus „In welchen Lernräumen studierst du gerne?“ der für dendritten Blockgestellt wurde, zielte auf inhaltliche Aspekte der Präferenzen von Lernorten und -räumen bei Student:innen. Durch konkrete Nachfragen sollte die Aufenthaltsdauer der (ehemaligen) Stu- dent:innen in Lernräumen, wie die Relevanz bestimmter Lernräume und oder der Einfluss des Mobiliars dabei herausgehört werden.
Block 4beinhaltete die indirekte Frage „Wie ist deine Meinung zu dem für dich zur Verfügung stehenden Mobiliar in Lernräumen an der pädagogischen Hochschule?“. Die inhaltlichen Aspekte, die mit dieser Frage abgedeckt werden sollten, waren die subjektiven Relevanzen der Student:innen bezüglich des Mobiliars. Durch konkrete Nachfragen wollte die Studie- renden-Meinung(en) oder Einschätzungen welchen Einfluss das Mobiliars darauf hat, inwiefern sedentäres Verhalten dominierend vorgenommen wird, eingeholt werden.
Mit demfünften Blockbzw. der fünften Frage als offenen Stimulus „Wo an der Pädagogischen Hochschule verbindest du Lernaktivitäten mit Bewegung?“ sollten Erfahrungswerte von Studierenden herausgehört werden, ob und wie ein sedentäres Verhalten und bewegungsarmes oder bewegungsaktivierendes und bewegtes Studieren an der Hochschule in Veranstaltungen vorherrscht. Zusätzlich sollte durch konkretes Nachfragen eine StudierendenMeinung- oder -Einschätzung eingeholt werden, inwiefern die Raumgestaltung zu bewegungsaktivierendem und gesundheitsförderndem Lehren und Lernen beitragen kann. Außerdem wurde anvisiert, eventuell vorhandene Erkenntnisse von Schäden und Folgen von zu langem Sitzen einzuholen.
Auch dersechste Blockbeginnt mit einem offenen Stimulus: „Kennst du Außenlernräume an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg?“. Dabei sollten inhaltliche Aspekte abgedeckt werden, wie Außenlernräumen bei Studierenden ankommen und inwieweit Außenlernräume genutzt werden. Durch konkrete Nachfragen sollte herausgefunden werden, welches Potenzial aber auch Grenzen Außenlernräume haben und unter welchen Voraussetzungen welche Potenziale oder Grenzen entstehen.
Der Abschluss des Interviews wurde mit derletzten und siebten Fragevorgesehen, die eine hypothetische Frage stellt: „Wie würdest du dich für das Thema Lernraumgestaltung engagieren?“ Anvisierte inhaltliche Aspekte sind dabei mögliches Engagement der Studierenden und der Grad des Partizipationsbedürfnisses, wie eine Student: innen- (Ein-)-Sicht auf optimale Lehr- und Lernbedingungen, dass noch nicht erwähntes sichtbar wird, Präferenzen der Studentin oder des Studenten, wie subjektive Einstellungen und Erfahrungen zu Partizipation bei der Raumgestaltung an Hochschulen und welche Akteur:innen miteinbezogen werden sollten.
Leitfaden Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Das Interview mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule wurde mit demersten Frage-Blockmit einem offenen Stimulus „Was verstehen Sie unter einem Lehr- oder Lernraum?“ gestartet, wobei bezüglich der inhaltlichen Aspekte intendiert wurde, eine Begriffsbestimmung zu erreichen und durch konkretes Nachfragen herauszufinden ob aus Expertensicht eine Trennschärfe von Lehr- im Vergleich zu Lernraum besteht. Für denzweiten Frage-Blockwurde ein Zitat63bezüglich der Bedeutung von Räumen für die Bildung eingeblendet und als zirkuläre Frage die Meinung der Expertin zu diesem Zitat eingeholt. Inhaltliche Aspekte, die mit diesem Block abgedeckt werden sollten, waren etwa eine Expertinnenmeinung zu der Bedeutung und Signifikanz von Räumen in der Bildung, wie der Zusammenhang von Raum und Bildungsprozessen und durch konkrete Nachfragen die Übertragung der Erkenntnisse auf den Hochschulkontext.
Block 3beinhaltete den offenen Stimulus „Wie kann ein Lern- oder Lehrraum in einer Hochschule ihrer Meinung nach gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädlich gestaltet sein?“ Inhaltlich wurde anvisiert, eine Expertinnenmeinung einzuholen, inwiefern die Raumgestaltung mit mobiliarer Wahl zu gesundheitsschädlichem oder gesundheitsförderlichen Lehren und Lernen beitragen kann und welche Erkenntnisse es über Schäden und Folgen von zu langem Sitzen gibt.
In demvierten Blockzielte der offene Stimulus „Wie können ihrer Meinung nach die Bedürfnisse und Wünsche von StudentInnen bei der Gestaltung von hochschulischen Lehr-/ Lernräumen ausreichend miteinbezogen werden?“ darauf ab, aufzuzeigen, ob Partizipation der Nutzer:innen von Lehr- und Lernräumen stattfindet, inwiefern sie stattfindet und wer genau unter den Nutzer:innen verstanden wird.
MitBlock 5kam die präsuppositive Frage „Inwiefern können Außenlehr- oder Lehrräume, wie etwa eine Seminarwiese, zu einem gesundheitsförderlichen Studieren beitragen?“ zum Einsatz um Erkenntnisse eines Experten/ einer Expertin, welches Potenzial aber auch Grenzen ein Außenlehr- oder -lernräumen haben und unter welchen Voraussetzungen welche Potenziale oder Grenzen entstehen herauszufinden.
Das Interview wurde mit der letzten Frage für densechsten Frage-Blockabgeschlossen, die eine hypothetische Frage stellt: „Stellen Sie sich vor, sie dürften den optimalen Lehr- und Lernraum für Studierende gestalten: Wie würde dieser aussehen?“ Das Ziel war die inhaltlichen Aspekte der Expertinnen-Sicht auf optimale Lehr- und Lernbedingungen abzudecken, wie noch nicht erwähntes sichtbar zu machen und worauf nach einer Expertensicht zu achten ist.
2.2.2. Datenauswertung
In engem Zusammenhang mit der Entscheidung für Formen der Erhebung steht auch die Frage nach den geeigneten Auswertungsverfahren (vgl. (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 114) Wesentlich ist dabei, dass Formen der Erhebung und Auswertung eng aufeinander bezogen sind und Erhebungsform und Auswertungsverfahren so aufeinander abgestimmt sind, dass das erhobene Material eine geeignete Grundlage für das gewählte Auswertungsverfahren bildet (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 114)
Als Auswertungsmethode dieser Masterarbeit wurde die strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz gewählt. Inhaltsanalysen sind dabei gleichzeitig Analyseverfahren, wie auch Verfahren der Auswertung (vgl. Kuckartz 2018, S. 22). Der Anwendungsbereich der Inhaltsanalyse bezieht sich nicht nur auf vorhandene, aus Massenmedien stammende Daten und Dokumente, die Inhaltsanalyse wird auch auf im Projektverlauf selbst erhobene Daten angewendet, wie offene Interviews, Fokusgruppen oder Beobachtungsprotokolle (Kuckartz, 2018, S. 22). Qualitative Inhaltsanalysen präsentieren nicht nur den Inhalt eines Textes, sie beschäftigen sich zudem mit dessen Bedeutung und oder Kommunikationsinhalten (vgl. Kuckartz, 2018, S. 21; Kracauer 1952).64
Im Folgenden wird die für diese Arbeit gewählte inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse wie die dafür hermeneutischen Grundlagen als die Basis für die Datenauswertung vorgestellt.
Die Prinzipien der Hermeneutik wurden bei der Analyse und Interpretation jedes Interviews angewandt. Jedoch da sich im Laufe des Forschungsprozesses das Sampling erweiterte und aufgrund dessen ein anderer Leitfaden für die wissenschaftliche Mitarbeiterin als für die Stu- dent:innen und Absolvent:innen verwendet wurde, wurde das Vorgehen der Codierung und Kategorienbildung der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse lediglich bei den Erhebungseinheit der (ehemaligen) Studierenden angewandt.65
Hermeneutische Grundlagen
Die Grundlage für die Analyse und Auswertung der Expert: innen- Interviews ist die klassische Hermeneutik. „Hermeneutik“ ist ein aus dem Griechischen stammender Begriff, welcher gleichzusetzen ist mit „Kunst und Theorie der Auslegung und Deutung, Technik des Verstehens“ (Kuckartz, 2018, S. 16). Die Hermeneutik ist eine Theorie der Interpretation und taucht im wissenschaftlichen Diskurs Ende des 19. Jahrhunderts auf, als „vor allem Dilthey im Anschluss an Schleiermacher die Hermeneutik als die wissenschaftliche Vorgehensweise der Geisteswissenschaften den erklärenden Methoden der Naturwissenschaft entgegensetzten wollte“ (Kuckartz 2018, S. 16). Schon in Design und Fragestellung empirischer Untersuchungen stecken hermeneutische Voraussetzungen (vgl. Kuckartz, 2018, S.21). Bei dem Lesen eines Textes werden nicht nur Zeichen und Wörter oder seine syntaktischen Eigenschaften ausgewertet, es finden dabei auch hermeneutische Überlegungen, bzw. eine Art Bedeutungsermittlung statt (vgl. Kuckartz, 2018, S. 16-21). Wie ein Text verstanden wird, hängt stark mit dem Vorwissen zusammen, welches mitgebracht wird.
Ein Text besitzt verschiedene Sinnschichten, weshalb ein induktives Verständnis eines Textes nur aus sich selbst heraus schlichtweg unmöglich ist (vgl. Kuckartz 2018, S. 16). Nach Kuckartz (2018) sind ein wichtiger Orientierungspunkt für die Auswertung qualitativer Daten allgemeine Überlegungen zum Verstehen und vor allen Dingen zum Verstehen und Interpretieren von Texten, welches im deutschsprachigen Raum häufig mit „Hermeneutik““ gleichgesetzt wird (ebd., S. 16).
Zu wichtigen Kernpunkten der Hermeneutik gehört unteranderem derhermeneutische Zir- kel.66Hier ist besonders die zentrale Grundregel des hermeneutischen Vorgehens zu beachten, dass der Versuch einen Text zu verstehen immer mit einem gewissen Vorverständnis des Interpreten einhergeht. Der oder die Leserin eines Textes hat schließlich ein Vorverständnis und geht mit Vermutungen über den Sinn eines Textes heran. Durch die Erarbeitung des Textes geschieht wiederum eine Erweiterung des ursprünglichen Vorwissens (vgl. ebd.). Dies kann jedoch nur passieren, wenn der oder die Leser: in auch mit einer gewissen Offenheit an den Text herangeht und es zulässt, vorher bestehende Urteile auch zu verändern (vgl. ebd.). Das wiederholte oder häufige Lesen eines Textes oder von Textpassagen führt zu einem fortschreitenden Verständnis des Textes. Es entsteht ein hermeneutischer Zirkel oder eine hermeneutische Spirale(vgl. Kuckartz 2018, S. 18).
Auswertungsinstrumente
Nach Kuckartz und Rädiker (2022) sind zwei strukturierende Dimensionen für die qualitative Inhaltsanalyse zentral: Kategorien und Fälle (vgl. S.108). In dieser Arbeit wurde die Kategorienbildung nach Kuckartz (2018 und 2022) angewandt. Demnach bezeichnet man die Ge- samtheit aller Kategorien als „Kategoriensystem“ oder „Codesystem“; wobei ein englischer Begriff auch „Coding Frame“ ist (ebd., 2022, S. 61). In dieser Arbeit wurde ein hierarchisches Kategoriensystem angewandt, was bedeutet, dass verschiedene übergeordnete und untergeordnete Ebenen erstellt wurden (ebd., 2022, S. 61). Bei der Kategorienbildung wurde dabei auf folgende Kriterien geachtet: Die Kategorien stehen in enger Beziehung zu der Forschungsfrage und sind erschöpfend, also für jeden Aspekt der für die Forschungsfrage relevanten Daten wurde eine Kategorie erstellt; zusätzlich sind sie trennscharf und wohlformuliert, sie bilden zusammen eine „Gestalt“, also das Kategoriensystem hat eine innere Kohärenz. Zusätzlich wurde darauf geachtet die Subkategorien „Dimensionen, Ausprägungen oder Unteraspekte ihrer Oberkategorie“ und die Kategorien als verständlich und nachvollziehbar zu bilden(Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 63-65). Bei den Kategorien dieser Arbeit handelt es sich um thematische Einheiten. Die Haupt-Codes haben dabei eine reine heuristische Funktion und dienen als Art Überschrift. Bei den Fällen handelt es sich um die Forschungsteilnehmenden der Interviewstudie. Eine Rolle im Auswertungsprozess spielen Fallzusammenfassungen, die als Vergleiche von Fällen oder Fallgruppen genutzt wurden (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 105).
Kuckartz (2018 und 2022) entwickelte verschiedene Formen von Inhaltsanalysen, wie etwa die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, die evaluative qualitative Inhaltsanalyse und die typenbildende qualitative Inhaltsanalyse. Für diese Arbeit wurde sich für die in- haltlich-strukturierende Inhaltsanalyse entschieden.
Die Entscheidung für diese Methode fiel aus zwei Gründen:
1. Sie bildet die Kernmethode der qualitativ inhaltsanalytischen Verfahren und sieht mehrere Codierdurchläufe vor, bei denen mit deduktiv und oder induktiven Kategorien codiert wird (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 104). Dies war insofern wichtig, als dass es nicht möglich war, zu zweit zu codieren, was für eine Intercoda-Reliabilität eigentlich zu empfehlen ist ((Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 137). Deshalb wurde nach drei Wochen, zu einem Zeitpunkt, bei dem die vorgenommenen Codierungen nicht mehr so präsent waren, ein zweiter Codierdurchlauf vorgenommen (vgl. ebd.). Hierzu wurde das Datenmaterial erneut codiert und anschließend mit der Ursprungscodierung verglichen, also ein induktiv-deduktiven Ausdifferenzieren und ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung vorgenommen (vgl. (Kuckartz & Rädi- ker, 2022, S. 129-130).
2. Diese Methode passte am besten zu der Forschungsfrage, da nicht etwa das Datenmaterial bewertet werden oder Typen von Studierenden gebildet werden sollten, sondern durch eine inhaltliche Strukturierung und anschließende Analyse der Interviews Chancen und Grenzen bewegungskativierende(re)r Lehr- und Lernräume für Studierende herausgefunden werden wollten.
Bevor mit der Analyse begonnen werden konnte, mussten die Interviews erst einmal transkribiert werden. Dafür wurden die Audioaufnahmen der Interviews in die Softwaref4 Transkriptgezogen. Dabei handelt es sich um eine Software, bei der am Absatzbeginn und am Absatzende (Return-Taste) jeweils eine sogenannte Zeitmarke eingefügt werden kann (ebd., S. 202). Hierdurch wird eine Synchronisierung zwischen Text und Audioaufzeichnung ermöglicht, so dass beim Lesen einer Textstelle durch Anklicken der Zeitmarke die entsprechende Stelle der Audioaufzeichnung abgespielt wird (Kuckartz, Udo & Rädiker, Stefan, 2022, S. 202).
Für die Transkription wurden ein Vereinfachtes Transkriptionssystem nach Dresing & Pehl (2011) angewendet, das von Lösener (2018) zusammengefasst wurde.67
Anschließend wurden die Daten anonymisiert. Es wurden Pseudonyme für die echten Namen verwendet, allerdings so, dass wesentliche Merkmale wie das Geschlecht und kulturelle Hintergründe erhalten blieben. Wenn in einem Transkript von den Interviewpartner:innen Namens- oder Orts-Nennungen gemacht wurden, die auf empfindliche private Daten hinwiesen, wurden diese durch „XY“ ersetzt.
Für diese Masterarbeit wurde zusätzlich die Software „MAXQDA“ verwendet, die eine Hilfe für die Kategorienbildung und Analyse der Daten stellt.68
Vorgehen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse
Der eigentliche Sinn und Zweck der Kategorien ist die entsprechende Codierung der Daten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Begriffe „Kategorie“ und „Codieren“ oft aufs Engste verknüpft sind (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 67). „Codierte Segmente“ sind dabei Daten, wie eine Textstelle, die mit einer bestimmten Kategorie, oder einem bestimmten Inhalt und oder Thema in Verbindung gesetzt wurde (vgl. ebd.).
Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022) besteht aus sieben Phasen die wie folgt ausgeführt wurden:
Zuerstwurde initiierende Textarbeit geleistet (Kuckartz, 2022, S.132). Die transkribierten Interviews wurden dafür ausgedruckt. Schließlich wurde sich in dieser ersten Phase hauptsächlich auf „das interessierte sorgfältige Lesen des Textes und das Markieren von besonders wichtig erscheinenden Textpassagen“ fokussiert, die die inhaltlich strukturierende qualitative Analyse einleitet (ebd., S. 133). Dabei wurden händisch Bemerkungen und Anmerkungen an den Rand geschrieben.
Diezweite Phasesieht vor, mittels Kategorien und Subkategorien eine inhaltliche Strukturierung der Daten zu erzeugen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden dabei Themen und Subthemen als Auswertungskategorien verwendet (vgl. ebd., S. 133).69Zuerst wurde induktiv am Material, also den transkribierten Interviews, gearbeitet. Die Vorgehensweise war dabei, zuerst sequenziell am Material alle möglichen Hauptkategorien zu finden. Die Hauptkategorien wurden dabei mehr oder weniger direkt aus den Forschungsfragen abgeleitet (vgl. ebd.). Die damit verbundenen Themen waren bereits bei der Erhebung von den Daten leitend (ebd.). Dabei wurden die Kategorien bzw. Subkategorien und ihre Definitionen auf ihre konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material hin überprüft (vgl. ebd.).
In derdritten Phaseerfolgt der erste Codierprozess, der so gestaltet wird, dass jeder Text sequenziell, also Zeile für Zeile, vom Beginn bis zum Ende durchgegangen wird und Textab- schnitte den Kategorien zuweist (Kuckartz, 2022, S. 134). Dabei wird individuell entschieden, welche der Kategorien in dem betreffenden Textabschnitt angesprochen werden, wobei diese schließlich der passenden Kategorie zugeordnet wird (vgl. ebd.). Ein Textabschnitt, wie auch ein einziger Satz, kann mehrere Themen enthalten und bei thematischer Codierung können in einem Textabschnitt mehrere Themen angesprochen werden (vgl. ebd.). Deshalb erfolgte auch in dieser Arbeit die Codierung mit mehreren Kategorien am gleichen Textabschnitt.
Dievierte Phaseist durch das induktive Bilden von Subkategorien dominiert -dies bedeutet, dass nach dem ersten Codierprozess eine „Ausdifferenzierung der zunächst noch relativ allgemeinen Kategorien“ vorgenommen wird (Kuckartz, 2022, S. 138). Es wurden nach einem hierarchischen System am Material Subkategorien gefunden, indem Kategorien ausgewählt wurden, die ausdifferenziert werden sollen und dann wurden für diese nach dem Prinzip dem deduktiv- induktiven Ausdifferenzieren Subkategorien gebildet (vgl. ebd.). Weiter wurden Subkategorien zu allgemeineren Subkategorien zusammengefasst (ebd.) Schließlich wurden Definitionen für die Subkategorien formuliert. Mit Rückbezug auf die Forschungsfrage sowie einen bereits vorausschauenden Blick auf das Produkt der Studie wurden durch induktives Ausdifferenzieren die Kategorien entsprechend der Forschungsfrage sortiert und angepasst. Die zu Beginn sehr ausdifferenzierte Kategorien wurden nochmal nach relevanten Dimensionen der Forschungsfrage entsprechend geordnet und zu kompakteren Subkategorien zusammengefasst. Anschließend wurden alle mit dieser Kategorie codierten Textstellen in einer Tabelle zusammengestellt.70
Diefünfte Phasebeinhaltet den zweiten Codierprozess. Hier werden nun die ausdifferenzierten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 142). Es wird also erneut durch das bereits codierte Material gegangen. Dabei ist nach Kuckartz und Rädiker (2022) „darauf zu achten, dass hinreichend viel Material für die Ausdifferenzierung der Hauptkategorien in Phase 4 herangezogen wurde“ (ebd., S. 142). In dieser Arbeit wurden in dieser Phase teilweise Präzisierungen vorgenommen und teilweise bisher schon codiertes Material erneut durchsucht, allerdings eher um mehrere Subkategorien zu einer zusammenzufassen, da festgestellt wurde, dass die Kategorienbildung zu ausdifferenziert war und deshalb teilweise auch unübersichtlich.
In dersechsten Phasewerden einfache und komplexe Analysen vernommen und die Ergebnispräsentation vorbereitet. Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich dabei die Themen und Subthemen, die bei der Auswertung fokussiert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147). An diesem Punkt wurden wichtigen Ergebnisse bereits festgehalten. Die Kategorienbasierte Analyse fand entlang der Hauptkategorien statt. Es wurden tabellarische Übersichten erstellt,bei denen in den Zellen codierte Textstellen mit Kategorien dargestellt sind.
Zum Abschluss der Analyse, alssiebte Phase, werden die gefundenen Ergebnisse und die gewonnenen Erkenntnisse, verschriftlicht. Bereits geschriebene Textfragmente und Auswertungstexte wurden in einem finalen Ergebnistext zusammengeführt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 154).
2.3. Ergebnisdarstellung
2.3.1. Falldarstellung
Im Anschluss der sieben Schritte der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse wurden die Ergebnisse für den zu schreibenden Forschungsbericht aufbereitet und durch deskriptives Beschreiben Fallzusammenfassungen erstellt. Fallzusammenfassungen oder auch Case Summaries sollten auf dem Hintergrund der Forschungsfragen zentrale Charakterisierungen festhalten (Kuckartz, Udo & Rädiker, Stefan, S. 124). Dabei wird eine faktenorientierte, eng am Text arbeitende Komprimierung vorgenommen (Kuckartz, Udo & Rädiker, Stefan, S. 124). Als Ziel sollten Fallzusammenfassungen Antworten auf die Fragen geben, wie eine Person charakterisiert werden kann und was das Besondere an dieser Person und ihrer Haltung ist (Kuckartz, Udo & Rädiker, Stefan, S. 124).
Um eine Übersicht zu schaffen, wurde die Auswertung im Folgenden hinsichtlich der relevantesten Aspekte für die Forschungsfrage gefiltert und sortiert. In einer tabellarischen Zusammenfassung werden vorerst die signifikantesten Antworten genannt. Die genauere Interpretation folgt im Anschluss an diese Tabelle. Ebenso finden sich eine ausführlichere, gesamte Falldarstellung und die Transkripte[71] im Anhang. Bei diesem Vorgehen wurde sich an das Gesagte der Forschungsteilnehmenden gehalten, dieses nicht tiefenhermeneutisch ausgedeutet und weitergehende Interpretationen vorerst vermieden (Kuckartz, Udo & Rädiker, Stefan, S. 124)
Absolvent:innen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[71] In MAXQDA sind die Positionen die genauen Zeiteinheiten, die auch in den Transkripten angegeben sind und beim Öffnen des Programmes und Draufklicken die verknüpfte Audioaufnahme exakt an der Stelle des Gespräches abspielen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Student:innen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3.2. Interpretative Auswertung
Im Folgenden wird die kategorienbasierte Auswertung dargelegt, die mit Blick auf die Forschungsfrage vorgenommen wurde. Durch Vergleichen und Kontrastieren der Fälle soll dabei Differenziertheit und Komplexität dargelegt werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 129-130). Bei dem Ergebnisbericht wurde erörtert, ob die Forschungsfrage durch die Studie vollständig beantwortet werden konnte, welche Fragen mit den erhobenen Daten nicht beantwortet werden konnten und welche Fragen sich im Anschluss an die eigene Forschung stellen. Es werden nicht nur die Häufigkeiten der Themen und Sub-themen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise dargestellt, wobei auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden (vgl. (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 148-149).
Chancen
Erlebte Schäden von zu wenig Bewegung
Trotz den Erkenntnissen und erlebten Folgen ist die Sitzzeit bei den Proband:innen zum Teil sehr hoch. Da später beschrieben wird, dass eine bewegungsaktivierend(er)e Didaktik nur selten erlebt wurde und wenn dann nur in den Seminaren, kann davon ausgegangen werden, dass mit der genannten Zeit, die in Lernräumen verbracht wird, auch eine hauptsächlich sedentäre Haltung eingenommen wird. Drei Proband:innen verbrachten bis zu sechs Stunden am Tag in den genannten Lernräumen, wobei die Zeiten je nach Stundenplan variieren (Luisa, Pos. 105-109, Lisa, Pos. 121-127, Max, Pos. 48-50). Eine Probandin verbrachte in der Bibliothek teilweise um die zehn Stunden (Interview Milena, Pos. 71) und eine andere Probandin erzählte, dass in Vorlesungen eine ununterbrochene Sitzzeit von 90 Minuten herrscht, die höchstens durch eine Toilettenpause unterbrochen wird (Interview Lisa, Pos. 93-96).
In den Interviews wurde bei der Mehrheit der Proband:innen deutlich, dass Lernen und langes Sitzen auf Stühlen von ihnen eher negativ wahrgenommen wird. Gründe dafür können sein, dass bereits einige körperliche Beschwerden erlebten, die, durch wissenschaftliche Erkenntnisse bereits bestätigt, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Bewegungsmangel und oder zu langem Sitzen zusammenhängen (Siehe Kapitel 1.3. dieser Arbeit).
So wurden Beeinträchtigungen und Beschwerden genannt wie
- Entzündungen der Sehnen71(Milena, Pos. 193- 197)
- Kognitive und Gehirnphysiologische Beeinträchtigungen wie Müdigkeit und Konzentrationsprobleme (Luisa, Pos. 108-138)
- Probleme in Zusammenhang mit der Muskulatur, wie Nackenschmerzen (Anna, Pos. 76), erlebte Steifheit und Unbeweglichkeit (Anna, Pos. 76; Luisa, Pos. 135), und Rückenprobleme (Lisa, Pos. 212-215).
- Motivationsprobleme (Luisa, Pos. 134-135).
Positive Folgen von mehr Bewegung beim Studieren
Dagegen wurden viele positive Lern-Effekte durch und mit der Nutzung von bewegungsakti- vierend(er)em Mobiliar oder eigenständigem Bewegen festgestellt, die, den wissenschaftlichen Hintergrund betrachtend sehr wahrscheinlich durch Bewegung hervorgerufen wurden:
- Positiver Einfluss auf die Aktivität oder erhöhte Aktivität (Luisa, Pos. 144-147; Anna, Pos. 64-66 und 67-70)
- Erleichternder Austausch mit Kommilitoninnen (Anna, Pos: 64-66)
Besonders eine Probandin vermutete zudem, dass Beschwerden oder Folgen durch mehr Bewegung weg gehen würden, indem Bewegungsaktivierung zu folgenden Veränderungen führt:
- Mehr Motivation (Lisa, Pos. 419-123)
- Bessere Konzentration (Lisa, Pos. 191; 419-423)
- Weniger körperliche Probleme bezüglich Rückenschmerzen (Lisa, Pos. 191-195).
Die Chancen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung des Lernens bzw. Studierens liegen hier auf der Hand: so sollen die Beeinträchtigungen durch zu wenig Bewegung verringert werden und die erlebten, wie erwartbaren Folgen von mehr Bewegung zunehmen.
Bedürfnisse Studierender in Zusammenhang mit Bewegung
Das Bedürfnis nach mehr Bewegung im Studium im Allgemeinen wurden an mehreren Stellen beschreiben. Eine Studierende und eine Absolventin beschrieben besonders, dass sie allgemein mehr Bewegung beim Studieren wünschen (Interview Luisa, Pos. 117; Anna, Pos. 175-176). Eine Absolventin beschrieb neben der Nutzung von Stehtischen auch in Bezug auf Entspannung für die Hände nach dem Schreiben, dass sie gerne mehr Bewegungspausen gehabt hätte (Siehe Interview Milena, Pos. 193), eine andere Studentin äußert vielerlei Bedürfnisse und Wünsche nach Mobiliar, mit dem sie sich mehr bewegen kann (Interview Lisa, Pos. 184-185).
Überdies wird im Gespräch bei fünf von sieben Proband:innen, inklusive der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, spezifischer beschrieben, wie der Einsatz von bewegungsaktivierenderem Mobiliar viele Vorteile mit sich bringt. So wird gezeigt, wie speziell bewegungsaktivieren- de(re)s Mobiliar sich sehr gut eignet, um für mehr Bewegung beim Studieren oder Lernen zu sorgen. Bei zwei Studierenden und einer Absolventin treten prominent die Bedürfnisse nach verrückbarem und bewegungsaktivierendem Mobiliar hervor. Es werden dabei die erlebten Vorteile von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen, die frei bewegbar sind, genannt und die positive Nutzung von „Wackelhockern“ oder „Sitzhockern“, wie das Bedürfnis danach beschrieben, dass diese weitflächiger zur Verfügung stehen (Anna, Pos. 64-66 und 67-70; Luisa,
Pos. 131-133; Lisa, Pos. 77-79 und Pos. 187; Milena, Pos. 85 und Pos. 139). Ebenfalls sah der körperlich beeinträchtigte Student die positiven Vorteile von Stehtischen, auch wenn er diese nicht so häufig nutzen kann, wie andere Studierende (Alex, Pos. 172-173). Eine Studentin erwähnte und nutzte die Tretfahrräder oder „Sitbikes“, welche sie auch gerne flächenüberdeckender zur Verfügung gehabt hätte als nur in den zwei Seminarräumen an der PH, in denen sie sie bisher überhaupt vorfand (Lisa, Pos. 81-87).
Mehr Platz und Wissensvermittlungüber Bewegungsaktivierung
Weitere Bedürfnisse, die mit einer bewegungsaktivierend(er)en Lehr- und Lernraumgestaltung in Zusammenhang mit der Gestaltung von Außenlern- und lehrräumen in Angriff genommen werden können, sind jene nach allgemein mehr Platz und mehr Lern-Plätzen (Interview Alex, Pos. 101-105, Milena, Pos. 45-48).
Weiterhin zeigte sich, dass bereits erlebte Wissensvermittlung zuzüglich späterer bewegungs- aktivierend(er)er Unterrichtsgestaltung bei einer Lehramtsstudentin sehr gut ankam (Interview Luisa, Pos. 62-69 und 258-292) und eine generelle praktische Vermittlung wie bewegungsak- tivierend(er)en Lernraumgestaltung vorgenommen werden kann, begrüßt wird.
Inklusion
Der Proband dieser Arbeit, dessen Bewegung durch eine Behinderung beeinträchtigt ist, zeigte die Notwendigkeit einer Barrierefreiheit an einer Hochschule auf und aber auch den Vorteil von bewegungsaktivierend(er)em Mobiliar. Ihm ist es möglich ab und zu aufzustehen, was nicht bei jedem Rollstuhlfahrer zu erwarten ist, so kann er auch die Stehtische nutzen (Interview Alex (m), Pos. 195-197, 207-209). Jedoch stellte sich heraus, dass grundsätzlich höhenverstellbare Tische auch für eine Anpassung für das Darunterfahren mit dem Rollstuhl sinnvoll sind (Interview Alex (m), Pos. 69).
Außenlernräume mit innewohnender Bewegungsaktivierung
Durch die Interviews wurde deutlich, dass Außenlernräume eine bewegungsaktivierend(er)e Funktion haben (Interview Luisa, Pos.211 -227 und 230-233; Lisa, Pos. 223-228; 289-290 und 313-317; Milena, Pos. 134-139; 217-220; und 237).
Deshalb besteht die Chance, durch die Lehr- und Lernraumgestaltung von Außenlernräumen eine Bewegungsaktivierung zu erreichen, aber auch andere Bedürfnisse Studierender zu erfüllen wie nach Austausch, Tageslicht, und einem Bezug zur Natur. Zusätzlich besteht das Potenzial lebensweltnah zu sein, wenn sie entsprechend gesehen und gestaltet werden. In jedem Falle zeigte sich, dass das Interesse besteht draußen zu lernen. Außenlernräume bieten überdies weitere Vorteile. Wie eine im Rahmen dieser Arbeit interviewte Expertin der Gesundheitsförderung beschreibt, unteranderem eine konzentrationsfördernde und stressreduzierende Komponente (Interview Frau M. Pos. 16-22).
Bewegliches und bewegbares Mobiliar
Bei den Absolvent:innen und Student:innen insgesamt fällt auf, dass die Mehrzahl - fünf von sechs - kein gutes Haar an den Vorlesungssälen lassen. Die Hörsäle werden von diesen drei Proband:innen wie auch einem weiteren Absolventen, der eigentlich keinen Bedarf an Bewegung hat, nicht gerne besucht. Die Proband:innen beschrieben Gefühle der Beengung und negative Konnotationen dafür, dass dort das Mobiliar festgeschraubt ist, wie allgemein ein einschränkendes und bewegungsarmes Erleben des Sitzens in einer Sitzreihe in Vorlesungsräumen, da das Aufsitzen während der Vorlesung deutlich erschwert ist, wie sogar Toilettengänge (Beispiesweise Interview Luisa, Pos. 125; Milena, Pos. 65). Alle fünf Proband:innen gehen lieber in Seminarräumen studieren. Während ein Absolvent lediglich als Grund nennt, dass er in kleineren Seminarräumen besser als in großen Hörsälen aufgrund der anderen Atmosphäre lernen kann (Interview Max, Pos. 46), betonen vier sehr deutlich, dass das daran liegt, dass die Seminarräume flexibler gestaltet sind, das Mobiliar dort beweglicher, oder mehr Platz vorhanden ist (Milena, Pos. 61-67; Anna, Pos. 30; Luisa, 127-129).
Neben bereits erwähntem Mobiliar, was bereits größtenteils genutzt wird oder genutzt wurde, wurde zudem von Proband:innen artikuliert, welche weitere Ausstattung ihnen für ihre Bedürfnisse helfen würde, oder von welcher sie denken, dass sie eine gute Hilfe für mehr Bewegung und Unterstützung im Alltag wären:
- Bewegungsaktivierung und Balance-Halten des gesamten Körpers: Prezi-Bälle (Interview Luisa, Pos. 185-199; Milena, Pos. 183-192), Balance-Kissen (Milena, Pos. 117; Luisa, Pos. 165-261).
- Bewegung und Entlastung der Hände und Arme: kleine Handpressen oder Massage Bälle (Lisa, Pos. 263), ergonomische Tastaturen und Mäuse (Milena, Pos. 193-199).
- Erinnerung an Bewegungspausen: Zeitmesser oder eine Stoppuhr als Erinnerung genannt (Interview Alex, Pos. 223-225).
Wie durch die Interviews herausgefunden, birgt bewegungsaktivierend(er)es Mobiliar dagegen die Chance, Möglichkeiten der Anpassung zu liefern. Die einzigen zwei Probandinnen, die die Frage nach der Anpassungsmöglichkeit Lernraum mit „jein“ und „ein bisschen“ beantworteten, begründeten diese Anpassung ausschließlich durch die Möglichkeit der Nutzung eines Wackelhockers und eines Stehtisches (Interview Lisa, Pos. 138-141; Milena, Pos. 8285).72
Bewegungsaktivierend(er)e Didaktik
Die Proband:innen ließen durchblicken, dass sie bewegungsaktivierend(er)e Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg wenn dann nur in Seminaren erlebt hatten und da oft auch in Relation zu mehreren Jahren Studium (vier bis fünf, sechs Jahren durchschnittlich) sehr wenig, da sie nur von vereinzelten oder seltenen bis gar keinen Fällen berichteten. So wurden ausschließlich Seminaren mal mehr oder weniger Methoden wie das Kugellager73angewandt (vgl. Luisa, Pos. 158-161), Gruppenarbeiten und Lernspiele praktiziert (vgl. Lisa, Pos. 89-99 und 241-244), theaterpädagogische Einheiten (Anna, Pos. 116-118). Ein Proband erlebte eine einzige Aktivierung zum Aufstehen im Online-Semester (Alex, Pos. 214-217) und einer Probandin nur einmal eine rhythmisch-pädagogische Aktivierung durch Singen (Milena, Pos. 156-163) und ein anderer in seinem kompletten Studium (ungefähr fünf Jahre) in Veranstaltungen keine einzige (Max, Pos. 80-84).
Vorschläge und Ideen wurden von den Proband:innen jedoch einige vorgestellt, wie entweder der Ansatz Lehre und Lernen durch Bewegung zu unterbrechen (Ansatz 1) oder der Kombination von Bewegung und Lehren oder Lernen (Ansatz 2) in den Hochschulalltag integriert werden kann.
Ansatz 1 (siehe Kapitel 1.3.3.1.):
- Platz- oder Positionswechsel: Es wird vorgeschlagen, nach einer gewissen Zeit die Positionen zwischendurch zu wechseln und Aufgaben im Liegen, oder Stehen zu bearbeiten (Luisa, Pos. 71; Lisa, Pos. 269), was jedoch zu einer Unterbrechung von Denkprozessen führen kann.
- Bewegungsaktivierte Pausen (Milena, Pos. 193).
Ansatz 2 (siehe Kapitel 1.3.3.2.):
- Flexible, beweglich(er)e Mobiliaranordnung und Auswahl: Es werden die Ideen formuliert, verschiedenes Mobiliar in einem Raum mit etwa Stehtischen zu platzieren, um eine Auswahl bereit zu stellen und verbunden mit der Aufforderung durch Dozierende, auch mal den Platz zu wechseln (Interview Luisa, Pos. 171-173) oder dass aufgrund einer absichtlich vorgenommenen Mobiliaranordnung für Kommunikation mit Anderen automatisch aufgestanden werden muss (Lisa, Pos. 267).
- Variation der Lehrform/ des Lehrformates: Es wird außerdem vorgeschlagen verschiedenere Lehrformate zu praktizieren und etwa portable Geräte einzusetzten, um das einzelne Lernen an Tischen durch andere Formen abzuwechseln (Interview Milena, Pos. 41), wie auch einen häufigeren Wechsel der Lehrposition vorzunehmen, wobei auch die dozierende Person ihren Platz wechselt (Milena, Pos. 263).
- Methoden: Neben bereits erlebten Methoden wie Gruppenarbeit, Stationenarbeit, Kugellager, einem Lernspiel im Hof, oder theaterpädagogischen Methoden, werden noch bewegungsaktivierend(er)e Lernspiele vorgeschlagen wie „Ecken rechnen“ (Interview Luisa, Pos. 71), oder Spiele in Bewegungspausen (Lisa, Pos. 425).
Durchbrechen der typischen Lernraumanordnung und dersedentären Norm
Durch die Erzählungen der Absolvent:innen und Student:innen dieser Arbeit wird deutlich, dass die klassische Lernraumanordnung lediglich Folgendes enthält: mehrere (Einzel-)tische und Stühle und eine Projektionsfläche vorne (Interview Luisa, Pos. 24-35, Lisa, Pos. 28-33, Pos. 49-52 und 59-61, Milena, Pos. 13-17; Anna, 29-30). Dadurch und besonders durch die deutlichen Worte einer Studentin wird gezeigt, dass ihre Lernraumerfahrungen in der Hochschule sich so gut wie nicht unterscheiden wie zu denen von der ersten bis zur zwölften Klas- se.74Die Expertin aus der Gesundheitsförderung und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Frau M. sagt genau das, was auch die Grundschullehramtsstudentin beschrieb, nämlich, dass in der breiten Masse eher noch eine ganz klassische Möblierung vorherrscht, so dass der Übertritt von Schule an eine Universität oder Hochschule raumtechnisch kaum spürbar ist, mit Ausnahme vom Hörsaal, der nochmal einen anderen Charakter hat (Interview Frau M., Pos. 41-48).
Durch eine bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung kann - in Zusammenhang mit Weiterbildungen und einem weitflächigen Austausch - diese Norm reflektiert und hinterfragt werden.
Mobilität
Es zeigte sich, dass weiterer Bedürfnisse von Proband:innen an Studieren und Lernen durch eine bewegungsaktivierend(er)e Lehr- und Lernraumgestaltung erfüllt werden können.
Auch das Bedürfnis nach Lernräumen haben, in denen sie sich mit anderen Studierenden über Lerninhalte austauschen können (Interview Alex, Pos. 69; Anna, Pos. 40; 62-66 und 110-112; Milena, Pos. 93 und Pos. 37), kann durch eine bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung erleichtert werden (Lisa, Pos. 87; Anna, Pos. 64-66).
Den Erkenntnissen folgend wäre eine Unterstützung und Förderung eines mobilen Lerntyps oder „Lernwanderer“ der auch im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt wird, förderlich und dem aktuellen Zeitgeist angemessen. So kann mit haptischem Lernmaterial, Unterlagen, aber auch diversen portablen Geräten rein theoretisch an allen möglichen Orten gelernt werden und an hochschulischer Lehre teilgenommen werden. Dieser Lerntyp wurde hervorstechend bei drei Proband:innen festgestellt, da diese gerne Zuhause, in der Natur, in der Bibliothek, oder auch unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Warten in Arztpraxen lernen (Interview Luisa, Pos. 17-18; Lisa, Pos. 144-151; Milena, Pos. 92-94).
Wenn das Konzept oder der Begriff Lernraum nicht eng gefasst wird (siehe Kapitel 1.2.1.), sondern weitergehend auch auf außerhochschulische Lernorte übertragen, kann gesagt werden, dass zu einer bewegungsaktivierend(er)en Lehr- und Lernraumgestaltung auch gehört, Lehren und Lernen weg von einem spezifischen Raum zu denken. Auch die Nutzung des Campus einer Hochschule liefert die Möglichkeit zu mehr Bewegung und der Unterstützung dieses Lerntyps.
Partizipation, Selbstwirksamkeit und Transparenz
Nicht ein:e Proband:in gab auf die Frage, ob der beschriebene Lernraum den Bedürfnissen anpassbar sei, ein deutliches Ja. Dagegen wurden Situationen beschrieben, in denen es nicht möglich war, einen Lernraum an der Pädagogischen Hochschule den eigenen Bedürfnissen nach gestalten zu können. Es wurde deutlich, dass viele Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. Überdies hat das Mobiliar einen Einfluss darauf, wie und wo gelernt wird. Manche Pro- band:innen erzählten demnach, dass sie diesen Lernraum dann einfach nicht aufsuchten, weil sie ihn ihren Bedürfnissen nicht anpassen konnten (Interview Luisa, Pos. 110-113; Alex, Pos. 158-163; Anna, Pos. 93-94; Max; Pos. 42, 51-52 und 76-78).
Wenn Mobiliar eigenständig dem Bewegungs-Bedürfnis angepasst oder verändert werden kann, oder selbstständig entschieden werden kann welche Art von Mobiliar je nach Tagesform in einer Vorlesung oder einem Seminar genutzt wird, kann dabei gleichzeitig auch das Selbstwirksamkeitserleben als größer empfunden werden. Im Vergleich dazu, wenn nur eine Art von Mobiliar vorhanden ist und dieses im schlimmsten Fall noch nicht einmal wegbewegt werden kann, weil es festgeschraubt ist, ist das Selbstwirksamkeitserlebnis mit großer Wahrscheinlichkeit sehr gering. Die Proband:innen beschreiben bezüglich Lernräumen der Pädagogischen Hochschule ein eher geringes Selbstwirksamkeitserleben, da sie diese wenig ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen oder verändern zu können.
Da herausgefunden wurde, dass das Bedürfnis nach einer bewegungsaktivierende(re)n Didaktik, Lernraumgestaltung mit Mobiliar besteht, bietet eine (Um-)Gestaltung von Lehr- und Lernräumen die Möglichkeit einer erhöhten Partizipation und eines vermehrten Selbstwirksamkeitserlebnisses Studierender. Es kann interpretiert werden, dass wenn Studierende mehr Möglichkeiten sehen, Lernräume ihren Bedürfnissen und Wünsche nach anpassen zu können, wie konkrete Ansprechpartner:innen zu kennen und Nutzer:innen-Bedürfnisse-zentrierte(re) Planungsprozesse geschehen, eine größere Identifizierung mit der Hochschule und großes Engagement von Seiten der Studierenden entsteht, was auch zu mehr Zufriedenheit führt.
Grenzen
Individuelle Bedürfnisse
Die Auswertung der Interviews zeigt, dass es unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an eine Umgebung gibt, damit sie individuell auch lernförderlich ist. Während manche Pro- band:innen äußerten, Ruhe zu brauchen und oder gerne allein lernen, lernen manche gemeinsam mit anderen am besten. Gerade die Studierenden, die gerne Ruhe in einem Lernraum haben, könnten wiederum von Bewegungsaktivitäten - selbst nur durch das Hochfahren eines Stehtisches - gestört sein.
Es wird jedoch deutlich, dass Räume für bestimmte Student: innen für ein gelingendes Lernen unersetzlich sind, wie zum Beispiel die Bibliothek. Eine Absolvent:in erzählt demnach sogar, wie sie in ihrem Studium sogar bis zu zehn Stunden am Tag in der Bibliothek verbrachte. Viele der interviewten Probanden sahen die Nowendigkeit für bewegungsativierend(er)es Mobiliar, bis auf einen Probanden hatte jede/r Proband/in das Bedürfnis danach. Doch auch wenn von den meisten Proband:innen zu langes Sitzen als etwas Gesundheitsschädliches gesehen wird, machte dieser Proband deutlich, dass er keinen Bedarf an mehr Bewegung beim Studieren oder Lernen hat. Diesem Probanden war dagegen viel wichtiger eine bequeme Sitzmöglichkeit zu haben, Ruhe und vor allem eine gute mediale Ausstattung. Interessant war jedoch, dass sich gerade in diesem Interview ein Bewusstwerden und Darüber-Nachdenken gegen Ende des Interviews abzeichnete und es ist zu beobachten, wie allein die Fragen gegen Ende in dem Sinne scheinbar angeregt haben über normative Verhaltensweisen nachzudenken.
Es ist deshalb wichtig anzuerkennen, dass auch eine bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumung nicht das Ultimum für alle Studierenden darstellt und es immer die freiwillige Wahl zwischen mehr Bewegung oder nicht für Studierende geben sollte.
Sitzende Norm in Veranstaltungen: Durchbrechen dieser ist schwer und erfordert Mut
Wie durch die Interviews der Autorin dieser Masterarbeit herausgefunden, wird eine Sitzkultur beim Studieren an der Pädagogischen Hochschule und allgemein beim Studieren als scheinbar normal gesehen und ein Durchbrechen dieser Normalität wird zwar gewünscht, geschieht aber oft nicht und scheint schwer zu sein. So wird Aufstehen in einer Vorlesung, eine negative Aufmerksamkeit auf sich zieht, tendenziell scheinbar weder von Mit-Student: innen noch Dozent:innen gerne gesehen und Stehtische bleiben teilweise ungenutzt (Interview Milena, Pos. 139 -147 und 175 - 177; Luisa, Pos. 153-157; Max, Pos. 90-92; 169-173).
Es wird deutlich, dass sich eine Normierung der Gestaltung der Lehr- und Lernräume in Hochschulen findet, die sich nicht sonderlich von solchen in Schulen unterscheiden: mehrere Einzeltische, Stühle, eventuell eine Tafel oder Whiteboard, eine Leinwand. Dies gehört auch in Hochschulen sehr oft zu einem Standard-Inventar.
Gründe hierfür könnten sein, dass ein Verhalten, was gegen die Normalität spricht und eine Rarität darstellt, von Umstehenden als Störung empfunden wird, da die sedentäre Norm eine Routine ist. Durch routiniertes Verhalten wird tagtäglich diese sitzende Norm praktiziert und gibt Individuen damit ein Gefühl von Sicherheit und Vorhersehbarkeit und es kann es zu Irritationen führen, wenn diese durchbrochen werden. Es kann interpretiert werden, dass es sich dabei um eine, von Löw (2001) beschriebene „Ordnungsdimension“ handelt, um das Handeln zu strukturieren und Orientierung zu geben, weshalb es schwer ist, aus dem Gewohnten auszubrechen (Siehe Kapitel 1.2.2.2.).
Es liegt eine Chance darin, im Rahmen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung im Dialog und Austausch das traditionelle, typische Lernraum-Konzept zu hinterfragen und mit allen Beteiligten in den Austausch zu gehen, wie Lernräume bewegungsaktivierender und gesundheitsfördernder gestaltet werden können. Darüber kann über routinierte Verhaltensweisen reflektiert werden, die oft erst nach einer Bewusstmachung auffallen. Durch den Austausch soziales Miteinander zu fördern, findet dabei auch seine Chance.
Es müsste erst einmal ein Umdenken gegenüber der Anordnung eines Lernraumes geschehen, indem von dem klassischen Modell weggedacht wird.
Kein Engagement Studierender
Die meisten Proband:innen äußerten ein reges Interesse daran, sich bei einer eventuellen Lehr- und Lernraum(um-)gestaltung zu engagieren und einzubringen. Wenn Umstände allerdings einfach akzeptiert werden oder keine zeitliche Kapazität für Engagement da ist, wird es schwierig. Eine Studentin zeigte, dass ihr zeitliche Kapazität fehlen würde, da sie nebenher viel ehrenamtlich arbeitet (Interview Luisa, Pos. 263-266). Es kann also nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass Studierende ausreichend zeitliche Kapazität mitbringen, um sich neben der Studier-Zeit noch für die Lernraumumgestaltung zu engagieren. Dem entgegengewirkt werden könnte allerdings indem - wie von Frau M. beschrieben, interdisziplinär im Rahmen von Lehrveranstaltungen Lehr- und Lernbereiche entwickelt werden (Interview Frau M., Pos. 82).
Warum und in welchem Umfang Studierende sich einbringen, hängt letztlich von zahlreichen Faktoren ab. Dazu gehört unteranderem, ob es die Rahmenbedingungen einer Hochschule erlauben, sich einbringen zu können. Aber auch, die erwartete und oder erlebte Wirkung der eigenen Selbsttätigkeit oder des eigenen Engagements. Wenn durch die Rahmenbedingungen eine Einschränkung empfunden wird, wird Engagement behindert. So konnte keine:r der interviewten Absolvent:innen, die teilweise bis zu fünf Jahre an der Pädagogischen Hochschule studierten, eine:n konkreten Ansprechpartner:in für Partizipationsmöglichkeiten oder eventuelles Engagement bei der Lernraumgestaltung nennen. Nur eine Absolventin kannte das PHe- el-Good Team75; konnte allerdings auch nur grob sagen, was dieses Team macht. Es wurde dagegen gefordert, dass es bestimmte Gremien, Ansprechpartner:innen oder Teams gibt, an die man sich wenden kann (Interview Anna, Pos. 153-157; Interview Max, Pos. 118-120; Interview Milena, Pos. 275-277). Bei allen interviewten Personen bestand eine sehr große Unsicherheit dahingehend, wie sich überhaupt bei der Lernraumgestaltung eingebracht werden könnte, oder ob das überhaupt möglich wäre. Die überwiegende Zahl der Inter- viewpartner:innen würde sich allerdings einbringen (Interview Alex, Pos. 164-267 und 271275; Lisa; Pos. 374-379; Milena, Pos. 255).
Handlungsspielräume und bauliche Maßnahmen
Wie von einem Absolventen beschrieben, hat er erlebt, dass bauliche Maßnahmen oft ihre Zeit brauchen und es dauert, bis es von einer Idee zu einer Anregung oder Umsetzung kommt. Er selbst hatte etwa keine Änderungen gesehen, Jahre nachdem er an einer Umfrage für eine Umgestaltung teilnahm (Interview Max, Pos. 118-126). Er beschreibt, wie dies Studierende abschrecken kann oder verhindert sich überhaupt engagieren zu wollen, wenn man davon ausgehen kann, dass die Änderung ohnehin nicht miterlebt wird und das dazu führen kann, dass Umstände von Studierenden lieber akzeptiert werden (Interview Max, Pos. 140-144).
Eine Umgestaltung von Lehr- und Lernräumen ist nicht immer einfach so zu vernehmen, ohne auf gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingen achten zu müssen. So kann Denkmalschutz eine Hürde bei Umgestaltungen sein und beispielsweise bei Neu-Gestaltungen von Außenlernräumen müssen Sicherheitsvorschriften und behördliche Auflagen beachtet werden, um etwa keine Fluchtwege zu versperren und Stolperfallen zu verhindern (siehe Interview Frau M. Pos. 129-140). Es wurde durch das Interview mit einer Expertin, die schon neue Außen- lehr- und lernräume als wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgestaltet hat deutlich, dass um bei der Lernraumgestaltung neue Installationen vornehmen zu können, Finanzierungen gebraucht werden, die zwar auch aus zentralen Mitteln der Hochschule kommen können, jedoch grun- sätzlich Hochschulen nicht unbedingt immer ausreichend Gelder zur Verfügung haben und man deshalb bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten kreativ sein muss (ebd.).
Die Umgestaltung zu mehr Bewegung muss jedoch nicht unbedingt mit großen Kosten oder Umbaumaßnahmen einhergehen, zu sehen darin, wie eine weitere Probandin beschreibt, dass das simple Einführen beweglicher Hocker schon sehr viel bringt (Interview Lisa (w.), Pos. 185-188).76Im Anhang dieser Arbeit findet sich mit Fotos von bewegungsaktivierend(er)em Mobiliar auch als Beispiel eine Kostendarlegung.
2.4. Reflexion und Limitation der Arbeit
Im Folgenden wir erörtert und reflektiert, welche Limitationen sich im Rahmen der Forschung ergaben.
DieQualität des Codierprozesses noch besser sichern
In der Praxis stellt sich häufig die Frage, ob ein Text nur von einer Person oder von mehreren, d. h. mindestens von zwei Codierenden, bearbeitet werden soll. Empfehlenswert ist es, jeden Text zumindest zu Beginn der Codierphase von zwei Codierenden bearbeiten zu lassen. (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 136). Es ist also generell empfehlenswert, mit mehreren unabhängig voneinander Codierenden zu arbeiten. Codieren mehrere Personen, so werden mehr oder weniger automatisch die Kategoriendefinitionen an Präzision gewinnen und damit die Zuordnungen zuverlässiger. Insbesondere bei Qualifikationsarbeiten wird es aber nicht immer möglich sein, zu zweit zu codieren, dann wird man nicht umhin kommen, sich mit diesem Mangel zu arrangieren und selbst darauf zu achten, bei Zweifelsfällen die expliziten Kategoriendefinitionen zu verbessern und konkrete Beispiele festzuhalten (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 137)
Es lässt sich kaum bezweifeln, dass das Codieren durch lediglich eine Person in der Regel keine optimale Lösung darstellen kann. Es ist allenfalls dann unproblematisch, wenn es sich um ein Interview handelt, das durch den Leitfaden stark vorstrukturiert ist (Kuckartz & Rädi- ker, 2022, S. 137). Da ein solcher Leitfaden für die vorliegende Arbeit erstellt wurde (vgl. Kapitel 2.2.1.), muss hier Kuckartz und Rädiker folgend keine (signifikante) Limitation festgehalten werden (vgl. ebd. 2022, S.137).
Ausführlichere Inhaltsanalyse
Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse wurde hier in einer limitierten Version angewendet. Sie hätte noch weiter ausgeweitet werden können und in den einzelnen Phasen hätten noch einzelne Zwischenschritte durchgeführt werden können. Beispielsweise könnte in der sechsten Phase noch eine Analyse der Zusammenhänge zwischen den Subkategorien einer Hauptkategorie oder eine Analyse der paarweisen Zusammenhänge zwischen Kategorien vorgenommen werden (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 150).
Auswahl des Samplings und Erhebungszeitraum
Die Auswahl des Samplings war nicht von vorneherein festgesetzt, sondern wurde verändert. Das erste Interview das bereits im Sommer 2021 geführt wurde, wurde mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin und Expertin im Bereich Gesundheit und Prävention der Pädagogischen Hochschule geführt77. Jedoch wurde dabei auch herausgefunden, dass der Interviewleitfaden angepasst werden muss und die Erkenntnis gewonnen, dass die Thematik eine stärkere Nut- zer:innen-Einsicht von Studierenden erfordert. Zudem wurde sich in diesem Interview noch stärker auf die Thematik der Außenlehr- und lernräume fokussiert, wie sich schlussendlich in dem Forschungsprozess entschieden wurde diese Thematik miteinzubinden. Da jedoch auch in dem Zusammenhang wichtige Erkenntnisse und Einsichten bezüglich bewegungsaktivie- rend(er)er Lehr- und Lernraumgestaltung gewonnen wurden, werden diese in dieser Arbeit geteilt.
Dabei war zunächst unklar, ob es einen negativen Effekt auf die empirische Untersuchung hat, dass drei der Proband:innen gerade in diesem Monat der Interviewführung (Ende Februar 2022) schon einige Wochen im Referendariat waren und deswegen eventuell nicht mehr so den Bezug zu der Pädagogischen Hochschule haben, da sie schon im Schulkontext angekommen sind. Dazu kam auch bei diesen Probanden, wie den anderen drei Student:innen hinzu, dass sie die letzten zwei Jahre keine Veranstaltungen direkt in der PH hatten und deshalb weniger Bezug zu den Lernräumen - außer sie lernten in der Bibliothek, die aber selbst zu der Zeit aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt zugänglich war.
Interessant war zu beobachten, dass alle drei Proband:innen, die gerade das Referendariat begonnen hatten, wie auch die Probandin, die ihre Masterarbeit im Home-Office schrieb und nicht mehr in Heidelberg wohnte, zu anfangs bei der ersten Leitfrage erst einmal betonten, dass sie an der Pädagogischen Hochschule studierten, aber jetzt nicht mehr studieren und für ihre ersten Beschreibungen Verben in der Vergangenheitsform benutzen. Sobald es allerdings intensiver in das Gespräch ging, wurde oft in die Präsenz-Form gewechselt und sogar so erzählt, als würde es noch aktiv erlebt: „[wir ja davon direkt betroffen sind, und da fände ich es auch gut, wenn wir da auch, auf jeden Fall mitbestimmen dürfen wie die PH-Bib genutzt wird und wie sie gestaltet wird“ (Absolventin Milena, w. Pos. 253 - 253). Es wurde oft in PräsenzForm angesetzt und dann nochmal im Tempus der vollendeten Vergangenheit das Gleiche formuliert.78Daraus kann interpretiert werden, dass der persönliche Bezug zu den Lernräumen und dem Studieren vor Ort noch sehr stark da, oder in dem Moment des Erzählens, das Erlebte noch sehr klar und präsent als Vorstellungsbild beschrieben wurde. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Proband:innen durch die Gesprächsführung und die Fragen die Erwartung verspürten, sich in die Rolle der Student:innen einzufinden. In Anbetracht dessen, dass schon zwei Jahre nicht mehr in den beschriebenen Lernräumen studiert wurde, aber trotzdem oft so erzählt wurde, als ob noch vor Ort agiert würde, kann interpretiert werden, dass das Beschriebene nicht etwa verdrängt oder als unwichtig vergessen wurde, sondern noch präsent ist und damit nicht gerade unwichtig scheint.
Sprachlich interessant war auch, wie eine Absolventin, die sich seit wenigen Wochen im Referendariat befand, oft den Sprachwortschatz einer Schule verwendetete, wie „Schüler:innen“, „unterrichten“79oder „Unterrichtsstoff80“, um „Student:innen“ oder „Seminar- /Vorlesungsinhalte“ zu beschreiben und sich öfters mal selbst korrigierte. Daraus kann geschlossen werden, dass diese Absolventin kognitiv und emotional auf den schulischen Kontext umgestellt hatte. Trotzdem erzählte sie -mit Ausnahme des Anfangs des Gespräches die meiste Zeit über Belange in der Pädagogischen Hochschule, als ob sie noch vor Ort wäre. Aufgrund der pandemischen Situation zum Zeitpunkt des Schreibens die Arbeit war es von Vorteil als Sampling Absolvent:innen der Pädagogischen Hochschule Pandemische zu haben, da sie im Vergleich zu den anderen zwei Probanden grundsätzlich mehr Jahre ein Studium in Präsenz vor Ort erlebten. Zudem zeigte sich auch im Gespräch bei den anderen zwei Probanden, dass sie insgesamt weniger Erlebnisse und Erfahrung bezüglich der Lernräume der PH hatten. Dabei muss beachtet werden, dass sich beide zu dem Zeitpunkt der Interviews fast zwei Jahre im Online-Studium befanden. Besonders wurde dies bei einem Probanden deutlich, der seit Beginn des Mastersemesters sogar nur im Home-Office war bis zu dem Zeitpunkt des Interviews. Bei diesem Probanden wie einer anderen Probandin kann interpretiert werden, dass sich dies dadurch äußerte, dass sie die Seminarwiese der Pädagogischen Hochschule nicht kannten, woraus interpretiert werden kann, dass sie weniger Möglichkeiten hatten Lernräume zu erkunden.
Dies brachte insofern Einschränkungen, als dass die Thematik der Außenlernräume bei diesen Probanden eher imaginativ vorlief, also auf reiner Vorstellungsbasis, da kein gemeinsamer Konsens darüber bestand, welcher Außenlernraum von der Interviewerin gemeint war. Bei einem Probanden konnte leider auch nicht über die typischen Lernräume der Pädagogischen Hochschule vertiefend gesprochen werden, aus dem schlichten Grund, dass er in diesen einfach noch nie ein Seminar hatte.
Besonders bei den Proband:innen, die am längsten an der Pädagogischen Hochschule vor Ort studierten, kann aufgrund der Länge der Antworten, der Erzählungen im Präsenz und des offensichtlichen Reinfühlens von Absolvent:innen81trotz nicht mehr vor Ort-seins, der ausführlichen Beschreibung, wie der Betonung der Wichtigkeit der Thematik interpretiert werden, dass entweder eine emotionale Verknüpfung mit der Pädagogischen Hochschule als Institution stattgefunden oder sogar eine Identifikation, mindestens im Laufe der Jahre ein persönlicher Bezug hergestellt wurde.82
Wichtig ist besonders im Zuge der Außenlernräume der Pädagogischen Hochschule (PH) zu wissen, dass zum Zeitpunkt der Interviews der neue Außenlernraum bei dem Innenhof der alten PH noch nicht fertig gebaut wurde und da die Proband:innen zu der pandemischen Lage im Februar 2022 ohnehin nicht vor Ort waren, konnten sie diesen auch nicht kennenlernen.83
Leitfaden undGesprächsführung
Die erste Frage des Leitfadens wurde von den Ehemaligen und Aktuell-Studierenden bei ein paar Fällen anders beantwortet, als von der Interviewerin erwartet. Auf „Wo studierst und lernst du?“ wurde erwartet, dass ein bestimmter Lernraum genannt wird, stattdessen wurde oft die Institution oder sogar die Stadt genannt: „also, ich studier‘ an der PH Heidelberg und genau seit drei, vier Semestern online, aber davor war ich dann, in Heidelberg“ (Interview Luisa (w.), Pos. 6-9). Oft wurde deshalb nochmal einmal genauer nachgefragt: „okay und wenn du AN der Pädagogischen Hochschule bist, wo studierst und lernst du DANN? Wenn du VOR ORT bist?“ doch selbst dann kam es vor, dass nicht konkret auf einen Lernraum eingegangen wurde, wie etwa bei Luisa: „ähm ja einen Teil an der NEUEN PH, dann aber auch an der ALTEN PH sind ja die Psychologie und Erziehungswissenschafts-Vorlesungen und Seminare und dann aber auch noch im Technologie-Park für äh meine THEOLOGIE-Seminare“ (Interview Luisa (w.), Pos. 6-9). Im Nachhinhein hätte die Frage spezifischer gestellt werden können, nur wurde sie mit Absicht offen gehalten, um die Interviewpartner:innen nicht zu sehr zu lenken.
Auch wenn von den interviewten Personen grundsätzlich positives Feedback nach den Interviews kam, wie, dass sie sich wertgeschätzt gefühlt haben und sie das Gefühl hatten, dass ihnen auch wirklich zugehört wird und auf ihre Antworten eingegangen wurde, hätten auch ein paar Aspekte geändert werden können. Es wurde sich der Gesprächsdynamik angepasst, beispielsweise als eine Proband:in die Mensa als Lernraum beschrieb, vertiefend auf die Mensa als Lernraum eingegangen und dann auch auf das Mobiliar in diesem (vgl. Anna, Pos. 93 - 94)
Zusätzlich könnte noch genauer beschrieben bzw. reflektiert werden, wie genau sich die Gesprächsdynamik entwickelte bzw. der Interviewablauf genau durch bestimmte Aussagen geformt wurde. Es könnte noch genauer analysiert werden, welches Rollenverhältnis in der Interviewsituation vorkam und wie diese die Gesprächsdynamik eventuell beeinflusste (vgl. Helfferich, S. 670). Eine Limitation liegt insofern nämlich vor, als dass die Interviewerin mit vier der Proband:innen bereits bekannt war. Ob dies einen Einfluss auf die Gesprächsdynamik hatte, könnte noch weiter analysiert werden.
Repräsentativität und Generalisierung
Aufgrund der Limitation dieser Arbeit sind die Möglichkeiten einer Generalisierung begrenzt. Dadurch, dass nur sieben Interviews geführt wurden und sich speziell auf das Setting der Pä- dagogischen Hochschule in Heidelberg fokussiert wurde, kann keine Verallgemeinerung oder Übertragung auf alle Studierenden der pädagogischen Hochschule in Heidelberg vorgenommen werden.
Für ein weiteres Forschungsvorhaben wäre eine Erweiterung des Samplings und Ausweitung auf andere Studiengänge und Hochschulen anzudenken. Eine Ausweitung des Samplings auf zukünftige Forschung wäre insofern interessant, als dass Studierende mit mehr praktischen Inhalten wie der Fächer Technik, Musik und vorallem auch Sport zu sagen gehabt hätten, inwiefern die Bewegung in Veranstaltungen vielleicht je Fach variiert und welchen Anspruch sie an Bewegung bei oder während Veranstaltungen hätten. Außerdem könnten Studierende anderer Hochschulen in das Sampling mit aufgenommen werden und solche, die keinen pädagogischen Hintergrund in ihrem Studium haben.
2.5. Zwischenfazit Empirie
In dem empirischen Teil dieser Arbeit wurden die Vorzüge qualitativer Forschung wie die Offenheit gegenüber Erfahrungswelten für das Forschungsinteresse dargelegt und die mögliche Gewinnbringung der Durchführung von Expert:innen-Interviews zur Beantwortung der Forschunsgfrage. Die Auswertung der Expert:innen-Interviews anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse zeigte, dass eine bewegungsaktivierend(er)e Lehr- und Lernraumgestaltung an Hochschulen zu einem gesünderen und damit auch effektiveren Lernen an Hochschulen führen kann.
Die interviewten Proband:innen beschrieben eine Typologie von Lernräumen im Hochschulkontext und Erfahrungen eines typisch aufgebauten Lernraumes, die sich kaum von schulischen unterscheiden - wie sie bereits in der theoretischen Hinführung erörtert wurde. Wie durch die Interviews dieser Arbeit herausgefunden, beeinflusst auch bei Studierenden die Gestaltung der Lehr- und Lernräume, wie diese wahrgenommen und erlebt werden und ob sich diesen abgewandt oder zugewendet wird. So scheinen nachweislich emotionale Verknüfpun- gen Studierender mit Lehr- und Lernräumen vorzuliegen. Bei einem eher negativen Erleben wird ein solcher auch tendenziell nicht mehr aufgesucht. Dass nicht nur die vorgesehenen Seminar- oder Vorlesungsräume als Lernräume genutzt werden, wird durch die Berichte von Proband:innen klar, die auch in der Biblitothek, Natur oder Mensa, wie auch unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Warteräumen schon studiert oder gelernt haben.
Die Mehrzahl der Absolvent:innen und Student:innen der Pädagogischen Hochschule beschrieb Schäden von zu wenig Bewegung im Studium, zudem wurden langen Sitzzeiten artikuliert.
Positive Folgen von mehr Bewegung wurden teilweise erlebt, wie größtenteils lediglich vermutet, da bisher tendenziell sehr wenig Bewegungsaktivierung in Veranstaltungen erlebt wurde. Die Chance von einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung der hochschulischen Lehr- und Lernräume liegt demnach darin, zu effizienteren und gesünderen Lernprozessen zu führen, wie mehr Konzentration und Motivation beim Lernen und weniger körperlichen Schäden.
Überdies konnten Überschneidungen von wichtigen Bedürfnissen und Wünschen bei den Proband:innen festgestellt werden, die mit Blick auf das Forschungsinteresse dieser Arbeit durch eine bewegungsaktivierend(er)e Didaktik größtenteils erfüllt werden können. Dazu gehören die Bedürfnisse nach beweglichem und bewegungsaktivierend(er)em Mobiliar, bewe- gungaktivierend(er)e Methodik und Didaktik mit flexibleren Lehrformaten, Mobilität, mehr Platz, Wissensvermittlung über Bewegungsaktivierung, ein Durchbrechen der sedentären Norm, Partizipations- und Selbstwirksamkeitserlebnisse, eine größere Transparenz der Handlungsmöglichkeiten der PH und einem Bezug zur Natur. Zusätzlich konnte gesehen werden, dass sich durch eine bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung sogar Chancen der Inklusion ergeben.
Zusätzlich wurden jedoch auch Grenzen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen deutlich, wie etwa, dass nicht jede:r das gleiche Bedürfnis nach Bewegung hat und ein Proband sogar gar kein Bedürfnis nach Bewegung äußerte. Individuelle Vorlieben nach mehr Ruhe und Alleinigem-Lernen Zuhause zeigen, wie viele unterschiedliche Anforderungen an Lehr- und Lernräume gestellt werden, die nicht unbedingt immer zusammenzubringen sind. Außerdem kristallisierte sich heraus, dass sich erst eine Lern- und Arbeits-Kultur und Norm entwickeln muss, die individuelle Bedürfnisse berücksichtigt und mehr Austausch verschiedener Akteur:innen begünstigt. Es stellte sich heraus, dass das Durchbrechen von sedentären Normen schwer scheint und bei Kommoliton:innen wie auch Dozierenden zu negativen Reaktionen und Irritationen führt. Die Handlungsspielräume einer Hochschule sind zudem auch durch Vorgaben und Regelungen, wie Sicherheitsmaßnahmen eingeschränkt und eine (Um-)Gestaltung benötigt finanziellen Support, der erst einmal gewährleistet werden muss.
Zusammenfassend kann jedoch gesagt werden, dass die Chancen einer bewegungsaktivie- rend(er)en Gestaltung von Lehr- und Lernräumen gegenüber den Grenzen überwiegen, da die Bedürfnisse von den Proband:innen sich mit den durch eine bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung erlebten und erwartbaren Folgen größtenteils decken.
Deshalb kann geschlossen werden, dass eine bewegungsaktiverend(er)e Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen die Chance birgt, einen Großteil der Bedürfnisse von Studierenden zu erfüllen.
3. GESAMT-ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Anhand der theoretisch- fundierten Forschung dieser Arbeit wurde herausgefunden, dass sich mehr Chancen als Grenzen aus einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen ergeben. Auch durch die in der Empirie erfolgte Auswertung der Expert:innen-Interviews anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018 und 2020) konnte herausgefunden werden, dass die Chancen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lernräumen überwiegen.
Im Folgenden werden, in einer abschließenden Zusammenfassung mit Fazit, die sich ergebenden Chancen und Grenzen des theoretischen Teils, wie empirischen Teils dieser Arbeit mit Hinblick auf die Forschungsfrage dargelegt. Es wird mit einer Perspektive sich daraus ergebenden Handlungsbedarfs abgeschlossen. Die Erkenntnisse hinsichtlich der Chancen und Grenzen einer bewegungsaktiverend(er)en Lehr-und Lernraumgestatung ergeben sich aus zahlreichen Aspekten:
Bewegungsarmes Studieren und Lernen wird oft im Unbewussten täglich routiniert vorgenommen und für Selbstverständlich unhinterfragt akzeptiert. Ein Grund dafür, warum Menschen sich bei routiniertem Handeln wohler fühlen und deshalb routiniertes Handeln tagtäglich vornehmen, mag sein, dass Routinen Sicherheiten vermitteln (Löw, 2001, S. 163). So wie nach Erkenntnissen Löws (2001) in Kapitel 1.2.2.1. dargelegt, wird repetitives, menschliches Handeln in Strukturen oft reproduziert, so wird auch die sitzende Norm. Durch soziologische Erkenntnisse wird jedoch auch deutlich, wie eine Reflexivität über das eigene Handeln zu einer Bewusstwerdung über die Schäden von sedentärem Verhalten zu einer Verhaltensänderung führen kann. Aus einem soziologischen Blickwinkel kann die Chance gesehen werden mit einer bewegungsaktivierend(er)en Umgestaltung, zusammen mit Wissensvermittlung und dem Austausch über die Thematik jenes bewegungsarme routinierte Handeln durch Reflexion zu durchbrechen.
Es wurde durch die Berichte der Studierenden festgestellt, dass sie eine mangelnde Umweltkontrolle an der Pädagogischen Hochschule erleben. Negative Konnotationen wie „unbequem“ (Interview Lisa Pos. 35-36, Max Pos. 76 und 96) oder „unpersönlich“ (Interview Anna, Pos. 174), „beengend“ (Interview Luisa, Pos. 125) oder eine Atmosphäre beschrieben wird, in der sich nicht so wohl gefühlt wird (Max, Pos. 24) bezüglich der festgeschraubten Tische und Bänke, wie der Beschreibung von kaputtem Mobiliar in Vorlesungssälen (Luisa, Pos. 119), kann als jene gewertet werden. Dies geht einher mit dem festgestellten Einfluss von Umwelten auf Emotionen, wie durch Architekturpsychologischen Erkenntnisse in Kapitel 1.2.2.1. dargelegt. Demnach hängen eine mögliche positive Identifikation mit einer Umwelt mit positiven Gefühlen gegenüber der Umwelt zusammen. In der bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen liegt die Chance, mehr Umweltaneig- nung und Umweltkontrolle für die Studierenden zu ermöglichen, da mehr Möglichkeiten der Anpassung durch bewegungsaktivierend(er)es Mobiliar vorfinden und durch eine bewegungs- aktivierend(er)e Didaktik in Kombination mit variablen Lehrformen mehr Bedürfnisse erfüllt werden können.
Weiterhin wurde theoretisch fundiert herausgefunden, dass eine gewisse Raumstruktur bestimmte Didaktik erlauben und auch behindern kann (siehe Kapitel 1.2.2.3 und 1.3.3.).
Die Chance im Zuge einer bewegungsaktivierend(er)en Lehr- und Lernraumgestaltung liegt darin, eine Lehr- und Lernraumumgestaltung in Form einer der vorgeschlagenen Modelle, wie beispielsweise des Resonanzmodells (Kapitel 1.2.2.3.) oder des Heidelberger Modells der bewegten Lehre (Kapitel 1.3.3.) einzuführen und die Vorschläge einer bewegungsaktivie- rend(er)e Didaktik, wie in Kapitel 1.3.3. beschrieben, zu praktizieren, wobei eine Ausstattung mit bewegungsaktivierend(er)em Mobiliar einhergeht. Weiter gefasst eröffnen sich Chancen durch eine Gestaltung von Lernräumen, die nicht nur auf den Innenraum beschränkt sind, sondern sich auch, etwa an einer Hochschule in Verbindung mit Natur, neben oder an einem Campus oder über den Campus erstrecken.84Die Weiterentwicklung, Gestaltung und Nutzung von Außenlernräumen bietet überdies nicht nur eine Bewegungsaktivierung, sondern auch die Chance zu mehr Nachhaltigkeit.
Auch wurden ähnliche Folgen des Bewegungsmangels und von mehr Bewegung wie im Theorieteil dieser Arbeit dargelegt, bei den Proband:innen festgestellt. Die Proband:innen erlebten zum größten Teil negative körperliche Folgen der klassischen sedentären Haltung, wie Probleme mit dem Rücken, Steifheit, Schmerzen und sogar Sehnenscheidentzündungen, aber auch kognitive Effekte wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und weniger Motivation beim Lernen. Es wurde durch festgestellt, dass die typische Lernraum-Anordnung an einer Hochschule in Heidelberg in Zusammenhang mit bewegungsarmen und sedentärem Studieren steht. Dagegen wurden viele positive Lern-Effekte von mehr Bewegung in Zusammenhang mit dem Studieren und Lernen festgestellt, die durch die Theorie schon bestätigt wurden. Die große Chance einer bewegungsktivierend(er)en Gestaltung von Lehr- und Lernräumen für Studierende liegt demnach in jedem Fall darin, dass Studierende aktiver werden und sich fitter fühlen, sich besser konzentrieren können, und von den Effekte von Bewegung auf die Muskulatur längerfristig profitieren.
Eine weitere Chance ergibt sich durch, in dieser Arbeit herausgefundenen positiven Folgen von Bewegungsaktivierung. So kann mehr Bewegung beim Studieren und Lernen dazu führen, dass das Wohlbefinden durch mehr Fitness und Aktivität gesteigert wird und eine bessere Konzentration und Aufmerksamkeit Lernprozesse positiv beeinflusst (siehe Kaptel 1.3.). Es besteht die Chance, dass dies bei Sudierenden auch eintritt und wie vermutlich die von den Probanden erlebte(n) Rückenprobleme, Steifheit und Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Gelenkprobleme (Sehnenscheidentzündungen) aufgrund von zu langem Sitzen und zu wenig Bewegungspausen wegbleiben.
Die größte Chance einer bewegungsaktivierend(er)en Lehr und Lernraumgestaltung ergibt sich, dass dadurch Bedürfnisse von Studierenden erfüllt werden können:
Grundsätzlich kann zusammengefasst werden, dass die Mehrzahl der Probanden Studieren mehr Bewegung beim Studieren und in dem Zusammenhang bewegungsaktivierendes Mobiliar wünscht und benötigt. Weiterhin wurde festgestellt, dass Wünsche bestehen, mit Hilfe einer bewegungsaktivierend(er)en Didaktik eine Bewegungsaktivierung zu initiieren. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird aufgezeigt, wie auch interviewte Proband:innen ein Lernverhalten im Sinne eines Lernwanderers oder einer Lernwanderin beschrieben (Siehe Kapitel 2.3.) - das Bedürfnis nach mehr Mobilität kann durch die bewegungsaktivierend(er)en Lehr und Lernraumgestaltung erfüllt werden. Bei jeder Lehr- und Lernraumumgestaltung besteht die Chance, verschiedene Bedürfnisse mitzudenken. Die individuellen Bedürfnisse sind gleichzeitig die Chance an Konzepten und Ideen zu arbeiten, nicht nur einen normierten klassischen Lernraumtyp flächendeckend anzuwenden, sondern nach dem Prinzip des im Theorie-Teil vorgestellten Resonanzmodells jeden Raum neu zu denken, um verschiedene Bedürfnisse einfangen zu können.
Zusätzlich zu der von Koeritz et al (2022) vorgeschlagenen mediendidaktischen Unterstützung für Lehrende sahen auch Student:innen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg das Potenzial in der Wissensvermittlung und Aufklärung über die Thematik (siehe etwa Interview Max, Pos. 186 -189; Luisa, Pos. 282-284). Fachspezifisch-übergreifende Vorträge und Dialoge mit Lehr- und Lenraum-Nutzer:innen wie Studierenden, Lehrenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen, Bibliotheksmitarbeiter:innen wären dabei ein Ansatz. Rupp et al. (2020) beschreiben, wie dies durch hochschulinterne Weiterbildungen zu Grundlagen bewegter Lehre, hochschuldidaktische Inhouse-Angebote für interessierte Fachabteilungen, Institute oder Fakultäten, bewegte Tagungen mit wissensvermittelnden Vorträgen und mehr stattfinden kann (Rupp et al. 2020, S. 22). Ein Bewusstsein dafür kann erreicht werden, wenn Interessen- vertreter:innen einen fundierten Wissensschatz über die in dieser Arbeit vorgestellten soziologischen, psychologischen und pädagogischen Bereiche bekommen, wie die Wechselwirkung von menschlichem Handeln und Raum, Architekturpsychologie, wie Didaktik und Raum. Signifikant ist dabei nicht nur Lehrende an Hochschulen für diese Thematik zu sensibilisieren und dementsprechend weiterzubilden. Als zukünftige Multiplikator:innen dieses Wissens hat dies bei Lehramtsstudent:innen wie Absolvent:innen, die später in pädagogischen Bereichen arbeiten, in denen sie für viele Menschen als Vorbild agieren und ihr Wissen an unzählbar viele Menschen weitergeben, ein sehr großes Potenzial. Wenn sie Qualifikationen in der Lernraumgestaltung erhalten, können sie später selbst in der Praxis einen Einfluss auf die Lernraumgestaltung vornehmen.85
Die Erkenntnisse der Leitlinien von Koeritz et al. (2022), wie in Kapitel 1.2.2.3 Arbeit vorgestellt, decken sich zu einem sehr großen Teil mit den Ergebnissen des empirischen Teils der Arbeit, sprich den Chancen und Grenzen einer bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen, aber auch andere durch die Interviews sichtbare Aspekte. So wurde auch von Student:innen der Pädagogischen Hochschule bemerkt, dass sie zu wenig Mitspracherecht haben, auch was Neubauten und Neugestaltungen betrifft. Außerdem wurde im Rahmen dieser Arbeit deutlich, dass die Studierenden ebenfalls den Wunsch nach eine:r/m konkreten Ansprechpartner:in für die Lernraumgestaltung äußerten, die Koeritz et al. (2022) als „Lernraumagenten“ bezeichnen. Das Angehen einer (Um-)gestaltung hinsichtlich Bewegungsaktivierung eröffnet die Chance Nutzer:innen wie verantwortliche Akteur:innen miteinzubeziehen und die von Studierenden gewünschte Partizipation zu erreichen. Der Anlass einer Gestaltung von Lehr- und Lernräumen bietet die Chance für einen stärkeren Dialog und eine Zusammenarbeit verschiedener Akteur:innen. Der Austausch zwischen Dozent: innen und Student:innen kann so durch etwa gemeinschaftliche Projekte gefördert werden. Es können kollaborative Projekte entstehen, in denen auf Augenhöhe an Konzepten gearbeitet wird, die weitesgehend den Bedürfnissen aller entsprechen. Studierenden-Meinungen und Ideen können dabei vermehrt in die Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen oder sogar des Bauens eines neuen Gebäudes einbezogen werden, wie eine praktische Eingebundenheit in die Umsetzung von Maßnahmen. So können beispielsweise durch gemeinsame Planung Studierende mit Lehrkörpern ihre unterschiedlichen Bedürfnisse äußern und Dozierende bewegungsaktivierend(er)e Didaktik in Hinblick auf die erwähnten Bedürfnisse planen. Betrachtet man dabei die Fakten, wie der Autor Joshua Schultheis (2022) ausführt, dass fast drei Millionen Menschen in Deutschland eine Hochschule besuchen, aber Student:innen tendenziell aktuell eine Mitbestimmung nur „unter Vorbehalt“ erleben86und deutlich an Mitbestimmungsrecht verloren haben, schließlich sind sie nicht in Hochschulleitungen vertreten und haben nicht einmal das letzte Wort wenn es um ihre eigenen Studieninhalte geht (Schultheis 2022, S.18).87, wird das innenwohnende Potenzial Studierenden mehr Partizipationsrechte bei der Lehr- und Lernraumgestaltung einzuräumen deutlich.
Es wurden jedoch auch Grenzen festgestellt, so scheint es schwer, Normen zu durchbrechen. Da wie auch durch sozilogische Erkenntnisse begründet, das Handeln von Menschen in Räumen die Raumkonstitution beeinflusst, verhindert eine normative Konstruktion von Raum und Sicht auf Raum als etwas, das einheitlich oder ganz zu sein hat dagegen, einen Veränderungsprozess mit allen Chancen sehen zu können (vgl. Löw, 2001, S.130 -131). Derart beschrieben auch die Proband:innen wie das Ausbrechen gewohnter Strukturen zu Irritation(en) bei Kommilitoninnen, wie auch Dozent:innen führt (vgl. Kapitel 2.3.2.).
Weitere Hürden die sich bei einer bewegungsaktivierend(er)en Lehr und Lernraumgestaltung stellen können, sind eine Vielzahl unterschiedlichster Regelungen, auf die geachtet werden müsste. Planungen einer (Um-)gestaltung oder eines Bauwerks benötigen oft zahlreiche Ge- spräche und Verhandlungen über funktionale Anforderungen. Oft ist zudem die Kommunikation zwischen Architekt:innen und Nutzer:innen erschwert (vgl. Kapitel 1.2.2.1.)
Nicht nur muss bei Möbeln oft auf eine gewisse Normierung geachtet werden und bei Gestaltungen eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen, oft erschweren auch finanzielle Rahmenbedingungen umbauten, es müssen die Kosten im Rahmen bleiben, wenn nicht ein Sponsor gefunden wird (vgl. Interview Frau M.).
Es wurden auch Grenzen einer bewegungsaktivierende(re)n Lernraumgestaltung hinsichtlich individueller Bedürfnisse erkannt. Durch empirische Erkenntnisse dieser Arbeit wurde deutlich, dass in dem Regelbetrieb eines Hochschulalltags tagtäglich individuelle Anforderungen an lernförderliche Raumgestaltungen präsent sind. Dazu zählt neben Lernräumen die zu völlig stillem Arbeiten einladen, auch ausreichend Platz und Raum zur Diskussion über Studieninhalte nach einem Seminar, oder zur Vorbereitung einer Prüfung in Lerngruppen. Gewisse Räume in einer Hochschule werden für Student:innen als wichtiger Ort der Begegnung und des Austausches benötigt, wodurch auch Lernprozesse durch qualitativ hochwertigen Austausch mit Gleichgesinnten stattfinden können, andere Lernräume sollten dagegen die Bedürfnisse Ruhe, die Möglichkeit eigene digitale Geräte zu bedienen, bequemes Mobiliar oder bewegungsaktivierendes Studieren ermöglichen.
In Hochschulen findet sich zumeist nicht nur eine große Heterogenität was die Bildungsangebote betrifft, sondern auch bei den Student: innen. So wurde auch in dieser Arbeit herausgefunden, dass eine Zahl an Probanden - auch wenn sie in der Minderheit war - ein geringeres Bedürfnis nach Bewegung im Studium oder dem Lernen hat. Aufgrund genau dieser Heterogenität ist es wichtig, dass Lehr- und Lernräume and Hochschulen Gestaltungselemente enthalten, die individuelle Lerner:innen-Bedürfnisse unterstützen.
Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich insofern Handlunsgbedarf, als dass mehr Kommunikation und Interaktion über die Thematik elementar sind. Durch eine flächendeckendere Lehr- und Lernraum(um-)gestaltung, dem vermehrten Einsetzten von verschiedenem bewegungsak- tivierend(er)em Mobiliar in Verbindung mit vermehrter, aktiver Aufklärung von speziellen Zuständigen wie diese am besten genutzt werden und warum eine Unterbrechung der Sitzzeit wichtig ist, kann sich die Chancen ergeben, dass sich die Nutzung von bewegungsaktivierendem Mobiliar und dass sich während eines Studier- und Lerntages bewegt wird, als Selbstverständlichkeit etabliert. Eine weitere Idee der Autor: innen des Positionspapieres des Stifterverbandes, nämlich dass auch der Austausch der Lehrenden untereinander zu fördern ist (S. 5), wurde auch von einem Studenten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg umschrieben und vorgeschlagen. Nur im Gegensatz zu dem von Koeritz et al. (2022) gesetzten Fokus auf digitale, ortsunabhängige Begegnungen, wurde der Vorschlag aufgegriffen, dass was die Raumgestaltung angeht, an Hochschulen auch spezielle Räume -wie bereits in Schulen als Lehrerzimmer bekannt- vorhanden sein sollten, die als Begegnungsraum für Lehrende aller Fachrichtungen dienen.
Zusätzlich muss mehr Partizipation und Transparenz gewährleistet werden. Wenn die Nutzer: innen einer Hochschule aktiv in die Gestaltung der hochschulischen Arbeits- und Lernwelt miteinbezogen werden und sich dabei als aktiv Handelnde begreifen können, deren Mitwirken und sich Einbringen auch eine Wirksamkeit hervorruft und die Resultate sehen lässt, wird ein hochschulisches Milieu gestaltet, was zugunsten der Nutzer:innen lebt. Die Folge davon muss sein, dass Lernen und Lehren in einem hohen Maße begünstigt und gefördert wird. Durch eine hohe Partizipation können individuelle Lern- und Lehrbedürfnisse gelebt werden und somit nicht nur effizienteres, sondern auch zufriedeneres und gesünderes Lehren und Lernen. So bietet sich im Rahmen eines Herangehens auf eine bewegungsaktivierend(er)en Gestaltung an, eine Zentrierung auf die Bedürfnisse der Akteur: innen mit mehr Partizipationsrecht in der Gestaltung vorzunehmen. Es könnte ein Gremium zur Lernraumgestaltung entstehen, welches diverse Akteur:innen enthält und in Sitzungen beziehungsweise Besprechungen über Neuerungen in Abstimmung aller betreffenden Nutzer:innen stattfinden. Im Rahmen inklusiver Bildung und einer gewünschten Heterogenität könnte es entsprechende Ansprechpartner: innen geben und der Dialog zwischen Verantwortlichen und Akteur: innen vorangetrieben werden. Um selbstgesteuertes Lernen mit einem studierendenzentrierten Ansatz auch in Hochschulen zu vollziehen, braucht es an Hochschulen Bedingungen, die Selbstätigkeit, Kreativität und Innovation erlauben. Ein aktives Mitgestalten der Lehr- und Lernräume bietet diese Möglichkeit und fördert soziales Miteinander.
Überdies sollten für eine zukunftsorientierte Lehr- und Lernraumgestaltung eine eigene pädagogische Arbeitsweise der Hochschulbildung nicht nur funktional und nur die Gebäudehülle beschreibend praktiziert werden, sondern die Bedürfnisse der Nutzer: innen und Akteur: innen deutlich miteinbezogen werden. Dabei muss eine inhaltliche Verknüpfung zwischen Architektur und Pädagogik geschehen. Es muss sich von allen Seiten in der Verantwortung gesehen werden, in Hochschulen ein gesundheitsförderndes und damit auch lernförderndes Lernen durch eine entsprechende Gestaltung von Lernräumen zu ermöglichen. Bildungsinstitutionen sollten sich an gesellschaftlichen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts anpassen können und flexibel agieren. Lernförderliche Bildungsräume benötigen nicht nur eine offene, sondern auch eine flexible Raumgestalt, die unter Umständen auch „auf sich verändernde Lerninteressen Rücksicht nehmen kann“ (Ludwig 2012, S. 28). Die bisherige typische Gestaltung von Lehr- und Lernräumen einer Pädagogischen Hochschule in Heidelberg steht bisher im Gegensatz zu am häufigsten genannten Bedürfnissen der interviewten Studierenden, wie dem deutlich hervortretenden Bedürfnis nach bewegungsaktivierender Didaktik. Da die Lebenswelt heutzutage stark bewegungsarm ist, muss die Hochschullehre darauf reagieren. Schließlich kann hier die zugrundeliegende Chance liegen, ein weiter gefasstes, dynamischeres und flexibleres Konzept eines Lernraumes als zukunftsfähiger als das bisherige zu vermitteln und zu praktizieren.
Die abschließenden Thesen dieser Arbeit sind deshalb, dass die Chancen, die sich durch eine bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung bewegungsaktivierend(er)e Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernraumgestaltung ergeben, gegenüber den Grenzen überwiegen und sich vor allen Dingen durch jene Gestaltung die große Chance ergibt, zahlreiche Bedürfnisse von Studierenden zu erfüllen.
Literaturverzeichnis
Albers, A. (2020): Lernräume gestalten. Lernförderliche Rauminszenierungen für den Schulalltag, in:PÄDAGOGIK. Lernräume gestalten (6/20). S. 6.
Bernhard, C., Kraus, K. & Schreiber-Barsch, S. Erwachsenenbildung und Raum: Theoretische Perspektiven - professionelles Handeln - Rahmungen des Lernens. In Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung (S. 1-235).
Brandt, S., Bachmann, G. (2014): Auf dem Weg zum Campus von morgen (Keynote). Klaus Rummler (Hrsg.) Lernräume gestalten -Bildungskontexte vielfältig denken, Münster, New York (NY): Waxmann, S. 15-28.
Breidenstein, G. (2004). Klassen Räume - eine Analyse räumlicher Bedingungen und Effekte des Schülerhandelns. Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialfor-schung, 5(1), 87-107, 87-107. https://nbn-resolving.org/
Chaddock, L., Neider, M. B., Voss, M. W., Gaspar, J. G. & Kramer, A. F. (2011). Do athletes excel at everyday tasks? Medicine and science in sports and exercise, 43(10), 1920-1926. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318218ca74
DIE. Wb-web (2020): Lernort:Der Ort bestimmt entscheidend dieQualität des LernensQuelle: https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/lernort.html
Dold, C. (2020). SITZALARM BEI ONLINEMEETINGS - Transfer Together, online in: https://transfertogether.de/sitzalarm/ [02.10.21]
Dordel, S. & Breithecker, D. (2003): Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern und Leistungsfähigkeit. In: Haltung und Bewegung, 23 (2), 5-15.
Eberhard-Kaechele, M. (2016-2017): Emotion is motion: Improving emotion regulation through movement intervention; European Psychotherapy 2016/2017, S. 5-28.
Eberhard-Kaechele, M., Gotthard, P. (2016):Mutmacher: Methodische Ansätze der Bewegungstherapie bei Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation, Abteilung Neurologie, Psychosomatik, Psychiatrie Deutsche Sporthochschule Köln, S.143-159
Ekkekakis, P., Parfitt, G. & Petruzzello, S. J. (2011). The Pleasure and Displeasure People Feel When they Exercise at Different Intensities. Decennial Update and Progress to-wards a Tripartite Rationale for Exercise Intensity Prescription, in: Sports Med 2011; 41 (8): 641-671 Faulstich, Peter (2008): Käte Meyer-Drawe: Diskurse des Lernes. München: Wilhelm Fink 2008., Zeitschrift für Pädagogik 55 (2009) 5, S. 815-817).
Felez-Nobrega, M., Hillman, C. H., Dowd, K. P., Cirera, E., & Puig-Ribera, A. (2018). ActivPAL™ determined seden-tary behaviour, physical activity and academic achievement in college students. Journal of sports sciences, 36(20), 2311-2316.
Fessler, N. & Stibbe, G, Haberer, E. (2008): Besser Lernen durch Bewegung? Ergebnisse einer empirischen Studie in Hauptschulen., in: Sportunterricht (8), 57. Jahrgang, S.250-256
Flade, A. (2018). Zurück zur Natur? Erkenntnisse und Konzepte der Naturpsychologie. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21122-6
Flade, A., & Dieckmann, F. (2008).Architektur: psychologisch betrachtet,unter Mitarbeit von
Dieckmann F., Rörbein R.H. Huber.
Flick, Uwe (2016): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung.
Gaschler, J. (2019). Die Freie Universität bewegt sich: Freie Universität Berlin, online in: https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/tsp/2019/tsp-september- 2019/hochschulsport/index.html [22.05.22]
Glöckl, J. & Breithecker, D. (2018). Active Office®. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18478-0
Hefel, A. (2017): Einleitung, OrthoNews. REGULA TIONS- UND MODER-NE OR THOMOLEKU-
LARE MEDIZIN.(Sonderausgabe 11-2017 tk260917.indd), S. 11
Helfferich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In: Baur, N., Blasius, J. (eds) Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_39
Henz, D. (2017): Wirkung elektromagnetischer Strahlung auf das Gehirn - gibt es wirkungsvolle Schutzmassnahmen, OrthoNews. REGULA TIONS- UND MODER-NE OR THOMOLEKULARE MEDI- ZIN.(Sonderausgabe 11-2017 tk260917.indd), S. 11
Herz, O. (2005): Stichwort Architektur: „ABC der Ganztagsschule“, 2005, hrsg. vom GEW- Hauptvorstand. Im Netzunter: www.abc-der-ganztagsschule.dezu finden. In: E&W (2/2007), S. 15.
Hildebrandt-Stramann et al. (2017): Bewegtes Lernen. Theoretische Grundlagen und reflektierte Unterrichtsbeispiele. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler.
Hoffacker, Maria (2022): Wie funktioniert das Gehirn beim Lernen? Online in: https://www.drmariahoffacker.com/gehirn-lernen/ [27.03.22]
Holzbrecher, Alfred (2012): Der Raum als „dritter Pädagoge“. Vorlesung vom 13.6.2012. Pädagogische Hochschule Freiburg, online in: https://de.readkong.com/page/der-raum-als- dritter-padagoge-schularchitektur-und-4264224 [07.04.22]
Huber, G. & Köppel, M. (2017). Analyse der Sitzzeiten von Kindern und Jugendlichen zwi-schen 4 und 20 Jahren. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2017(04), 101-106.
Kahl, Reinhard (2009):Der Raum ist der dritte Pädagoge. Film zum Münsteraner Konvent. Archiv der Zukunft.
Koeritz, J., Kolbert, L. & Winde, M. (2022).Zehn Leitlinien für zukunftsorientierte Lern-räume. Online in: https://www.stifterverband.org/medien/zehn-leitlinien-fuer-zukunftsorientierte- lernraeume [12.05.22]
Kraus et al. (2015):Erwachsenenbildung und Raum. Eine Einleitung, S. 11-23, in: In Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz- Zentrum für Lebenslanges Lernen (Hrsg.), Online: https://www.die-bonn.de/doks/2015- bildungstheorie-01.pdf [12.05.22]
Kruse, J. (2014). Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz.
Kuban, C. (2020). Laufend lernen - Schluss mit der 'Sitzschule'-komplett - DEUTSCHLANDRADIO. https://www.deutschlandfunkkultur.de/laufend-lernen-schluss-mit-der- sitzschule-100.html
Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung, Basel: Beltz juventa
Kuckartz, U. (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Weinheim; Basel: Beltz Juventa
Laging, Ralf (2017): Bewegung in Schule und Unterricht Autor: Ralf Laging, W. Kohlhammer Verlag.
Lern und Leistungsfähigkeit. In: Haltung und Bewegung, 23 (2), 5-15.
Löw M., Sturm G. (2016) Raumsoziologie. In: Kessl F., Reutlinger C. (eds) Handbuch Sozi-alraum.
Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19988-7 1-
Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 2001.
Ludwig (2012). Architektur aus Sicht der Bildungstheorie: Anforderungen an Bildungsräume. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung, 3, S. 26-29. W. Bertelsmann Verlag, online in: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51979/ssoar-die-2012-03-ludwig- Architektur_aus_Sicht_der_Bildungstheorie.pdf [05.03.22]
Lüke (2007): Willkommen in der Schule. Wenn Architektur und Pädagogik „heiraten“ kann Wunderbares passieren. In: Erziehung und Wissenschaft: Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW. (2/2007), S. 7-9.
Mayer, S. (2021). ALLES ERGONOMISCH IM (HOME)OFFICE - Transfer Together.
Mehnert, F. (2020): Lernräume in einem Kabinettsystem. In fünf Schritten zum resonanten
Lernraum, in:PÄDAGOGIK. Lernräume gestalten (6/20),S. 8-13.
Mein, G. & Rieger-Ladich, M. (2004). Soziale Räume und kulturelle Praktiken: Über den strategischen Gebrauch von Medien. Kultur und soziale Praxis. Bielefeld: Transcript.
Nuissl, E. (2006): Zur Aufgabe von Lernorten im lebenslangen Lernen. Der Omnibus muss Spur halten. DIE Magazin (IV/ 2006), S. 29-31, online in: https://www.die- bonn.de/zeitschrift/42006/nuissl0604.pdf [4-08-21]
Pickel, S., Pickel, G., Lauth, H.-J. & Jahn, D. (Hrsg.). (2009). Lehrbuch. Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft: Neue Entwicklungen und Anwendungen (1. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Pietsch, S. & Jansen, P. (2012). Different mental rotation performance in students of music, sport and education. Learning and Individual Differences, 22(1), 159-163. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.11.012
Priem, K. (2004): PÄDAGOGISCHE RÄUME - RÄUME DER PÄDAGOGIK. EIN VERSUCH ÜBER DAS DICKICHT, in: Georg Mein/Markus Rieger-Ladich (Hg.). Soziale Räume und kulturelle Praktiken. Über den strategischen Gebrauch von Medien. Bielefeld: Transcript, S. 27-42
Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2019). Forschungsdesigns für die qualitative Sozialfor-schung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozial-forschung (S. 105-123). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_7 Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek b. H., 319-331
Rohdenburg, D. (2019): Bewegung steigert die Konzentration. Kreiszeitung Landkreis Oldenburg Rosebrock, Cornelia & Nix, Daniel (2011): Lautlese-Verfahren. In: (Ders.)Grundlagen der
Lesedidaktik und der systematischen schulischenLeseförderung.Baltmannsweiler: SchneiderVerlag Hohengehren, 4. Auflage, S. 27-42
Rupp, R., Dold, C. & Bucksch, J. (2020). Bewegte Hochschullehre. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30572-7
Schmidt, T. C., Wählisch, M., Cycon, H. L., Palkow, M. & Regensburg, H., (2004). Bewegtes Lernen in mobilen Kommunikationsinfrastrukturen. In: Knop, J. v., Haverkamp, W. & Jessen, E. (Hrsg.), E-Science und Grid Ad-hoc Netze Medienintegration, 18. DFN-Arbeitstagung über Kommunikationsnetze. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.. (S. 249-263).
Schnack, J. (2020): Liebe Leserinnen und Leser; in: PÄDAGOGIK, Lernräume gestalten (6/20), S.3.
Schöllhorn (2017), Stiftung für Gesundheit und Umwelt (2017). OrthoNews. REGULA TIONS-
UND MODER-NE OR THOMOLEKULARE MEDIZIN.(Sonderausgabe 11-2017 tk260917.indd), S. 10-11.
Schratz, M. (2007): Der „dritte Pädagoge“. Architektur nutzbar machen für bildungspoliti-sche Ziele. In: Erziehung und Wissenschaft: Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW. (2/2007), S. 16.
Schultheis, J. (2022): Mitbestimmung unter Vorbehalt, in: E&W. Erziehung und Wissen-schaft. Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW, 2022 (01), S. 18-19.
Spektrum.de (2022): Neurotrophe Faktoren. Lexikon der Biologie. Copyright 1999 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg Online in: https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/neurotrophe-faktoren/46255
Spinner, Kaspar H. (2010): Methoden des Literaturunterrichts. In: Michael Kämper-van den Boogaart & Kaspar H. Spinner (Hrsg.):Lese- und Literaturunterricht. Teil 2: Kompetenzen und Unterrichtsziele; Methoden und Unterrichtsmaterialien; Gegenwärtiger Stand der empirischen Unterrichtsforschung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 190-242
Steinke, I. (2007): Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick, U./Kardorff, E. v./Steinke, I. (Hg.): Tischer, Th. A. (2007): „Mitsprache einfordern“. „Kinder in den Mittelpunkt der Gestaltung stellen“, in: Erziehung und Wissenschaft: Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW. (2/2007), S.17.
Universität Oldenburg (2022): Kugellager. Methodenkarte Universität Oldenburg. https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/methode/kugellager/
Universitätsmedizin Greifswald (2022): Wachstumsfaktoren und ihre Bedeutung der neuronalen Plastizität. Institut für Anatomie und Zellbiologie. Online in https://www2.medizin.uni- greifswald.de/anatomie/forschung/neuroanatomie/projekte/wachstumsfaktoren/ [10.07.22]
Wienecke, Elmar (2017): Mikronährstofftherapie der Zukunft - Case Reports, in: Ortho News, Sonderausgabe zum 12. internationalen Bodenseekongress, S.14-15
Wunderer, K. (2011-2012). Bewegtes Lernen und Gedächntis.: Eine Untersuchung zur Merkfähigkeit von Grundschulkindern.
Zoladz, J.A. & Pilc, A. (2010). Review Article. Economica, 70(280), 533-541. https://doi.org/10.1046/j.0013-0427.2003.00027.x
ANHANG
Begriffs- und Abkürzungserklärungen
„PH“: Pädagogische Hochschule
„Neue PH“ und „alte PH“:Wenn Proband:innen von der „Neuen PH“ reden, meinen Sie einen Neubau der Pädagogischen Hochschule, der sich etwa zehn bis fünfzehn Geh-Minuten von einem Altbau, der „alten PH“ befindet. Verschiedene Fachrichtungen finden in den jeweiligen Einrichtungen ihren Platz.
„Der Weg von der alten zur neuen PH“:Es kommt in dem Studium von Studierenden der PH je nach Fächerkombination und Stundenplan derweil vor, an einem Tag verschiedene Veranstaltungen in der neuen und alten PH besuchen zu müssen, was darauf hinauslaufen kann, mehrmals eine Strecke von zehn bis fünfzehn Geh-Minuten zurück zu legen, um von dem dem neueren Gebäude zu dem älteren Gebäude der Hochschule zu gelangen.
„Bib“:Bibliothek. Meist wird mit der „PH Bib“ die Bibliothek bei dem älteren Gebäude der PH gemeint, in dem neuen Gebäude findet sich für die Literaturrecherche der „Lesesaal“.
„Technologiepark“:Gebäude und Seminarräume nähe der „neuen PH“, die auch von Uni- versiätsstudent:innen mitgenutzt werden.
„Seminarwiese“: Der erste gebaute Außenlernraum vor der „neuen PH“.
Ausführlich(er)e Falldarstellung
Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der Aussagen der Proband:innen vorgestellt. Im Unterschied zu den Transkripten wurde hier bei wörtlichen Zitaten darauf verzichtet, eine Betonung oder Pause zu markieren (siehe Transkriptionsregeln). Die Positionen sind die in MAXQDA automatisch vorgenommenen Zeitmarker (siehe Anhang Transkripte).8889
Im Folgenden wurden Groß-Schreibungen und Pausenmarkierungen, wie Wortwiederholungen der besseren Lesbarkeit halber rausgenommen. Die Fälle wurden grundsätzlich nicht in alphabetisch sortiert oder genannt, sondern nach Aussagekraft in Hinblick auf die Forschungsfrage.
Luisa
Luisa, weiblich, war zu dem Zeitpunkt des Interviews 22 Jahre alt und studierte Mathe und katholische Theologie im 1. Master-Semester für Grundschullehramt. Luisa, kann wirklich überall lernen, so nimmt sie auch mal Lern-zeug mit in den Bus, beim Warten in Arztpraxen (vgl. 18 - 19 (0)). Für eine Prüfung würde sie sich allerdings daheim vorbereiten (vgl. 14-15). Einen Lernraum unterscheidet sie nicht von einem Lehrraum, sie findet eher, dass beides kombinierbar ist, da Lehren oftmals auch Lernen impliziert (Pos. 20 - 23 (0)).
Für Luisa gibt es zwei Arten von typischen Lernräumen, einmal die typischen Vorlesungsräume mit Treppen und Stühlen, wie ausklappbaren Tischen und dann die Seminarräume (24 - 25 (0)). Im Vergleich zu den Seminarräumen, in denen „oft ausreichend Platz“ war (127 - 127 (0)), fand sie die Vorlesungssäle sehr beengend (125 - 125 (0)).
Als Luisa noch an der PH vor Ort studiert hat, war sie meistens unter der Woche täglich vier bis sechs Stunden durchschnittlich in Lernräumen90- abhängig vom Stundenplan (vgl. 105 - 109 (0)). Auf die Frage in welchen Lernräumen sie gerne studiert nennt die Grundschullehramtsstudentin als Hauptfaktor den Aspekt, solche in denen sie Kontakt zu anderen Studierenden hat, um Austausch zu haben (92 - 99 (0)).
Lernräume nicht den Bedürfnissen nach anpassbar
Ihren Bedürfnissen nach anpassbar sind die Lernräume eher nicht, sie meint, man nähme das, was, was einem gegeben ist „Stuhl, Tisch, und so weiter“, schafft sich höchstens durch das Ausbreiten der Unterlagen seinen eigenen Bereich, „aber jetzt den Raum an sich mitgestalten oder umgestalten eher weniger, ne“ (Pos. 110 - 113 (0)). Eine Umgestaltung der Lernräume findet sie im Besondern hinzu Bewegungsaktivierung wichtig.
Im Vergleich zur Schule hat sich nichts geändert
Als sie gefragt wird, wie ein typischer Lernraum für sie aussieht, setzt sie Klassenzimmer und Seminarraum fast gleich: „eher ein Klassenzimmer, beziehungsweise Seminarraum, mit Tischen und Stühlen, (lacht). Meistens eben ganz vorne, wo der Präsentator ähm irgendwas anhängen kann, schreiben kann und äh die anderen zuhören“ (Pos. 12 - 13 (0)), meistens hätte der oder die der Lehrende noch seinen Platz dort und die Studierenden gucken Richtung Lehrenden gucken - allem in allem hätte dies eine typische Unterrichts-Formation. Durch Nachfragen was sie unter typischer Unterrichtssituation versteht, meint sie, dass sie sich auf Erfahrungen von der 1. bis zur 12. bezieht und sich nicht viel geändert hat dann danach im Studium, eher hätte es sich die Lernaumgestaltung bis zum Studium so durchgezogen - der einzige Unterschied sei „das Treppenförmige“ in den Vorlesungssälen (Luisa, w. Pos. 24 - 35 (0)).
Statisch gebaute Räumlichkeiten machen müde und schmälern die Motivation
Die Lernraumbeschaffenheit in Vorlesungssälen und die damit einhergehende Bewegungsarmut führt dazu, dass man sich bemühen müsse, konzentriert zu bleiben (Pos. 101 - 101 (0)) und das Mobiliar dass bisher zur Verfügung steht führe dazu, dass sie eine schlechte Haltung einnehmen würde, einen Einfluss auf ihre Motivation spüre und aufpassen müsse, nicht müde zu werden (135 - 135 (0)). Auf Nachfragen, wann diese Müdigkeit eintritt, antwortet sie, dass, je nachdem, wie die Umgebung gestaltet ist, oder wie viele Veranstaltungen schon vorher hatte, kann dies schon nach einer halben Stunde eintreten (Pos. 138 - 143 (0)). Luisa hat außerdem erlebt, „dass man irgendwie steif wird im Körper so und nicht mehr so beweglich ist und nicht mehr so auch aktiv dann im Kopf mitdenkt“, weshalb sie glaubt, dass „so ein Wechsel, immer mal wieder [...] mehr Schwung reinbringen würde „in das Ganze, und ähm dann auch ins Lernen und ins Denken“ (Interview Luisa, w., Pos. 134-138). Dagegen hätte bei Online-Vorlesungen zumindest geholfen im Stehen zu studieren (144 - 147 (0)).
Dozierenden-Verhalten beeinflusst Studierende
In Präsenz-Veranstaltungen der PH probierte sie das Aufstehen noch nie aus, da sie dachte es würde eventuell komisch rüberkommen. Auf Nachfragen was dieses Gefühl ändern könnte meint sie, die Bestätigung von Dozent:innen gegenüber der Student:innen, dass es okay ist auch mal aufzustehen., Ansonsten könnte davon ausgegangen werden, eventuell unhöflich oder uninteressiert rüberzukommen, wenn man aufsteht (Interview Luisa (w.), Pos. 145-153). So habe es ihr etwa geholfen, als ein Dozent online einmal dazu animierte aufzustehen und sie mehr dazu motiviert, das mal auszuprobieren (Pos. 153 - 157 (0)). Irgendwann stellte sie sich einen Hocker hin und lernte im Stehen, oder hörte dem Dozenten stehend zu, wippte manchmal auf- und ab auf den Zehen, wechselte zwischen Sitzen und Stehen und merkte, wie sie aktiver blieb.
Bewegungsaktivierend(er)e Didaktik: bisher nur inSeminarräumen erlebt
Wenn die Grundschullehramtsstudentin Luisa die Wahl hätte, würde sie sich schon auf auf einen Raum festlegen, indem sie auch mal aufstehen kann, rumlaufen kann, mal den Platz wechseln kann, also allgemein die Haltung ändern kann (115 - 117 (0)).
An der PH ging dies nach Luisa nur annähernd in Seminarräumen - manchmal mehr, manchmal weniger. Sie erlebte auch Dozent:innen, die dann auch wirklich Methoden eingebaut hatten (158 - 161 (0)). Ideen für bewegungsaktivierende(re) Didaktik hat sie jedoch einige, wie etwa als Beispiele für eine Kombination von Lernen und Bewegen die Methode „Kugellager“ oder Lernspiele für den Mathe-Unterricht, da sei schließlich Bewegung in der Methode inbegriffen. Außerdem würde sie Schüler:innen später die Möglichkeit lassen, zu jeder Zeit die Wahl lassen ihre Aufgaben auch im liegen; stehen; sitzen zu bearbeiten (Pos. 71 - 71 (0)).
Wissenüber Bewegungsaktivierung mehrfördern da wichtig
Sie hatte dazu in dem Übergreifenden Studienbereich (ÜSB) der PH sogar schon einmal ein Seminar in dem Bewegungsaktivierender Unterricht von einem Dozenten der Gesundheitsförderung der PH gefördert wurde. Sie betont, dass das sitzende Verhalten schon in der Schule trainiert wird, „genauso wie es bei uns in der Vergangenheit trainiert wurde, dass wir die ganze Zeit sitzen im Unterricht“ (Pos. 52 - 58 (0)). Sie findet das erschreckend und weiß gleichzeitig, dass es eine Gewohnheitssache ist. Sie selbst hat es schon ausprobiert im Stehen zu lernen und musste sich auch erst einmal dran gewöhnen, hat aber dann gemerkt, dass es guttut, weshalb sie die Ansicht vertritt, dass es auch in der Hochschule mehr Flexibilität und Entscheidungsfreiheit in der Hinsicht geben sollte (vgl. Pos. 52 - 58 (0)). Das Seminar aus der Gesundheitsförderung im Übergreifenden Studierendenbereich (ÜSB) hat sie geprägt, da dies jedoch ein freiwilliges Seminar war, fände sie es gut, wenn es dies als Pflichtseminar für Lehramtsstudierende gäbe, es also mehr in Lehramtsstudiengänge etabliert werden (Pos. 258 - 262 (0)). Besonders Lehramtsstudierende prägen wiederum die Schüler:innen, beschreibt Luisa und sagt, dass allgemein alle Lehrkräfte dafür sensibilisiert werden sollten. Mehr Aufmerksamkeit und Sensibilisierung wäre ihrer Ansicht nach sehr wichtig für das Thema Bewegung und Lernen und wie ungesund zu langes Sitzen sei, denn es wirke sich ja doch auf die Gesundheit und das Lernen aus. Als sie in dem Seminar in ÜSB erfahren habe und selbst merkt, dass die Durchschnitts- Sitzzeit von Studierenden sehr hoch ist, weshalb sie denkt, dass in der Richtung mehr getan werden müsste (ebd., 282 - 284 (0)).
Bedürfnis nach bewegungsaktivierende(re)r Gestaltung und dem Zugang dazu
Luisa äußert mehrmals die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach bewegungsaktivie- rend(er)em Mobiliar und damit zusammenhängende Utensilien. Auch bei der Frage welches Mobiliar sie sich wünschen würde, erwähnt sie Tische mit höhenverstellbarer Tischplatte, die außerdem leicht verschiebbar sind, dass man da auch mal die Formation ändern kann (ebd., Pos. 131 - 133 (0)). Als bewegungsaktivierende(re)e Ausstattung nennt sie Wackel-boards91und Prezi-Bälle, wie spezielle Boden-Matten (ebd., 185 - 199 (0)).92
Auf die Frage wie ein Lern- oder Lehrraum in einer Hochschule ihrer Meinung nach, gestaltet sein sollte, damit bewegungsaktivierendes Studieren möglich ist bezieht sie sich auf höhenbewegliches Mobiliar, wie höhenverstellbare Stehtische und höhenverstellbare Stühle, dass man seine Sitzhöhe einstellen kann (ebd., 131 - 131 (0)). Dass es ein paar einzelne Räume mit bewegungsaktivierend(er)em Mobiliar und Utensilien gibt, ist ihr bekannt, jedoch gäbe es diese eben nicht flächendeckend in jedem Raum (ebd., 77 - 79 (0)). Weiter sollte das Mobiliar generell variabel und flexibel stellbar ist und die Plätze auch während dem Seminar gewechselt werden (ebd., 171 - 173 (0)).
Für Partizipation mehr Umfragen und mehr Aufmerksamkeit für die Lenraumgestal- tung
Luisa fände mehr Umfragen mit Nutzer:innen sinnvoll, entweder in Seminaren oder online, wobei dann allerdings wichtig ist, dass die Bedürfnisse und Wünsche auch umgesetzt werden. Studierende, wie Lehrende und generell alle die, die Räume nutzen sollten konkret in die Lernraumgestaltung miteinbezogen werden (ebd., Pos. 278 - 280 (0)).
Generell findet sie es ein wichtiges Thema und sie würde Lernraumumgestaltung an der PH unterstützen, nur für zeitlich sehr einnehmendes Engagement bei der Lernraumgestaltung an der PH würde ihr leider eher keine Zeit übrigbleiben, da sie sehr viel ehrenamtlich tätig ist (ebd., 256 - 256 (0)).
Außenlernräume tragen zu Fitness bei
Außenlernräume fördern nach Luisa, dadurch, dass man an der frischen Luft wäre, auch, dass man sich fitter fühlt, dass man auch viel mehr Lust hat, vielleicht, sich in Bewegung zu gehen und, dass man da ja, motivierter ist (ebd., Pos. 211 - 211 (0)). Zusätzlich habe man mehr Platz und könne in verschiedenen Positionen lernen: „kann man sich natürlich auch gut auf das Gras setzten. Man kann sich hinlegen, also, ich finde, dass bietet auch viele Möglichkeiten der Bewegung (Pos. 230 - 233 (0)).
Lisa
Lisa war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und im 5. Mastersemester für Bildungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Außerschulische Erziehung und Bildung im Kontext gesellschaftlicher Heterogenität. Sie stand dort kurz vor Beendigung des Abschlusses und hatte gerade ihre Masterarbeit angefangen. Die Besonderheit bei Lisa ist, dass sie zuvor den Bachelor in Lehramt für die Sekundarstufe I in Englisch und Alltagskultur und Gesundheit absolviert hat.
Drinnen- und „im Freien“-Lernerin
Sie wohnte nicht mehr vor Ort in Heidelberg, da sie keine Kurse mehr vor Ort hatte und befand sich im Home-Office an einem anderen Ort, um ihre Masterarbeit zu schreiben. Als sie noch an der Pädagogischen Hochschule vor Ort war, hat sie hauptsächlich in der Bibliothek, oder in der WG studiert und gelernt, manchmal dort sogar auf dem Balkon. In der Bibliothek hat sie sich vor allem in Prüfungsphasen zum Lernen und für das Schreiben von Hausarbeiten aufgehalten, da dort weniger Ablenkung war. Zuhause in der WG hatte sie dagegen gerne recherchiert, Literatur gesucht und oder studienrelevante Videos angeschaut. Den Lesesaal in der „neuen PH“ hatte sie als auch gerne genutzt, weil es dort eine gemütliche Sofa-Ecke gibt und weil der „schön hell“ war. Jedoch lernte und studierte Lisa nicht nur in Innenräumen, sie erzählte nach konkretem Nachfragen, dass sie durchaus auch mal gerne draußen im Freien komplett weg von der PH lernte, wie zum Beispiel in den Weinreben, wobei hauptsächlich zum ausgedruckte Texte lesen, einen Computer an solchen Orten zu bedienen fände sie schwierig, sagt sie.
Keine Trennung Lehr- und Lernraum
Einen Lehrraum würde sie nicht klar von einem Lernraum trennen, weil ihrer Meinung nach in einem Lernraum sich auch Kommilitoninnen gegenseitig belehren, demnach auch „Lehre“ in Lernräumen stattfindet. An der Pädagogischen Hochschule verbrachte sie, zusätzlich zu der Teilnahme an Veranstaltungen, noch drei bis vier Stunden am Tag in Lehr- oder Lernräu- 93
men.
Hörsäle und unbequemes Mobiliar in einem typischen Lernraum der PH
Als Orte, die ihr spontan in den Sinn kam, wenn sie an einen Lernort denkt, nannte sie die Hörsäle der Pädagogischen Hochschule. Im speziellen nannte sie den Raum „222“ der alten Pädagogischen Hochschule. Dabei betonte sie speziell die Ausstattung, also „so diese Klappstühle, die sich so runterklappen lassen“ und die Tische, die sich dadurch auszeichnen, dass man sie „nicht versetzten kann“ und wirft hinterher, dass diese unbequem seien (Pos. 28-33). In Veranstaltungen in Seminarräumen wurde sich zwischendurch mal bewegt, in Hörsälen säße man derweilen sogar 90 Minuten am Stück, sagt sie, die einzige Bewegung wäre gelegentlich durch einen Toilettengang zustande gekommen. Bei der Frage wie ein typischer Lernraum an der Pädagogischen Hochschule für sie aussieht, erwähnt sie als erstes, dass die Lehrräume nicht gerade modern ausgestattet waren, erinnert sich nach kurzem Nachdenken aber sofort an ein Seminar als einen Lernraum in dem es „Sitbikes“ also Tretfahrräder gab und „bewegliche Hocker“, der ihr sehr gut gefallen hat. Abgesehen von diesem einen Seminarraum mit beweglichem Mobiliar meint sie, sind überall Tische und Stühle vorhanden, ansonsten beschreibt sie als Ausstattung eines typischen Lernraumes an der Pädagogischen Hochschule weiter Audio-ein und Ausgänge, wie etwa Lautsprecher, Beamer, oder auch mal einen Tageslichtprojektor. Insgesamt überwiegen die negativen Zuschreibungen von Lernraumeigenschaften der PH überwiegen, wie „unbequem“ und „nicht wirklich.modern“.
Lernraumumgestaltung an der PH notwendig
Als es darum geht, was denn an der Lenraumgestaltung in der Pädagogischen Hochschule geändert werden sollte, erwähnt sie nicht nur, dass es „es eine bestimmte Qualität an Stühlen geben sollte“ was Bequemlichkeit angeht, sondern auch, dass sie bewegliches Mobiliar toll findet, wie die beweglichen Sitzhocker. Sie fand diese „echt gut, weil man [.] kann sich, also, man bewegt sich automatisch, ob man jetzt will oder nicht.“ (Pos. 71-80). Als das Interview-Gespräch von den Lernräumen handelt, in denen an der Pädagogischen Hochschule studiert wird, lenkt sie das Gespräch wieder zu der Thematik des Lernraumes mit bewegungsaktivierendem Mobiliar, als sie sofort entgegnet, dass sie ja in den Lernräumen, in denen sich die beweglichen Hocker befinden, nicht studieren konnte, da diese für Seminarräume genutzt wurden und ansonsten nicht frei zur Verfügung standen. Jedoch hätte sie diese gerne öfters genutzt. Eine Lernraumumgestaltungsnotwendigkeit mit einer gewissen Dringlichkeit sieht sie auf jeden Fall, so sollte es beispielsweise Stühle geben, die verrückbar sind und nennt weiter93als Begründung in dem Zuge, dass es viele Vorteile bringt, wenn man sich zwischendurch bewegen kann. Die Pädagogische Hochschule sollte dahingehend ihrer Meinung nach die Lernräume weiterentwickeln. Sie erwähnt dabei auch die beweglichen Sitzhocker, die sie „echt gut“ fand, weil man sich bei dem Sitzen auf diese automatisch bewegt, ob man will oder nicht (Pos. 71-79). Diese wie auch Sitbikes oder Tretfahrräder sollten ihrer Meinung nach weitflächiger angewendet werden (und nicht nur in einem Raum vorhanden sein), wie von ihr bisher festgestellt). Allgemein wünscht sie sich mehr bewegungsaktivierend(er)es Mobiliar und mehr Zugänglichkeit zu diesem.
Bedürfnisanpassung etwas vorhanden
Bei der Frage ob sie denn die Lernräume ihren Bedürfnissen nach anpassen konnte, beschreibt Lisa, dass sie in der alten PH die Möglichkeit durch das Vorhandensein mit Stehtischen „ein bisschen“ ihren Arbeitsplatz anpassen konnte, doch im Vergleich konnte man im Lesesaal der neuen PH überhaupt nicht seinen Arbeitsplatz anpassen.
Negative Auswirkungen von zu vielem Sitzen bereits erfahren
In dem Gespräch wird deutlich, dass die Interviewpartnerin bereits nicht nur über die Folgen von zu langem Sitzen weiß, sondern sie ebenfalls bereits erlebt hat: so erzählt sie, dass Sitzen sehr schlecht für den Rücken und vor allen Dingen für die Lendenwirbelsäule und das Becken sei. Auf die Nachfrage, woher sie das alles wüsste, erzählt sie, dass sie selbst Probleme mit dem Rücken habe, deswegen Physiotherapie bekomme und ihre Physiotherapeutin davon erzählt habe. Diese empfehle ihr zusätzlich auch mal zwischendurch aufzustehen und ein paar Minuten zu laufen und sich zu bewegen. Sie glaubt deshalb, dass positive Folgen von mehr Bewegung beim Studieren auftreten können, in dem Sinne, dass wenn Studierende die Möglichkeit bekommen, sich „sich - auch wenn es nur für ein paar Minuten sind - sich mal hinzustellen, und einfach. Auf der Stelle zu Laufen [.] erstens Mal besser konzentrieren können [.] und auch weniger körperliche Probleme bekommen [.] also was Rückenschmerzen anbelangt“ (Pos. 191-195). Zusätzlich glaubt sie, dass durch die Aktivierung von Bewegung, wie durch etwa Sportgeräte oder andere kleine Hilfsmittel wie Massagebälle, mehr Motivation entstehen kann.
Bewegung und Lernen an der PH
Lernaktivitäten in Verbindung mit Bewegung an der Pädagogischen Hochschule verbindet sie auch nur mit speziell diesen zwei erwähnten Räumen mit Sitbikes, Sitzhockern und Stehti- schen.94Abgesehen von eigenständiger Bewegung in den Pausen der Veranstaltungen hat sie in Veranstaltungen der PH ausschließlich in Seminaren Bewegung in Zusammenhang mit Didaktik kennengelernt, wie Lernspiele -sogar einmal auf dem Hof der PH- Gruppenarbeiten und Stationenlernen.
Als Ideen für Bewegung nennt sie einmal für Ansatz 1 (Bewegung vor, zwischen, oder nach dem Lernen), dass Regeln festgelegt werden in einer Veranstaltung, wie etwa dass alle 15 Minuten der Platz getauscht wird. Für Ansatz 2 (Kombination Bewegung und Lernen) nennt sie die Beispiele Bewegungs-Spiele oder -Aktivitäten in Veranstaltungen einzubauen,
Bedürfnis nach mehr Zugang zu bewegungsaktivierende(re)m Mobiliar
Bezüglich des Mobiliars und der Ausstattung der Lernräume in Bezug auf Bewegung hat sie außer dem schon genannten bewegungsaktivierenden Mobiliar wie bewegliche Hocker oder Sitbikes, welche ihrer Meinung nach weitflächiger angewandt werden sollte (vgl. ebd. u.a.
Pos. 185 - 187). Auf die Frage welches Mobiliar sie sich wünschen würde, meint sie: „ähm. Mobiliar ähm, wo man einfach sich mehr bewegen kann. [...]“ (Interview Lisa, w. Pos. 184189).
Bezüglich der Bewegungsaktivierung nennt sie noch weitere Ideen. Sie nennt Balance-Kissen, Wackelboards und „einfach so kleine Sportgeräte. Wie jetzt zum Beispiel, diese [.] Handpressen, wo man so ein bisschen seine Finger-Stärke trainieren kann, oder seine [.] Schulter- und Arm-Kraft. [.] Oder auch so Massage-Bälle, wo man einfach mal so auf dem Tisch und so rollen kann, das fördert ja auch die Durchblutung“ (Lisa, w. Pos. 256 -253). Die Anordnung des Mobiliars schlägt sie vor, könnte derart vorgenommen werden, dass beispielsweise die Tische so gestellt werden, dass man sich nicht einfach zu jemandem rüber beugen kann, wenn man mit jemandem reden will, sondern zu jemandem laufen muss.
Partizipation Lernraumgestaltung: mehr Transparenz gewünscht
Was die Partizipation bei der Lernraumgestaltung betrifft, beschreibt Lisa, wie sie sich bei der Planung beteiligen würde und findet, dass mehr Umfragen für Studierende gemacht werden sollten und mehr nach den Bedürfnissen der Studierenden gefragt werden sollte. Als Idee nennt sie, dass Studierende eigene Konzepte erarbeiten könnten und Vorschlage auf DIN A3 oder Postern oder so gemalt werden können und es ein Gremium gibt, in dem diskutiert wird, was machbar ist. Online auf der Website der PH könnte Lisa's Vision nach ein Forum eingerichtet werden, wo „alle Angehörigen oder Mitglieder:innen der PH irgendwie, ihre Vorschläge einbringen können. Sie beschreibt, wie auch andere Akteur:innen in die Lernraumgestaltung miteinbezogen werden sollten: „dazu dann auch die StudentInnen und Studenten und Professorinnen und Professoren und alle an der PH dann, also ja, was heißt alle, aber ja, so Dozentinnen und Dozenten dann befragen [.] was sie sich wünschen, und dann so ein Konzept zu erarbeiten (...) und dann so die eigentliche Umsetzung, das ganze jetzt Beschaffen und so, ähm aufzubauen. Ähm das so ein bisschen zu begleiten. [.] ähm fände ich ganz spannend so, das so als, als Gruppe zu machen“ (Lisa, w. 0:45:07- 0:46:29). Für die Genehmigung sollte noch das Rektorat mit in die Lernraumgestaltung miteinbezogen werden, wie auch Lehrende und andere Mitarbeitende, wie Bibliotheksangestellten. In dem Zusammenhang der Partizipation bemängelt Lisa die Transparenz der PH was finanzielle Mittel angeht.
Sonstige Bedürfnisse
Weitere Bedürfnisse, die sie während des Gesprächs erwähnt und beschreibt sind für sie sind eine gute Belüftung, dass es eine Wahl gibt, „sich. die Sitzgelegenheit auszusuchen [.] [s]elbstverständlich auch die ähm freie Wahl zwischen normalem Tisch oder höhenverstellbarem Tisch“ (Lisa, w. Pos. 248-253). Neben dem Bedürfnis zu stehen beim Lernen oder Studieren, existiert allerdings auch das Bedürfnis zu sitzen, das käme bei ihr ganz darauf an: wenn sie sich stark konzentrieren müsse, sitze sie lieber, wenn sie nur zuhören muss, wie bei einem Vortrag, würde sie gerne stehen.
Weitere Bedürfnisse an Lernräume die deutlich werden sind für Lisa, dass es hell und ruhig genug ist.
Außenlernräume bieten viele Bewegungs-Möglichkeiten
Nach Lisa eignen sich Außenlernräume für Sport- Einheiten (Pos. 289 - 290 (0)) und für verschiedene Körperhaltungen beim Lernen, wie Liegen (Pos. 313 - 317 (0)).
Anna
Anna, weiblich, war zu dem Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre alt und hatte zu dem Zeitpunkt der Befragung gerade erst mit dem Referendariat begonnen. Ihren Masterabschluss für das 107 Lehramt für die Sekundarstufe I Englisch und Mathe hatte sie erst vor einigen Monaten absolviert.
Lieblingslernort: Zuhause
Anna lernt tatsächlich am liebsten zu Hause, zumindest für das „eigene Lernen und eigene Wiederholen“ in ihrer gewohnten Umgebung. In der Bibliothek war sie so gut wie nie zum Lernen, sagt sie, da ihr da war ihr „zu viel los [.] außen rum“ Wenn sie an einen Lernraum denkt, kommt ihr spontan also auch ihr eigener Schreibtisch in den Sinn, meint sie (Pos. 1216).
Keine klare Trennung Lehr- und Lernraum
Anna würden einen Lehrraum nicht klar von einem Lernraum trennen, da, ihrer Meinung nach, lernen und lehren immer zusammengehört: „Ohne, dass ich was gelehrt bekomme, kann ich ja nichts lernen, ähm (...) ja. Also, ich, ich brauche ja in gewisser Form erstmal Input. Und ähm den verarbeite ich dann. ähm von daher würde ich schon auch sagen, dass ein Lernraum und Lehrraum zusammengehören“ (Anna, w. Pos. 21-28). Auf die Frage, ob sie diese Sicht auch auf ihr Zimmer übertragen würde, dass sie auch als Lernraum sieht, erläutert sie: „naja, so jetzt. In den ganzen Online-Semestern hat man das ja sehr gut gesehen, da hat das ja wirklich, äh ja ich würde sagen, mehr oder weniger gut funktioniert, aber trotzdem hat das, also habe ich viel Neues dazu gelernt. ähm. Ja wie die digitalen Vorlesungen aufbereitet waren, war natürlich äh wieder eine andere Frage, aber ähm ja. Doch, ich habe auf jedem Fall an meinem Schreibtisch viel Neues dazu gelernt“ (ebd., 21 - 28 (0)).
Mensa als wichtiger Lernortfür dasBedürfnis nach Kommunikation und Austausch
Zudem erwähnt sie die Mensa als wichtigen Lernort. Dabei dieser diente der Kommunikation und des Austausches über Studieninhalte und für das Lernen in Gruppen. So beschreibt sie wie vor der Corona-Pandemie „also, als man sich wirklich noch treffen konnte, in den Gebäuden der PH studiert hat“ für sie in jedem Fall dazu gehörte, dass man „sich auch zusammen in der Mensa noch zusammensetzt, da zusammen ähm isst und äh da eben auch, noch einmal die Inhalte der letzten Vorlesung bespricht, oder, ähm irgendwas für das nächste Seminar vorbereitet, oder Gruppenarbeit macht und so weiter“ (Interview Anna (w.), Pos. 80). Sie habe sehr oft mit ihren Lerngruppen in der Mensa gelernt. Vor allem das Zwischenmenschliche fand sie dabei „ganz besonders wichtig“ (ebd., Pos. 83 - 92 (0)).
Da sie weiß, dass aus der Forschung bestätigt ist, dass man sehr viel auch in Interaktion mit anderen Menschen lernt „und ähm auch dadurch, dass man nicht unbedingt immer alles; vorgegeben bekommt, oder ähm, ja, dass einem der Lehrer oder der Dozent einem alles vorkaut und man das einfach alles nur konsumiert“, erachtet sie es als notwendig, die Lernräume entsprechend anzupassen (Pos. 40 - 40 (0)).
Die Mensa als Lernraum betrachtend konnte sie allgemein diesen jedoch kaum ihren Bedürfnissen anpassen, lediglich das Mobiliar verschieben (ebd., 93 - 94 (0)). Sie umschreibt ebenfalls wie bewegungsaktivierender(er)s Mobiliar nicht nur dazu beiträgt, dass man aktiver ist, sondern auch mehr Kommunikation und Austausch ermöglicht, denn „wenn man dann STEHT oder eben ja an, an diesen erhöhten Tischen die, die Aufgaben bearbeitet [.] dann ist man einfach auch viel aktiver und, ähm dann ist es auch noch leichter irgendwie mal schnell, sich, sich mit, mit jemandem auszutauschen, mal noch rumzulaufen, ähm (...) ja, als wenn man die ganze Zeit passiv nur sitzt“ (Interview Anna (w.), Pos. 62-66).
Bedürfnis mehrZugänglichkeit zuRäumen mit bewegungsaktivierender(e)m MobiliarSie erzählt, wie sie bewegungsaktivierende(re)m Mobiliar in speziellen Seminarräumen in ihrem Studium begegnet ist, aber zu wenig Seminare in diesen Räumen hatte, was sie sehr schade fand (vgl. Pos. 62 - 66 (0)). Deutlich wird, dass die steigende Vielfalt des Mobiliars zu ihrer Zufriedenheit beiträgt, denn auf die Frage, ob sie denn zufrieden sei mit dem ihr zum 108
Studieren zur Verfügung stehenden Mobiliar bejaht sie und begründet: „[.] ja, also, ich denke, gerade jetzt, wo es auch immer mehr von diesen Stehtischen auch in den Seminarräumen gibt, ähm, wird die Vielfalt der Räume ja auch immer größer [.] (vgl. Pos. 103-106).“
Hörsäle deutlich bewegungsarmer als Seminarräume
Anna denkt bei einem typischen Lernraum an der Pädagogischen Hochschule bezüglich des Lernens „im Sinne von Input-Bekommen“ an Seminarräume oder die Hörsäle. Grundsätzlich positioniert sich Anna im Gespräch, dass sie die Seminarräume eigentlich in ihrem Studium am besten fand. Anna beschreibt eine typische Ausstattung der Lernräume in der PH mit einer Leinwand mit Beamer. Sie unterscheidet die Art des Mobiliars in Seminarräumen von Hörsälen. So gibt es in Seminaren in dem Sinne beweglicheres Mobiliar, als dass Tische und Stühle bewegbar sind, was in Hörsälen nicht der Fall ist, dort sei es eher vorgeschrieben, wo man sitzen muss (vgl. 30 - 30 (0)). Die Hörsäle seien dagegen „ganz klassisch“ aufgebaut, so dass vorne eine große Tafel sei, eine große Leinwand und viele fest installierte Sitzreihen (vgl. Pos. 29 - 30 (0)). Annas Erzählung nach steigt die Sitzzeit in Hörsälen zu 90 Minuten am Stück und „wenn man mehrere Vorlesungen dann am Stück hat, sitzt man ja schonmal ähm wirklich äh den, den (...) halben Vormittag, oder ja [.] wahrscheinlich sogar noch länger“, was sie als ungesund deklariert (ebd., Pos. 70 - 74 (0)).
Die praktizierte Bewegung hatte sich in Hörsälen Annas Erzählung nach deutlich von der in Seminarräumen unterschieden. Auf die Frage, wo an der PH sie Lernaktivitäten mit Bewegung verbindet, wird deutlich, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen der Didaktik in Seminarräumen im Vergleich zu Hörsälen:
„also hauptsächlich in, speziellen Seminaren, würde ich sagen. Also in, in den Fächern, in didaktischen Seminaren. Da wurde das aufgegriffen, das Thema, aber, oder auch umgesetzt jetzt bei uns Studenten, ähm speziell eben in den Seminaren, aber, ähm ja. Die Vorlesungen waren halt einfach, recht starr, so insgesamt“ (Pos. 113 - 114 (0))
Lernraumungestaltung zu mehr Abwechslung undpersönlichem Bezug
Anna sieht keinen Zweifel daran, dass an der PH eine Lernraumumgestaltung wichtig ist, vor allem was die Lernraumgestaltung in Zusammenhang mit der Hochschuldidaktik betrifft: „Auf jeden Fall, also. Ich meine wir haben auch ähm Vorlesungen, oder Module in der Psychologie und da, da hört man ja immer wieder, dass ähm so allein dieses lehrerzentrierte Lernen äh nicht unbedingt das Beste ist, näh. Und das haben wir ja in den Vorlesungen ganz oft, dass wir eben ähm von unseren Professoren, oder Dozenten ähm ganz viel Input bekommen und dann erwartet wird, dass wir das quasi ja, konsumieren, verarbeiten, und dann in der Prüfung äh reproduzieren können“ (Pos. 37 - 38 (0)). Mehr Abwechslung in der Lehr-Didaktik, wie etwa von frontalem Lehren wegzukommen, würde sie begrüßen. Dies würde ihrer Beschreibung nach mit einer Lernraumumgestaltung zusammenhängen (vgl. etwa Pos. 40; 5356). Anna beschreibt, dass sie sich zwar wegen dort sich befindlichen Menschen wohl in den Lernräumen der PH gefühlt hatte, aber bemerkt, dass die Gestaltung viele Räume eher unpersönlich war, die Wände oft kahl, weshalb sie in dem Bereich Verbesserungspotenzial sieht.
Erlebte positive Auswirkungen mehr Bewegung und negative Folgen zu wenig Bewegung beim oder zwischen dem Studieren
Die Lehramts-Absolventin Anna, lässt in dem Interview viele Vorteile von Bewegung beim Studieren durchblicken. Dabei erwähnt sie nicht nur, dass sie ihrer Erfahrung nach bei der Nutzung von Stehtischen aktiver war und bessere Kommunikation mit Kommilitoninnen ermöglicht wurde, sondern nennt zahlreiche weitere Erfahrungen mit Bewegung und Lernen.
In der Präsenzlehre sei eine Bewegungspause oft der unvermeidliche Lauf- oder Fahrradweg von einem Gebäude zu der PH zu einem anderen gewesen, allerdings hätte dies schon positive Effekte gehabt, weshalb Anna für sich die Erkenntnis zieht, dass Bewegung in Veranstaltungen gehört: „Also man hat ja eine halbe Stunde zwischen den Veranstaltungen, aber auch da ist man ja nicht nur äh in Bewegung ähm (...) wenn man, dann von der neuen PH in die alte oder umgekehrt gependelt ist, dann hatte man automatisch frische Luft und Bewegung und das hat auch immer total gut getan, aber ähm, ja, wenn man jetzt immer nur von einem Raum in den nächsten wechselt, dann ist das ja wirklich - es sind ja nur ein paar Schritte. Ähm von daher, ja, fände ich es auch wichtig, wenn Bewegung auch äh immer aktiver eben in die normalen Präsenz-Vorlesungen oder Seminare miteinbezogen wird“ (Pos. 175 - 176 (0)).
In Veranstaltungen an der PH hatte sie am allermeisten in einem Seminar für das Fach Englisch zu Theaterpädagogik Didaktik in Zusammenhang mit Bewegung kennengelernt. Dabei wurden verschiedene Methoden angewandt, wie etwa Standbilder oder theaterpädagogische Übungen ausgeführt, bei denen sehr viel Bewegung und Aktivität inkludiert waren und zusätzlich reflektiert wurde, wie diese später im Unterricht angewendet werden könnten (vgl. Pos. 116-118). Die Tische wurden dabei zur Seite geschoben und gar nicht gebraucht (Pos. 36).
Auch erfuhr sie die Folgen von zu wenig Bewegung beim Studieren und zu langem Sitzen: sie beschreibt wie sie beim Online-Semester und dem Arbeiten am Schreibtisch besonders merkte, dass sie schnell versteifte, verspannt wurde und Nackenschmerzen bekam, wenn sie den ganzen Tag saß. Aufzustehen, sich zu bewegen und dem entgegenzuwirken half ihr dabei und steigerte ihr Wohlbefinden: „Also ich [.] habe das auch in den Online-Semestern gemerkt. Ich meine, ich kann zwar gut an meinem Schreibtisch arbeiten, aber irgendwann hat es dann auch gereicht [.] da musste ich einfach aufstehen, mich bewegen, rumlaufen, Dehnübungen machen, solche Sachen [.] weil man so- also ich hatte dann totale Nackenscherzen und ähm war einfach auch, verspannt [.] Und es tut ja auch einfach gut, und ähm ja gerade - also, am besten ist natürlich, wenn man dann mal kurz an die frische Luft geht, dann ähm ja hat man gleich dann noch so ein bisschen Tapetenwechsel dabei, kann frische Luft schnappen und danach geht es meistens schon viel besser wieder. Das man weiterarbeiten kann (Interview Anna (w.), Pos. 76).
Zu wenig Transparenz: keine Ansprechpartner:innenfür Lehr- undLernraumgestaltung bekannt
Als die letzte Frage des Leitfadens gestellt und das Gesprächsthema in die Richtung der Möglichkeiten der Partizipation und des Engagements bezüglich der Lehr- und Lernraumgestaltung gelenkt wird, wird sichtbar, dass Anna nicht wüsste, an wen sie sich konkret wenden könnte. Sie ist sich nicht sicher, welches Gremium für die Lehr- und Lernraumgestaltung zuständig wäre und meint: „es sagt ja schon viel aus, dass ich jetzt gar nicht genau wüsste wohin ich mich wenden muss und ich habe ja wirklich lange an der PH studiert“ (Pos. 147 - 150 (0)). Sie schlussfolgert daraus, dass die Thematik deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte (ebd.). Dafür fände sie Umfragen sinnvoll, um auch wirklich alle zu erreichen und ein Stimmungsbild bei den Studierenden einzuholen.
Mögliche Hürden aber mehr Einbezug wichtig
Als mögliche Hürde der Lernraum(um-)gestaltung nennt Anna, dass geklärt werden muss was sich auch räumlich tatsächlich konkret an der PH umsetzten lässt, wie auch die finanzielle Frage, also was man überhaupt alles anschaffen oder ändern kann (ebd., Pos. 164 - 166 (0)). Überdies sieht Anna, dass bei baulichen Umgestaltungen wohl eine Firma beauftragt werden müsste, aber sie denkt, wenn es darum geht vielleicht, auch, auch kleine Veränderungen zu schaffen, wie Räume zu streichen, oder bezüglich der räumliche Aufteilung die Tische neu zu stellen, sicherlich auch die Student:innen mit einbezogen werden können. Nach ihrer Meinung handele es sich dabei schließlich um Arbeiten, bei denen die Student:innen selbst auch gut mitarbeiten, und mitwirken können. Weiter denkt sie, dass Mitwirkung und Mitgestaltung dazu beitragen, dass ein persönlicher Bezug zu dem Raum entsteht. Anna plädiert für einen Miteinbezug der Dozierenden und dann ein gemeinsames Besprechen und Zusammensitzen um Ideen umzusetzen.
Milena
Milena ist weiblich, war zu dem Zeitpunkt des Interviews 27 Jahre alt und hatte gerade erst seit ein paar Wochen mit dem Referendariat begonnen. Ihren Masterabschluss für das Lehramt in Sonderpädagogik mit der 1. Fachrichtung Sprache und der 2. Fachrichtung Lernen hatte sie deshalb erst vor einigen Monaten absolviert.
Trennung Lehr- und Lernraum aufgrund derräumlichen Gegebenheiten
Milena würde einen Lehr- von einem Lernraum aus zwei Gründen unterscheiden:
Erstens findet sie, dass Lehren und für sich lernen, nicht gleichzeitig geht, je nachdem was man unter Lernen versteht. Zweitens würde sie „schon sagen, dass es eher getrennt ist“ [.], weil zum Beispiel die Einrichtung in den Lehrräumen an der PH, ähm häufig nicht so flexibel ist, ähm durch diese Holzbänke und so weiter, ähm, dass ich da finde, dass man da so angenehm lernen kann“ (ebd., Pos. 19 - 21 (0)).
Wichtigster Lernort: Bibliothek
Milena ist vor der Pandemie sehr oft und sehr gerne in die Bibliothek gegangen, um zu lernen, „eigentlich immer“, sagt sie (Milena, w. Pos. 9-12). Die Bibliothek kommt ihr nicht nur in den Sinn, als sie nach einem typischen Lernraum gefragt wird, sie verbrachte dort auch viel Zeit, nicht nur „immer in den Hohlstunden“ auch nach den Veranstaltungen „zum Lernen und ähm Sachen vorbereiten“ (ebd., Pos. 68 - 81 (0)) und sie bereitete sich auch dort für Prüfungen vor (13 - 17 (0)). In Spitzenzeiten, äquivalent zu der Prüfungsphase, verbrachte sie nach eigenen Angaben auch schon mal zehn Stunden, also den ganzen Tag, in der Bibliothek 68 - 81 (0). Milena spricht aus Erfahrung, dass in den Prüfungsphasen „nicht genug Plätze zur Verfügung standen“, weshalb sie eine Lernraumumgestaltung als sehr dringlich einschätzt (Pos. 42 - 44 (0)). Ein typischer Lernraum an der Pädagogischen Hochschule beinhaltet für sie demnach mehrere Einzeltische und Stühle und wenn man Glück hatte Steckdosen, weiter typisiert sie mit den Zuschreibungen oder Merkmalen „mehrere Personen zum Lernen [.], wie auch Ruhe und Stille (22 - 25 (0)). Im Gespräch wird deutlich, dass Bibliotheken wirklich eine sehr zentrale und wichtige Rolle in ihrer Student:innen-Karriere gespielt hatten, da sie sogar zusätzlich zu der Bibliothek in der „alten PH“ noch drei externe Bibliotheken in der Stadt und einer anderen Hochschule nutzte, die eine, weil sie lange Öffnungszeiten hatte, eine andere, weil dort die Ausstattung gut war und eine dritte aufgrund der Atmosphäre (95 - 101 (0)).95Manchmal hätte sie auch in der Mensa gelernt (Pos. 12) und im Sommer gerne auch mal draußen, da nutzte sie etwa die Tische draußen vor der PH - sie erwähnt, dass sie es schön findet, dass es so etwas an der PH gibt - oder ging außerhalb der PH an die Neckarwiese,96wo sie sich durchaus auch mal mit Freund:innen zum Lernen getroffen hatte. Erst ganz am Schluss zählt sie zu der Auflistung: „Und natürlich zu Hause“ (92 - 93 (0)).
Bedürfnis nach abgetrennten Bereichen
In der Bibliothek haben ihr auch die Nischen sehr gut gefallen, weil man dort auch mal gut als Gruppe lernen konnte: „dieses eine Ding, wo man zu viert in so einem Kasten sitzen kann, ich weiß nicht, wie es heißt, das fand ich eigentlich auch ganz gut, das würde ich auch als Lehrraum bezeichnen, wo man auch vielleicht mal zu zweit oder als Gruppe lernen kann“ (26 - 27 (0)).
Mobiliar hat Einfluss auf Vorlieben und Lernraum-Wahl, dabei auchbewegungsaktivierendes
Die absolvierte Sonderpädagogin Milena äußert die Wichtigkeit für sie, dass Mobiliar verrückbar ist. Mobiliare Bedürfnisse betreffend äußert sie neben anderen auch, dass bewegungs- aktivierend(er)es eine Rolle spielt. Zum einen erwähnt sie bei der Beschreibung von Seminarräumen, dass sie es besser findet, wenn Tische verschiebbar sind (vgl. Pos. 65 - 67 (0)), zum anderen zählt sie bei der Frage ob das Mobiliar auch eine Rolle gespielt für ihre Wahl eines Lernraumes oder -ortes gespielt habe, neben Tischen die groß genug sein sollten und Lampen in Tisch-Nähe, auch die „Wackelhocker“ an der PH als Punkte auf, die tagesform-abhängig beeinflussen würden, wo sie lernen geht: „vielleicht da und da hin, weil es angenehmer ist, oder weil die den Stuhl haben oder so“ (108 - 113 (0)).
Weitere Bedürfnisse an den Lernraum sind unteranderem Fenster zum Rausgucken und Lüften (vgl. Pos. 85 - 85 (0)), sie schätzt dabei besonders den Bezug zu natürlichem Tageslicht und dass sie dabei den Bezug zu einem natürlichen Tages-Rhythmus bekommt, was sie dadurch beschreibt, dass sie „sieht, wie der Tag vorangeht, also manchmal, wenn es dann schon dunkel war, dann wusste ich, okay, jetzt habe ich heute aber ganz schön viel geschafft, und ganz lange gelernt“ (Pos. 91 - 91 (0)).
Einfluss des Mobiliars und der Ausstattung auf Lehr- und Lernformen
Milena äußert, dass sie es toll fände und es die Lernräume ihrer Meinung nach aufwerten würde, wenn es mehr digitale Geräte wie Computern oder Tablets geben würde, da dies auch „mehr Lernformen zu lässt, als dieses einzelne Lernen an Tischen“ (41 - 41 (0)).
Der Miteinbezug von Lehrenden sei wichtig und vielleicht profitieren diese auch von einem Umdenken: „man kennt das ja auch, dass die jetzt meistens häufig viel stehen, wenn sie ähm unterrichten und ich mein, vielleicht gäbe es für die auch andere Möglichkeiten, vielleicht wollen die auch mal sitzen (lacht), oder, nicht immer frontal vorne stehen, sondern auch mal nach hinten laufen oder so“ (Pos. 263 - 263 (0))
Sie beschreibt, wie das Wegschaffen von Mobiliar in einem Seminar zu einem Stuhlkreis zwar viel „Umgeräume“ war, es ihrer Meinung nach aber auch gewinnbringend (259 - 259 (0)).
Wenig Bewegungsaktivierung erfahren
Nach eigenen Angaben hat sich Milena während Vorlesungen oder Seminaren eher weniger bewegt und durchgeführte Bewegungsaktivierungen überhaupt nicht. Lediglich in der Sprachheilpädagogik hatten sie manchmal Methoden für die Kinder ausprobiert, wobei die höchste Bewegungsform dabei Singen, dazu Aufstehen und rhythmisch klatschen war, aber keine gezielte ähm Aktivierung, die auf die Gesundheit abgezielt war (vgl. Pos. 156 - 163 (0)).
Notwendigkeitfür mehr Bewegung gesehen
Die Folgen, die Milena durch eine prominent sitzende Verhaltensweise mit wenig Bewegungsaktivitäten öfters gespürt hat, waren zahlreiche: sie hatte schon drei oder viermal während ihres Studiums eine Sehnenscheide-Entzündung (vgl. Pos. 193 - 197 (0)). Deshalb fände sie es gut, wenn in Seminaren kurze Pausen gemacht werden würden, wo die Hände entspannt werden könnten, sie lernen würde, wie sie diese lockern könnte, oder auch ergonomische Tastaturen und Mäuse angeschafft werden würden (vgl. Pos. 193-199).
Seminarräume beliebter, weil mehr Bewegung undFlexibilität möglich
Bei dem Vergleich von Seminarräumen mit Hörsälen betont Milena, dass sie lieber in den Seminarräumen als den großen Vorlesungsräumen studiert habe. Als Gründe nennt sie, dass in den Seminarräumen etwas mehr Bewegungsraum vorhanden ist, sodass die Tische flexibel gestellt werden können und „ein bisschen mehr Platz ist, dass man auch mal aufstehen kann und zum Beispiel zur Toilette gehen kann, während in den alten Vorlesungsräumen dann alle aufstehen müssen, und dich durchlassen müssen“ (61 - 67 (0)). Milena schlussfolgert, dass in Seminarräumen deshalb flexibleres Lernen und Lehren mehr möglich ist: „Da finde ich so Seminarräume für so flexibles Lernen und Lehren eigentlich besser, also da lerne ich lieber, oder gehe ich lieber studieren, so gesagt“ (ebd.).
Sitzende Norm zu durchbrechen erregt (negatives) Aufsehen und Irritation underfordert Mut
Milena hat in „der PH-Bib“ gerne auch mal ab die Stehtische genutzt, wenn sie nicht mehr konnte und hat sich dann „auch mal, hingestellt, oder bin einfach so ein bisschen rumgelaufen“ (Pos. 139). In den Seminaren fand sie es schwerer sich auch mal hinzustellen, da sie erlebt hatte, wie welche, die dies getan hatten „immer ganz kritisch beäugt“ wurden, was sie als „irgendwie voll unangenehm“ empfand und sich deshalb nicht getraut hatte, mitten in der Vorlesung aufzustehen. Zusätzlich glaube sie, dass nicht alle Dozierenden das so okay finden und man dann Angst habe, dass der, dass der Dozent oder die Dozentin einen anspricht, warum man plötzlich aufsteht. Sie schlussfolgert: „an sich ist Bewegung noch nicht so drin. Ähm. Aber ansonsten [.] in den Lernräumen ist es schon vorhanden, dass man da sich bewegt“ (Interview Miena. (w.), Pos. 139-143).
Die Lehramts-Absolventin beschreibt, wie nicht nur Dozierende irritiert Dozierende hätten irritiert oder negativ (vgl. Pos. 152 - 154 (0)) auf eine Durchbrechung der sitzenden Norm reagiert haben, sondern auch Mitstudent:innen: „[.] man merkt den Personen oder den Dozierenden dann manchmal schon an, dass es sie stört, also, oder in dem Fall hat man schon gemerkt, dass es gestört hat einfach“ (Milena, w. 177 - 177 (0) .Weiter beschreibt Milena beschreibt eine Situation in der der Person „noch beim Hochschieben noch was runtergefallen [ist], und dann war [.] voll der Lärm [.]“ weshalb dann der oder die Dozent:in in dem Moment ihr Wort unterbrochen und nicht weitergeredet hätte.
Milena beschreibt wie sie das Gefühl hate, dass es bei allen Teilnehmenden so wirkte als dachten sie „warum muss jetzt hier wegen sowas unterbrochen werden“ wirkten und meint, dass da soziale Prozesse passierten, die unterschwellig ablaufen, aber nicht unbedingt kommuniziert werden (175 - 177 (0)), doch „wenn halt dann alle die Person dann anstarren und dann halt nicht freundlich sind von der Mimik her, dann merkt man halt, ja [.] dass es halt nicht so, äh, gut ankommt (Pos. 179 - 181). Auf Nachfragen ob sie dies genauer beschreiben könnte, erläutert sie, dass wenn in einer Veranstaltung aufgestanden wurde, oft negative oder irritierte Reaktionen seitens anderer Kommoliton:innen in Veranstaltungen aufgestanden und dann etwa sich an die Wand gelehnt hätten „dann wurde das halt manchmal, also dann haben alle immer kurz hingeguckt und dann wieder weggeguckt, aber irgendwie fand ich dieses Gefühl unangenehm [.] und die Dozierenden [.] sind immer darauf eingegangen und haben gesagt: ah ja, zu viel sitzen und so, ähm wo ich dann dachte, warum kann man das nicht einfach unkommentiert lassen, warum darf man sich nicht einfach so bewegen und mal kurz ähm die Position ändern [.] das ist eigentlich ein bisschen wie, wenn jemand auf Toilette läuft. Dann schauen auch alle, ah der geht, [.] der kommt wieder rein. ähm, ja. so, man zieht halt schon kurz die Aufmerksamkeit auf sich, ja“ (144 - 147 (0))
Milena geht darauf ein, dass die Einstellungen der Lehrenden und Dozierenden auch eine Rolle spielen ob sich getraut wird, die sitzende Norm zu durchbrechen, denn: „wenn das halt nicht als normal angesehen wird, dann ist es halt jedes Mal, dann hat es was mit sich trauen zu tun und dann muss man sich überwinden sich zu bewegen und [.] man lässt es wahrscheinlich eher“ 169 - 172 (0).Auf Nachfragen ob Situationen wie diese, in denen sich zeigt, dass Bewegung in Form von eigenständigem Aufstehen noch nicht sozial akzeptiert ist, in Vorlesungen oder in Seminaren war, meint Milena, dass es in beiden Veranstaltungsformen stattfand und fügt unaufgefordert hinzu, dass es nicht wirke als wäre es schon normalisiert, dass man auch anders dem Stoff folgen darf (vgl. Pos. 148 - 151 (0)).
Milena meint, dass sie es wichtig findet, dass tatsächlich in jedem Raum Stehtische zur Verfügung stehen, fragt sich aber gleichzeitig wie arg es stören könnte, da sie schon mitbekommen hätte, dass dies nicht gerade erwünscht war. Aber sie fände es eigentlich gut, wenn sich etwas an der Ausstattung wie auch an der Anordnung der Ausstattung ändern würde (vgl. Pos. 167). Die soziale Norm betreffend könnte sich ihrer Meinung etwas dahingehend ändern, dass etwa wohlwollend in Richtung der Person geschaut wird, vielleicht mal kurz zugenickt, aber ansonsten weitergeredet oder weitergemacht (Pos. 179 - 181 (0)).
Notwendigkeit mehr Zugang zu bewegungsaktivierende(re)m Mobiliar
Als sie nach der Meinung zu dem für sie zur Verfügung stehenden Mobiliar in Lernräumen an der pädagogischen Hochschule gefragt wird, meint sie, dass schon versucht wird, dass beste zu machen, aber neben zu wenig Steckdosen, keine(n) Leselampen direkt an den Tischen, bemerkt sie zu bewegungsaktivierende(re)m Mobiliar, dass Stehtische und Balancekissen, Wackelhocker zwar vorhanden sind, aber oft zu wenig verfügbar wären und dies aber oft sporadische Angebote seien, von denen es nicht überall welche gibt „und immer nur drei, vier“ Oder „teilweise stand da dann halt auch so ein Hocker, dann weiß man halt auch nicht, darf man sich den nehmen oder nicht“, weshalb sie findet, dass dieses „spezielle“ Mobiliar vermehrt eingeführt werden sollte (Interview Miena. (w.), Pos. 116-117)
Partizipation und Engagement: zu wenig Ansprechspartner:innen bekannt
Milena hätte sich, wenn sie noch an der PH studieren würde, durch mitdiskutieren und eigene Ideen wie Anregungen zu bringen für die Lernraumgestaltung engagiert. ezüglich des möglichen Engagements und der Mitgestaltung an der PH in puncto der Lernraumgestaltung findet sie folgende Aspekte wichtig:
1. Gremium/ Team: Es braucht eine bestimmte Gruppe von Menschen die zuständig ist für die Lernraumgestaltung und Studierende nach ihren Präferenzen befragt (253 - 253 (0)), wie auch aktiv Akteur:innen coacht, wie Lernräume mit bewegungsaktivieren- der(er)em Mobiliar genutzt werden (267 - 267 (0)) und wie Bewegung in die Lehre, wie auch die Bibliothek eingebaut werden kann.
2. Student:innen sollten mehr mitbestimmen dürfen, etwa bei der Gestaltung der Bibliothek: „wir ja da direkt betroffen sind, und da fände ich es auch gut, wenn wir da auch, auf jeden Fall mitbestimmen dürfen wie die PH-Bib genutzt wird und wie sie gestaltet wird“ (Pos. 253 - 253 (0). Durch viele Ideen könnten grundsätzlich mehr in die Lernraumgestaltung miteinbezogen werden, wie sich am Anfang des Semesters zusammen mit der dozierenden Person zu überlegen, wie in dem Seminarraum die Tische so gestellt werden könnten, dass es für alle geeignet ist (Milena, w. Pos. 257 - 258).97
Miteinbezug von folgenden Akteur:innen: Kon-Rektorat und Rektorat bezüglich finanzieller Angelegenheiten 263 - 263 (0), Dozierende, unteranderem auch um Gestaltungen mit ihrer Lehre vereinbaren zu können (260- 263) und es sollte eine größere Zusammenarbeit zwischen Bibliothek und der Pädagogischen Hochschule laufen 253 - 253 (0))98
SonstigeBedürfnisse: mehrLernplätze und abgetrennteArbeitsräume
Zu weiteren Bedürfnissen, die Milena in dem Gespräch äußert gehören mehr Lernräume, die auch für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Gruppenräume, die man mieten kann, explizit um dort gemeinsam zu arbeiten und zu lernen (37 - 37 (0)), denn ihrer Meinung nach wird ansonsten für das Gruppenlernen auf die Mensa ausgewichen, weil es keine speziellen Räume für Gruppen gibt (Pos. 54-59).
Bewegung und mehr Abwechslung der Lehrform inAußenlernräumen
Milena stellt weiterhin fest, dass sich bei Außenlern- und -lehrräumen mehr bewegt wird (Pos. 134 - 139 (0) und 237 - 237 (0)).
Alex
Alex war zu dem Zeitpunkt des Interviews 28 Jahre alt, im 3. Master-Semester und studierte den Master in Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Inklusion in sonderpädagogischen Handlungsfeldern, Arbeit, Wohnen und Freizeit.
Er hatte vorher an der Universität in Heidelberg seinen Bachelor absolviert und erst angefangen, seinen Master an der Pädagogischen Hochschule zu studieren. Aufgrund der pandemischen Zustände zu der Zeit des Interviews hatte er sich bisher lediglich länger in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule aufgehalten, die Seminar- und Vorlesungsräume hatte er lediglich aus Eigeninitiative angeschaut, seine Veranstaltungen fanden aber ansonsten noch alle online statt. Alex‘ größte Unterstützung im Studienalltag sind sein Rollstuhl und seine Assistenz, denn er ist in seiner Bewegung eingeschränkt. Er kann zwar für kurze Zeit auch mal aufstehen, ansonsten ist er auf seinen Rollstuhl angewiesen, um sich durch den Studienalltag bewegen zu können und braucht öfters auch mal seine Assistenz als Hilfe.
Trennung von Lern- und Lehrraum
Einen Lernraum würde er ganz klar von einem Lehrraum unterscheiden. In einen Seminarraum etwa würde er nur auch lernen, wenn er dorthin ausweichen müsste, ansonsten ist es seiner Meinung nach wichtig für die mentale Gesundheit einen Lehrraum von einem Lernraum klar zu trennen.
Bibliothek in der PH nicht denBedürfnissen anpassbar
Bei der Frage welcher Ort oder Raum ihm in den Sinn kommt, wenn er an einen Lernraum denkt, antwortet er mit seinem eigenen Schreibtisch. Früher vor der Pandemie lernte er auch mal in der Bibliothek, um sich dort gut fokussieren zu können, jetzt käme er mit dem HomeOffice auch ganz gut zurecht (vgl Alex, m. Pos. 44-48) Da er auf einem Campus eines Studentenwohnheimes wohnt, auf dem sich auch eine Bibliothek befindet, geht er ab und zu gerne auch dorthin um zu lernen. Die Bibliothek in der alten Pädagogischen Hochschule als Lernraum betrachtend hat er bisher gesehen, dass er diesen eher nicht seinen Bedürfnissen anpassen kann. Er gibt aber auch zu, dass er es noch nicht versucht hat und glaubt, dass es vielleicht möglich wäre, wenn er mit dem Personal der Bibliothek spräche. Bisher hat er sich lediglich die Bedingungen vor Ort angeschaut und deswegen entschieden wieder nach Hause zu gehen und nicht in der Bibliothek zu lernen.
Lernraumumgestaltung notwendig
Von dem was er bisher gesehen hat, findet er, dass eine Lernraumumgestaltungsnotwendigkeit vorhanden ist. Was er bräuchte, um nach seinen Bedürfnissen lernen zu können, wären Stehtische, um die Höhe so anzupassen, dass er mit seinem Rollstuhl darunter fahren kann und einen extra Stillarbeitsraum, damit seine Assistenz ihm helfen kann. Schließlich muss diese ihm eventuell auch mal etwas vorlesen und in einer Bibliothek ohne abgetrennte Räume geht das schlecht, da dies dann andere stören würde.
Die Notwendigkeit für separate Lernräume
Besonders betont er in dem Gespräch die Notwendigkeit von Einzel- oder Gruppenarbeitsräumen. Er liefert dafür insgesamt drei Hauptgründe:
1.Inklusion: Braucht er um mit seiner Assistenz kommunizieren zu können einen Raum, in dem es niemand stört, auch in der Bibliothek, denn er ist in seiner Situation eigentlich dauerhaft darauf angewiesen, dass seine Assistenz ihn unterstützt und er Texte, oder einzelne Stichpunkte oft diktiert „gerade in Bibliotheken, dass es eben schon auch ein ruhiger Ort sein muss, also ich äh es muss so sein, dass ich eben ähm äh zum einen selber Ruhe habe, aber sozusagen auch niemanden störe, [...] und da ist eigentlich am besten dann ein Einzelarbeitstraum [...] oder ein Gruppenarbeitsraum, wo man sich eben ähm zurückziehen kann, damit man auch eben andere nicht stört“ (Interview Alex (m), Pos. 23-27)
2. Kommunikation und Austausch: Auch wenn er durch die Pandemie leider noch nicht in der Situation war, findet er es wichtig, dass es Räume gibt, wo man sich auch treffen und austauschen kann und zwar auch in einem Arbeitsraum. Jedoch sollte der Zugang zu speziellen Einzelarbeitsräumen fair geregelt sein: „wichtig, dass es eben Einzel- oder Gruppenarbeitsräume gibt, ähm, wo man sich eben auch treffen kann, also das ist ein ganz großes, ein ganz großer Minuspunkt denke ich. Ähm, und die man eben auch dann für eine gewisse Zeit, also für einen Zeitslots, von zwei; drei Stunden auch tatsächlich mieten kann. Aber auch so natürlich, dass es fair ist, also dass äh alle Kommilitonen dann, oder, ja man hat eben nicht die Möglichkeit für Gruppenarbeitsräume.
3. Wechsel zwischen Online und Präsenz-Lehre: Er hat beobachtet, wie es für seine Kommilitoninnen, oft einen Platzmangel hatten und „[.] erhebliche Probleme damit hatten, einfach dadurch, dass sie zum Einen, Veranstaltungen in Präsenz an der PH hatten, aber auch dann wieder im Homeoffice und dann das aber auch äh an einem Tag, also beispielsweise [.] am Dienstag hat man dann zwei Veranstaltungen im, ähm, Präsenz und eine quasi im Homeoffice, nenne ich es mal, aber das im Homeoffice liegt dann zwischen denen zweien in Präsenz [.] und dann weiß man nicht wo man hingehen soll, weil man, nicht so schnell nach Hause kommt und da, wäre es, habe ich schon gehört, dass eben Kommilitonen ganz große Probleme hatten, wo gehen sie jetzt für die Online-Veranstaltung hin [.] haben keinen richtigen Lernraum, sozu- sagen[...], also dass es da an Räumlichkeiten fehlt“ (Alex, m., 0:13:14 - 0:14:16)
Geringe Bewegungsaktivierung bisher kennengelernt
Bei der Frage, ob er schonmal an der Pädagogischen Hochschule Bewegungs-Aktivierungen in Seminaren kennengelernt hat, antwortet er, dass er glaubt ein einziges Mal erlebt zu haben, wie die Teilnahme in einem Online-Seminar morgens dazu aufgefordert wurden, sich vor die Kamera zu stellen und einmal sozusagen zu schütteln um wach zu werden, aber tatsächlich ansonsten, an der Hochschule vor Ort nicht.
WeitereBedürfnisse
Zu seinen sonstigen Bedürfnissen zählen, dass eine Steckdose in der Nähe sein muss, am besten integriert in einen größeren Gruppenarbeitstisch, damit er seinen Laptop anschließen kann und damit er genug Platz hat - eine große Arbeitsfläche ist ihm nämlich auch wichtig, wie eine ruhige Umgebung ohne Störgeräusche. Zusätzlich sieht er einige Vorteile - aber auch Nachteile - zu Außenlernräumen.
Höhenverstellbare Tische als prominentesBedürfnis
Im Laufe des Gesprächs nennt er mehrmals höhenverstellbare Tische, bezüglich was für Mobiliar er sich wünschen würde, dann bei der Frage wie ein Lern- oder Lehrraum in einer Hochschule seiner Meinung nach, gestaltet sein sollte, damit bewegungsaktivierendes Studieren möglich ist. Auch als er nach der Meinung zu dem Mobiliar an der Pädagogischen Hochschule gefragt wird, erläutert er das Bedürfnis nach Arbeitstischen, wo man sich nach seinen Beschreibungen ran stellen kann.
Bewegungsaktivierende(re)s Mobiliar und Ausstattung
Ebenfalls nennt er bei der Frage wie denn ein Lern- oder Lehrraum in einer Hochschule gestaltet sein sollte, damit bewegungsaktivierendes Studieren möglich ist als gute Alternative Arbeitsplätze im Stehen, also dass man höhenverstellbare Tische hat. Als Idee für Bewegungsaktivierung in Seminaren nennt er eigenständig, als Unterbrechung von Lernen für Bewegung zwischendurch eine Art Stoppuhr oder einen Zeitmesser einzusetzen, um an eine Bewegungspause erinnert zu werden. Ansonsten studiert er gerne in solchen Lernräumen, in denen genug Platz ist und auch jede/r Student/in einen Platz bekommt.
Partizipation Lernraumgestaltung
Engagieren würde er sich in dem Sinne für die Lernraumgestaltung, als dass er das Studierendenparlament (Stupa) kontaktieren würde um Student:innen für die Thematik zu gewinnen, oder Finanzmittel zu kommen. Er denkt, dass für große Umbaumaßnahmen und Gelder das Rektorat gebraucht würde. Zusätzlich würde er generell gezielt Dozierende, oder Mitarbeitende aus der Verwaltung, das Qualitätsmanagement, oder sogar den Hausmeister für Anliegen sensibilisieren. Außerdem findet er, dass Initiativen des Studienbereichs der Gesundheitsförderung der PH mit ihren Ideen miteinbezogen werden sollten, Behindertenbeauftragte(n) und Studierende mit Beeinträchtigung mit ihren Bedürfnissen.
Er beschreibt, wie durch Online-Portale mehr Nutzer:innen und Eingebundenheit verschiedener Aktuer:innen zur Lernraumumgestaltung erreicht werden kann99: „also eigentlich ähm finde ich, sobald irgendwie groß Umbaumaßnahmen stattfinden, sei es in Seminarräumen oder Vorlesungsräumen, wo dann wirklich auch viel Geld in die Hand genommen wird, wäre es wirklich hilfreich, wenn zum Beispiel über Stud.ip oder äh andere, äh Online-UmfrageTools äh Umfragen gestartet werden und dann auch alle Studierende befragt werden, also wir hatten das Gleiche ja ähnlich jetzt, während der Pandemie zum Impfstatus, wo wirklich alle Studierende aufgefordert wurden, ihre aktuelle Situation anonym darzulegen. Genau das glei- che finde ich, könnte man ja auch ohne große Probleme online machen“ (Interview Alex (m), Pos. 279).
Max
Max, männlich, war zu dem Zeitpunkt des Interviews 26 Jahre alt und hatte ebenfalls gerade mit dem Referendariat begonnen. Seinen Masterabschluss für das Lehramt der Sekundarstufe I mit den Fächern Deutsch und Politik hatte er erst vor einigen Monaten absolviert.
Einen Lernraum würde er von einem Lehrraum differenzieren, zwar lerne er auch an dem Ort wo Lehre stattfindet, aber da jede:r nach seinen Fähigkeiten und Mustern, wie eigenen Bedürfnissen lernt, muss nach ihm noch in einem anderen Raum gelernt werden (Pos. 19 - 22 (0)).
Als einen typischen Lernraum sieht Max die Bibliothek an der alten PH. Allerdings fühlt er sich dort nicht so wohl, er findet die Ästhetik wie die Atmosphäre nicht so schön. Am liebsten lernte er jedoch zuhause, an seinem Schreibtisch, wo er sich auch normalerweise für eine Prüfung vorbereitete. Ihm sei es an der PH nur bedingt gelungen, die Lernräume seinen Bedürfnissen nach anzupassen, er spricht an, dass wenn er der Bibliothek der alten PH gelernt hat, er garnichts anpassen konnte, sich dagegen selbst anpassen musste an die Gegebenheiten. Sehr oft war es so, dass wenn er mit seinem Laptop dort arbeiten wollte, es schon an der Steckdose gescheitert habe. Aufgrund dieser Gegebenheiten verbrachte er in der Bibliothek in Spitzenzeiten maximal sechs Stunden, er wäre wohl länger dort geblieben, wenn die Gegebenheiten anders gewesen wären. Überdies beschreibt Max das Bedürfnis nach Ruhe und Abgrenzung. Seine Bedürfnisse konnten durch das Mobiliar insofern gestillt werden, als in der Biblitothek Nischen mit einer Art Abtrennwand oder Cocoon angeschafft wurden. Zu seinen Bedürfnissen zählt unteranderem auch Tageslicht und er mag kleinere Lernräume, da er die Atmosphäre und Größe von Seminarräumen besser als die von Hörsälen empfindet. Auf die Frage welches Mobiliar er benötigt, erwähnt er, dass ihm ein bequemer Sitzplatz wichtig ist und in dem Zuge nennt er als Beispiel einen Computerraum im Technologie-Park100in den er gerne gegangen ist und wo es für ihn „richtige Stühle“ gab. Die Stühle in der PH fand er oft zu unbequem. Weiter brauch er, um gut lernen zu können einen Raum mit einer guten medialen Ausstattung, wie einen Beamer, oder genügend digitale Möglichkeiten. Zusätzlich haben ihm im Laufe seines Studiums Aufenthaltsräume an der PH gefehlt. Für die Zukunft fände er weitere separate Räume wie Einzelarbeitsräume gut. Während er in der Bibliothek Stille in separaten abgetrennten Räumen bevorzugt, würde er sich draußen von ihm bezeichneten Umweltgeräuschen nicht sehr gestört fühlen.
Eine Lernraumumgestaltungsnotwendigkeit sieht er in jedem Fall. Er meint auch, wenn er die Alternative nicht gehabt hätte zu Hause lernen zu können „oder es hätte keine anderen Bibliotheken gegeben, in Heidelberg, oder andere Lernräume und Möglichkeiten, dann hätte ich da einen sehr dringenden Bedarf gesehen. Auf jeden Fall“ (Pos. 42 - 42 (0)).
Dadurch, dass er Politik studierte, welches in einem Gebäude im „Technologiepark“ stattfand, wo die Räume relativ modern ausgestattet mit Smartboard oder Beamer und für ihn gut ausgestattet mit hellen Räumen und einer guten Atmosphäre, lernte er wenn er mal nicht zuhause gelernt hatte dort, da es für ihn höchstens dort möglich gewesen wäre länger zu sitzen und auch die mediale Ausstattung führte dazu, dass er gut und gerne lange arbeiten können (Max, m., Pos. 30 - 30 (0)).
Sedentäre Norm noch nicht durchbrochen
Max konnte beobachten, wie Stehtische rumstanden aber nicht genutzt wurden (90 - 92 (0)) und er nach dem Projekt Kopfstehen keine Änderungen wahrgenommen, hatte, dass; sich mehr bewegt wurde in Seminaren oder mehr aufgestanden wurde (169 - 173 (0)). Er hat für sich keine Kultur wahrgenommen, in der man nicht beispielweise Angst haben müsste, komisch angeschaut zu werden, wenn man einen Stehtisch benutzt und glaubt, dass da auch ein großer sozialer Druck noch weshalb viele Leute sich vielleicht nicht bewegt haben im Seminar, obwohl es Möglichkeiten dazu gegeben hätte (184 - 184 (0)).
KeinBedürfnis nach mehr Bewegung im Studium
Persönlich hat der Lehramtsabsolvent Max nicht unbedingt den Bedarf entwickelt „,dass Bewegungs-Dinge PASSIEREN beim Lernen“ (Pos. 89 - 90 (0))
Er hat Projekte wie das Projekt „Kopfstehen“ anhand von Plakaten wahrgenommen, aber dadurch, dass er es für sich selbst nicht relevant empfand und weil ihm die Bewegung beim Lernen auch nicht so wichtig ist, hat es ihn nicht sonderlich interessiert und bei ihm keine Verhaltensänderung hervorgerufen (vgl. Pos. 164 - 168 (0)), so erzählt er: „[...] ich habe das auch wahrgenommen, dass man dazu rät, sich mehr zu bewegen, aber ich habe mich trotzdem nicht mehr bewegt. ähm. Beim Lernen. Und ich glaube der Grund ist einfach, dass ähm es schwierig ist jemanden dazu zu NÖTIGEN sage ich jetzt mal, sich mehr zu bewegen beim Lernen oder rauszugehen beim Lernen, weil jeder hat seine eigenen Bedürfnisse“ (Pos. 181 - 184 (0))
Mögliche Grenzen der Umsetzungsmöglichkeiten
Als Probleme bei der Lernraumgestaltung sieht er zum einen, dass es fehlende Ansprechpartner gibt, aber auch, dass es Grenzen bei der Lernraumgestaltung geben könnte, in dem Sinne welche Möglichkeiten und Handlungsspielraum die PH hat, Wünsche konkret umzusetzen 136 - 138 (0)). So wäre speziell an der alten PH auch Denkmalschutz eine Hürde für größere Umbauten.
Wenig Partiziptionsmöglichkeiten und Transparenz der PH erlebt
In seinem Studentenleben habe er wenig Möglichkeiten wahrgenommen, an der Lernraumgestaltung etwas zu verändern, sagt er (116 - 116 (0)). Er weiß, dass es das Studierendenparlament (Stupa) gibt, hat sich aber noch nie an jemanden gewendet, sondern es eher hingenommen, dass es die Möglichkeiten nicht gibt, er hätte auch niemanden gewusst an den er sich konkret hätte wenden können, da kein Einblick besteht, was überhaupt möglich ist (vgl. Pos. 130 - 134 (0)). Mehr Transparenz der PH, um zu zeigen wo und wie Studierende die Möglichkeiten hätte mitzugestalten und konkrete Ansprechpartner:innen an die man sich wenden kann, findet er deshalb wichtig. Er hat auch schon erlebt, dass er vor ein paar Jahren an einer Umfrage zur Umgestaltung der Mensa teilgenommen hatte, aber die Ergebnisse nie zu Gesicht bekam und bis vor einigen Monaten als er nochmal an der PH in der Mensa war, auch keine Änderung gesehen hat (116 - 126 (0))
Keinen Einbezug der Studierenden den er gut gefunden hätte passierte dagegen bei seines Erlebens nach bei den Gebäudeteilen, die im Neuenheimer Feld wegen einer Schadstoffbelastung mit PCB in der „neuen PH“ neu gebaut werden. Er meinte, als Studierender davon nichts mitbekommen zu haben, „dass da wirklich gefragt wurde, wie hätte man denn ähm die Seminarräume in Zukunft machen sollen oder was hat euch bei den Seminarräumen in der PH gestört, wie schauts mit ähm Lernmöglichkeiten außerhalb aus. Aufenthaltsräume. ähm. Ich persönlich habe garnichts mitbekommen, davon, dass wir da beteiligt worden wären (Pos. 174 - 180 (0)).
Frau M.
Frau M. war zu dem Zeitpunkt des Interviews eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung und Koordinatorin einiger Projekte.
Die im Rahmen dieser Arbeit interviewte Expertin würde einen Lehr-raum nicht haarscharf genau von einem Lernraum trennen. Ihrer Meinung nach kann man theoretisch in einem Raum, in dem man lernen kann, auch lehren, aber man kann nicht unbedingt in jedem LehrRaum auch gut lernen, dass sei abhängig von den Rahmenbedingungen (Interview Frau M., Pos. 2).
Bedeutung der Lernraumgestaltung (auch) in Hochschulen bisherunterschätzt
Auf die Frage, was ihr spontan zu dem eingeblendeten Zitat von Reinhard Kahl einfallen würde, dass der Raum bisher in seiner Bedeutung für die Bildung unterschätzt wurde und als dritter Pädagoge neben den Erwachsenen und den anderen Kindern und Jugendlichen fungiert, meint sie, dass sie dies absolut so unterstreichen würde. Sie ist der Meinung, dass je günstiger und lernförderlicher ich die Rahmenbedingungen oder das Setting gestaltetet sin, in dem Lehr-Lernprozesse stattfinden, desto positiver sind die Auswirkungen auf die LehrLernprozesse. Sie fügt hinzu, dass bereits bekannt ist, dass Lernen emotional gekoppelt ist, und alleine aus diesem Grund schon ein Raum der auch Wohlbefinden vermittelt ein förderlicher Faktor dafür ist, dass Lernen gelingen kann (ebd., Pos. 32-40. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Hochschule bestätigt, dass in vielen Kontexten und auch in vielen Hochschulen die Thematik bislang unterschätzt wurde und teilweise Mobiliar gefunden werden kann, welches vermutlich seit 20, 30 Jahren unveränderlich ist, sowohl in der Anordnung als auch in der Funktion. Sie sieht jedoch auch eine Bandbreite zwischen denjenigen die neu ausstatten, das neu denken, und äh aber glaube ich der breiten Masse, wo eher noch eine ganz klassische Möblierung vorherrscht, so dass glaube ich der Übertritt von Schule an eine Universität oder Hochschule raumtechnisch spürbar ist, mit Aufnahme vom Hörsaal, der nochmal einen anderen Charakter hat, aber was Seminarräume betrifft, unterscheiden die sich kaum von Klassenzimmern würde ich sagen (ebd., Pos. 48).
Auf Nachfragen welche Rahmenbedingungen dies sein könnten und ob das auch von dem Mobiliar abhängt, meint Frau M., dass es Studien dazu gibt, welche Kriterien denn wichtig sind und es teilweise ganz banale Kriterien wie die Beleuchtung. das Licht, oder die Akustik ist, wie sicherlich auch der Platz, den die einzelnen Studierenden zur Verfügung haben, die Ausstattung und weitergehend betrachtend Themen wie Bezug zur Natur: Frau M. erwähnt auch die gesamte Raumatmosphäre als wichtigen Faktor, wobei verschiedene Aspekte wie die Farbgestaltung eine Rolle spielen, ob Grünpflanzen oder ein sonstiger Bezug zur Natur vorhanden ist, wenn man zum Beispiel aus dem Fenster schaut, oder umgekehrt NeonröhrenBeleuchtungen dort sind, es zu laut ist und mehr (ebd. Pos. 58).
Bewegung und Studieren durch vielerleiMöglichkeiten
Lang andauerndes, ununterbrochenes Sitzen stellt ein Gesundheitsrisiko, dagegen könnten durch mehr Bewegung Denkprozesse angeregt werden und die Kommunikation erleichtern kann (Pos. 52-54). Nach der Expertin der Gesundheitsförderung und -prävention gehört zu einer Gesundheits-förderlichen Lernraumgestaltung verschiedene Dimensionen dazu, wie in jedem Falle eine Sitzzeitreduktion, da empirisch inzwischen recht gut belegt ist, „dass lang andauerndes, ununterbrochenes Sitzen ein gesundheitsriskantes Verhalten ist, was viele chronische Erkrankungen mit begünstigen kann“ und sie meint, dass in unserer Gesellschaft exzessiv gesessen wird und „man weiß, dass dies negative gesundheitliche Effekte hat“ (Pos. 68-70). Frau M. beschreibt jedoch, dass im Gegensatz dazu Bewegung Denkprozesse anregt und Kommunikation erleichtern kann.
Nach ihrer Vision könnten in Lehrveranstaltungsräumen Bewegungsmöglichkeiten geschafft werden, um nach eigenem Befinden zwischen Sitzen und Stehen wechseln zu können, oder auch einfach mal genug Platz zu haben, um sich im Raum umher bewegen zu können, in Kombination mit der Anwendung verschiedener Methoden (ebd., Pos. 52).
Nutzer:innen in Projekte miteinbeziehen und mitgestalten lassen: Beispiel Außenlernraum
Die Expertise und das Potential von zukünftigen Multiplikator:innen sollte nach Frau M. auf jeden Fall genutzt werden, da bei Lehramtsstudent:innen bereits „ganz VIEL Expertise vorhanden ist im Hinblick auf Didaktik und ihre Rahmenbedingungen“ weshalb sie findet, dass Studierende auf jeden Fall in Lernraumgestaltungsprozess miteingebunden werden sollten.
Sie beschreibt, wie dies an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, an der sie arbeitet schon im Rahmen von Lehrforschungsprojekten passiert ist, wobei Studierende selbst Konzepte entwickeln, und Konzepte testen, prüfen konnten und dann die gesamte Studierendenschaft auswählen konnte aus verschiedenen Konzepten (ebd. Pos. 88): bei der Gestaltung eines Außenlernraumes etwa sollte ein bewegungsfördernde Außen-lehr-lernbereich geschaffen werden und so wurden Lehramtsstudierende des Faches Technik, wie des Faches Biologie bei der Mobiliar-Gestaltung und Aspekten des Naturbezugs und Biodiversität einbezogen um diesen Außen-lehr-lernbereich zu entwickeln (ebd., Pos. 94). Die gesamte Studierendenschaft dann auch wählen, welches Modell sie favorisieren, und dieses Modell - welches aus praktischen Gründen dann nochmal angepasst werden musste- wurde umgesetzt (Pos. 88).
In den Außenlehr- und lernraum wurden Sitzgruppen wie auch Stehtische aus Holz gebaut und nach Frau M.‘s Beobachtung, werden auch die Stehtische rege genutzt (Pos. 144).
Über das traditionelle Raumkonzept hinweg gedacht, erwähnt Frau Dold, dass nicht nur dringend ein Raum gebraucht werden muss, sondern zum Beispiel mit der Methode "Walk and Talk" oder Podcast-Aufnahmen raumunabhängig studiert werden kann, da Wissen vermittelt wird, dass über einen Podcast stattfindet (Pos. 218).
Neben dem Einbezug von Studierenden ist es, nach Ansichten Frau M.‘s auch sehr wichtg die Lehrenden eine mögliche Lernraum(um-)gestaltung miteinzubeziehen, da es für die schließlich auch vorstellbar sein sollte wie allgemein all diejenigen, die es unmittelbar betrifft und dann in einen konstruktiven Austausch zu kommen.
Eventuelle Hürden bei der Planung und Gestaltung: Sicherheit, Finanzen und mehr
Da Frau M. schon einige Expertise bezüglich der Planung und Gestaltung von Lernräumen hat, weiß sie, dass es viele Punkte gibt, auf die geachtet werden muss, wie Sicherheitsaspekte, behördliche Auflagen, oder eventuell auch, dass das Gebäudemanagement und Arbeitssicherheit eingebunden werden. Finanzielle Belange sind außerdem zu beachten, weshalb das Rektorat wiederum einbezogen werden muss (Pos. 128). Erfahrungen, die Frau M. gemacht hat sind dabei, dass es viele verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten gibt und etwa bei dem Projekt, bei dem sie mitgestaltet hat, jeder Raum komplett unterschiedlich finanziert wurde (#00:29:35-3#).
Das „Stehlabor“ etwa,101wurde über Qualitätssicherungsmittel für Studierende finanziert, wobei eine Studentin einen Antrag schrieb, der ähm bewilligt wurde, und Sie wissen, dass das Studierendenparlament über diese Qualitätssicherungsmittel für die Lehre ähm entscheidet und befindet. Der Außenlehr-lern-bereich dagegen wurde aus zentralen Mitteln der Hochschule finanziert. Weiter beschreibt Frau M., dass wenn es im Rahmen von Lehrveranstaltungen geschieht und mit studentischer Arbeit ist es deutlich kostengünstiger als würde man zum Beispiel eine externe Beratung beauftragen und vorgefertigtes Stadt- oder Parkmobiliar anschaffen. Ein dritter Raum wurde durch die Schenkung einer Firma unterstützt, die hochwertige Ausstattungsprodukte herstellt, von den Konzepten überzeugt war und im Rahmeneiner Kooperation Mobiliar überlassen hat. Frau M. lässt weiter einblicken, dass Hochschulen in der Regel nicht viele Gelder zur Verfügung haben und auch an Vorgaben gebunden sind, was auch bedeutet, dass wenn Mobiliar beschaffen werden soll, dies heißt, dass es gut begründet werden muss und verschiedene Mittel und Wege für Realisierungsmöglichkeiten gefunden werden müssen (vgl. Pos. 142-146).
Es gibt nicht den einen, perfekten Lernraum, es muss eine Vielzahl unterschiedlichster Räume geben
Wenn Frau M. einen optimalen Lernraum für Studierende gestalten könnte, würde sie ein ganzheitliches Gestaltungskonzept einer kompletten Hochschule inklusive der Außenflächen planen und zwar partizipativ, gemeinsam mit Studierenden und mit Lehrenden. Nach Frau M. gibt es nicht den einen, perfekten Raum für alle Zwecke, sondern, es gibt, unterschiedliche Räume für unterschiedliche Konstellationen. Soll in einem Raum Kommunikation stattfinden, dann muss der anders aussehen, als wenn in einem Raum konzentriert zugehört werden soll und deswegen wird es nicht den perfekten Raum geben, es sollte eine Vielfalt an, an Räumen und Möglichkeiten geben, die unterschiedlichen Aspekten des Lehrens und Lernens gerecht werden (vgl., Pos. 220-224).
Transkriptionsregeln
Aufgrund eines technischen Fehlers bei der Transkription sind, anders als sonst üblich
B= Befrager*in und I= Interviewte Person.
Zudem wurde einer Version des Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2011) gefolgt, die von Lösener (2018) vereinfacht wurde.
Vereinfachtes Transkriptionssystem (nach Dresing & Pehl 2011)
1.Transkriptionsregeln
1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautspracNich oder rusammenrfassend Vorhandene Dialekte werden wortgenau wieeergegeben
2. Wort- und Sattabbruche sowie Wortdoppelungen werden erfasst (z.B. .Das war so ein, so ein (...) Musical, so eine Art jedenfalls.*)
3. Wortverschlerfungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schnftdeutsche angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt* wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt* und Jiamma* wird zu „haben wir*. D e Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindcutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt Dabei sollen Sinneinheiten bei behalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte In Klammern (_) markiert.
6. Verständnissignale des Dialogpartners (z.B. des Studierenden) wie „mhm, aha, ja, genau, ahm" etc. werden transkribiert
7. Besonders betonte Silben oder Wörter werden durch GROSSschreibung gekennzeichnet
8. Jeder Sprecherbertrag erhalt eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwurfe werden in enem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt Beispielsweise;
B Ich habe es dort #00'02:05l*
I: Wo genau? «00020S9«
B gekauft. Im Kaufhaus um die Ecke. —
9. Emotionale nonverbale Äußerungen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz In Klammern notiert.
10 Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst milder Ursache versehen werden (unv., Handystörgerausch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Salzte! m«t einem Fragezeichen in Klammem gesetzt Zum Beispiel. (Xylomelhanoiin?) Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeltmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt st
11. Der/die sprechende Schüler /in wird durch Sl, S2, S3 etc . die Lehrperson durch ein ,L* gekenn zeichnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Transkripte[103]
Interview Luisa (w.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Arbeitsvorgänge in MAXQDA
Beispiel Transkript mit Kategorienbildung am Text
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beispiel Codevergabe:Schäden von zu wenig Bewegung
- Entzündungen Sehnen/Gelenke
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende von erlebten Entzündungen an Gelenken und Sehnen aufgrund bewegungsarmen Lernens und Studierens berichten.
Hier wird als Beispiel eine Sehnenscheidentzündung aufgeführt.
- Kognitive/ Gehirnphysiologische Beeinträchtigungen
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende von erlebten kognitiven Beeinträchtigungen und gehirnphysiologischen Folgen aufgrund bewegungsarmen Lernens und Studierens berichten.
Hier werden als Beispiele auftretende Ermüdung und Konzentrationsprobleme genannt
- Muskuläre Probleme
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende von erlebten muskulär-bedingten Folgen aufgrund bewegungsarmen Lernens und Studierens berichten.
Hier werden als Beispiele Schmerzen aufgrund von Verspannungen im Nacken und Rücken, wie ein allgemeines Erleben von "Steifheit" genannt.
- Motivationsprobleme
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende von erlebten Motivationsproblemen aufgrund bewegungsarmen Lernens und Studierens berichten.
Beispiel CodeVergabe Grenzen
- Individuelle Bedürfnisse
Dieser Code wird vergeben, wenn angesprochen wird, dass das Bedürfnis nach Bewegung bei Studierenden unterschiedlich ist und darauf geachtet werden muss.
- Sitzende Norm
Diese Hauptkategorie umfasst alle Aussagen die von Student:innen bezüglich einer sitzenden Norm in Veranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule gemacht wurden.
- Negative Reaktionen Normdurchbrechung
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende davon berichten, dass sie bezüglich der Durchbrechung der sitzenden Norm negative Erlebnisse hatten.
Als Beispiel sind hier eher negative Reaktionen seitens Studierender oder Dozierender aufgeführt.
- noch nicht normalisiert/ sozial akzeptiert
Dieser Code wird vergeben, wenn beschrieben wird, dass und wie Bewegung beim Lernen und Lehren noch nicht sozial akzeptiert, oder noch nicht als Norm angekommen ist.
- kein Engagement Studierender
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende persönliche Gründe nennen, warum sie sich nicht für Lernraum(um)gestaltung engagieren können.
- Handlungsspielräume PH
Dieser Code wird vergeben, wenn Studierende als mögliche Hürden der Lernraumgestaltung Handlungsspielräume der Pädagogischen Hochschule nennen.
Beispiele Visualisierungen
Hierarchisches Code-Subcodes-Modell
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ausschnitt Mural Board SeminarLernräume gestalten
Ideenfindung „Design-Thinking-Methode“ Gruppenarbeit „Bewegtes Lernen“ (WiSe 2020-221)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Selbstexperiment: Lernwanderin in Bewegung
Selbst konnte ich während der Bearbeitungszeit meiner Masterarbeit austesten, wie ich am besten arbeiten kann. Selbst habe ich gemerkt, wie es mir guttut, mich zwischendurch immer wieder zu bewegen oder nach spätestens zwei Stunden kurz aufzustehen. Die Bereitstellung von Stehtischen in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Heidelberg haben mir dabei geholfen. Ich habe verschiedene Bibliotheken in der Universitätsstadt Heidelberg ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich in der Bibliothek der alten Pädagogischen Hochschule, der Zentral-Bibliothek, am besten schreiben konnte, einzig und allein deshalb, weil es dort bewegliche Sitzhocker und variable verschiebbare Stehtische gibt, die ich in anderen Bibliotheken nicht vorfand. Bewegliche Stehtische haben den Vorteil, dass man sich auch mal zu einer Fensterseite schieben kann, um mehr Licht abzubekommen, was mir immer sehr wichtig war. In anderen Bibliotheken, auch der Universität Heidelberg, fand ich, wenn überhaupt Plätze zum Stehen nur feste, nicht veränderbare Tische vor, die meist in einem eher dunklen Bereich weit weg von Fenstern vorzufinden waren.
Zusätzlich präparierte ich eigenständig meinen Home-trainer, um meinen Laptop drauf zu platzieren und nebenher radeln zu können und fand diese Alternative deutlich besser, konzentrationsfördernder und abwechslungsreicher als stundenlang auf einem Stuhl zu sitzen.
Durch das Ausprobieren von langem Sitzen auf nicht beweglichen Stühlen und im Vergleich dazu den beweglichen Sitzhockern in der Zentralbibliothek der alten PH kann ich außerdem sagen, dass ich mich deutlich wohler auf den Sitzhockern gefühlt hatte, da diese sich meinem Sitzbedürfnis mit gelegentlichem nach hinten und vorne beugen besser anpassten. Obwohl ich auch an mir selbst beobachtet habe, was schon wissenschaftlich bestätigt ist, konnte ich aufgrund des unvermeidlichen vielen Arbeitens vor dem PC wegen dieser Masterarbeit nicht verhindern Rückenschmerzen zu bekommen und einen versteiften Nacken, weshalb mir die Idee zu alternativen Prüfungsformaten kam (Sieh Kapitel 1.3.3. ).
Da ich zu den Menschen gehören, die Routine nicht ausstehen können und lieber viel Abwechslung und verschiedene Reize an einem Tag erleben, habe ich mich ganz automatisch als Lernwanderin ausprobiert. Abgesehen davon, dass ich oft mit dem Fahrrad unterwegs bin und allgemein mittlerweile bei Reisen mit der Bahn aufgrund des angehäuften Wissens stehe und mich freue, wenn ich in einen anderen Zug umsteigen muss, um dadurch Bewegung in meine Reise hineinzubringen, war ich als Lernwanderin auch viel in Bewegung: Da ich sehr oft zwischen Heidelberg und Freiburg pendelte bot sich dies an.
So war ich meist in zwei Städten unterwegs, bin sowohl in Heidelberg als auch in Freiburg in der Bibliothek gewesen und habe mich an die Stehtische gestellt (gibt es in der UB in Freiburg zum Glück auch, aber nur wenige). In den Städten bin ich auch öfters an einem Tag rumgelaufen oder rumgefahren und habe mich so etwa in Heidelberg mit einer Decke in das Feld gesetzt und gelegt, um dort zu schreiben, sehr gerne nutzte ich beim Schreiben der Masterarbeit auch den neuen Außenlernraum an der alten PH, oder bin in Freiburg umhergewandert, habe einmal mit den Füßen im Bächle geschrieben, auf Parkbänken (am liebsten auf der direkt vor dem Münster), in der dortigen Stadtbibliothek und mehr. Auch habe ich oft während Zugfahrten geschrieben (dann natürlich im Sitzen) und konnte mich dabei sehr gut konzentrieren (vor allem in ICE's).
Leider gab es dazu ein paar Einschränkungen, wie etwa, dass es für gewisse Vorgänge doch am besten einen zweiten Bildschirm braucht (wie etwa, wenn nebenher in das MAXQDA-Programm geschaut werden muss), und nicht immer und überall ein Stromanschluss vorhanden ist. Abschließend war ich jedoch sehr gerne Lernwanderin und mobil, weswegen ich hoffe, dass sich dieser Lerntyp weiter durchsetzen darf und sich in der Hochschullehre entwickeln darf.
Bildanhang
Stehtisch und bewegliche (Wackel)hocker in der Bibliothek der alten PH[104]
Kosten[105]
Ein beweglicher Bürostuhl oder ergonomischer Hocker kann je nach Model preislich von 66€ bis zu 600€ schwanken. Einen Stehtisch gibt es je nach Größe und Ansprüchen ab 70€ bis200€ und Balance-Kissen, sowie Prezi-Ball ungefähr ab 2050€.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Loris Malaguzzi, der Begründer der Reggio-Pädagogik, begründete die Beschreibung der Funktion von einem Raum als „dritten Pädagogen“ und erkannte wie befürwortete, dass Lernende durch die Gestaltung von Lern- und Lebensräume die Möglichkeit haben können, auf der Grundlage von (selbst)gesetzten Zielen selbstorganisiert lernen und sich wohlzufühlen zu können (vgl. Koeritz et al. (2022)
2Oder wie Dr. Jochen Schnack, Redaktionsleiter der Zeitschrift PÄDAGOGIK umschreibt: „Eher selten meinen wir mit ,zur Schule gehen‘ das Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfindet. Dieser Ort des Geschehens ist so alltäglich und selbstverständlich, dass er kaum noch der Rede wert ist. Doch zugleich bin ich sicher, dass die meisten [...] eine starke, synästhetische Erinnerung an ein Schulgebäude haben: [...] einen Klassenraum [...], der eher karg als üppig ausgestattet ist, mit funktionalen Tischen und einer Tafel mit Kreide und Schwamm gleich neben dem Schreibtisch der Lehrkraft. Vielleicht ein Overheadprojektor [.]“ (ebd., 2020, S. 3).
3Wie etwa bei der Sonderausgabe des 12. Internationalen Bodenseekongress (2017) der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) zu lesen.
4Auch Bernhard et al. (2015) sehen eine Verbesserung der Raumpraxis in der Erwachsenenbildung als dringend notwendig an (vgl. Berhard et al., 2015, S.22).
5Außerdem kann geschlossen werden, dass Bewegung zunehmend instiutionalisiert und in bestimmten Räumen vollzogen wird, wie die wachsende Popularität von Fitnesscentern anzunehmen erlaubt. Wobei zusätzlich ein monotones und gleichförmiges Bewegen wie es oft an Fitnessgeräten vollzogen wird. Dies ist jedoch nicht gerade die beste Bewegungsform für den Körper (vgl. ebd.).
6und seit ein paar Jahren auch virenfreiere
7Leider haben sich bewegungsarme Arbeitsweisen in Zeiten der Pandemie und des Home-Offices noch verschlimmert. So beschreibt Dold (2020) wie aufgrund der Kontaktbeschränkung ganze Meeting-Marathons stattfanden, dabei „ohne dass sich auch nur einen Millimeter vom Fleck bewegt wird. Doch das ermüdet nicht nur, sondern schadet auch Bewegungsapparat und Stoffwechsel“ (ebd.).
8Glöckl und Breithecker (2018) fassen zusammen wie die meisten metabolischen Funktionen unseres Körpers darauf abgestimmt sind, durch Bewegung unterstützt oder sogar erst in Gang gesetzt zu werden.
9Auch bei der Befragung von Student:innen und Absolvent:innen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ergab sich, dass die Lernraumgestaltung in Seminaren und Vorlesungssälen beeinflusst, wie gelernt und studiert werden kann und unbewegliches Mobiliar im Zusammenhang mit tendenziell bewegungsarmen Studieren und Lernen steht (Siehe Kapitel 2.3. Ergebnisdarstellung).
10Nicht nur Schädigungen des Bewegungsapparates und Stoffwechsels werden durch bewegungsarmes, zu sedentäres Verhalten hervorgerufen, es entstehen zahlreiche Krankheitsbilder, auf die in Kapitel 1.3. näher eingegangen wird.
11wie Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, niedriggradige Entzündungen, Arthritis und Arthrosen, Rheuma, Muskel- und Skeletterkrankungen, Osteoporose, verklebte Faszien, Alzheimer, frühzeitige Alterung, bis hin zu Krebs - insbesondere Darmkrebs (ebd., S. 31).
12Nach dem deutschen Institut für Erwachsenenbildung, kurz DIE (2022) spannt der Begriff „Lernraum“ den Bogen hin zur Architektur oder grundsätzlich dem physischen Raum, in dem Lernen stattfindet. Nuissl (2006) spricht von einem „Lernort“ im Zuge der Einrichtung, die Institution, in der gelernt wird. Klassischerweise sei dies „die Bildungseinrichtung, die Schule, die Hochschule, die Akademie“ (Nuissl, 2006, S. 29). Er sieht jedoch neben medienbezogenen Lernorten auch naturbezogene Lernorte wie Waldlehrpfade, Zoologische Gärten, Botanische Gärten, und zählt diese wie wissenschaftsbezogene Lernorte wie Science Center und Wissenschaftsshops, oder auch geschichtsbezogene Lernorte (historische Stadtkerne, Gedenkstätten) und erlebnis- und vergnügungsbezogene Lernorte (Erlebnisparks und Freizeitparks), zu Lernorten (ebd., S.30). Außerdem kann von „Lernumwelten“ gesprochen werden, unter denen diejenigen Umwelten verstanden werden, die „mit der Absicht des Lernens aufgesucht werden“ (Flade, 2008, S.178). Lernumwelten betreffen nach Flade (2008) nicht nur junge Menschen, sondern zunehmend auch Menschen im höheren Alter (ebd. S.178).
13Im empirischen Teil dieser Arbeit wird anhand der Ergebnisse von Interviews gezeigt, dass auch die meisten befragten
14Expert:innen keine rigide Trennung zwischen Lehr- und Lernräumen vornehmen.
15Im Zuge des empirischen Teils dieser Masterarbeit wird auf Außenlehr- und lernräume eingegangen.
16Hochschulen unterscheiden sich von Schulen nach Flade (2008) in baulicher Hinsicht höchstens durch ihre Dimensionierung: „Es sind viele Gebäude, die sich über ein größeres Gelände erstrecken, und es sind meistens große Gebäude mit vielen Seminarräumen und Hörsälen sowie einer Bibliothek, einer Cafeteria und einer Mensa“ (Flade, 2008, S.195).
17So wird eine „Umweltwahrnehmung“ vernommen, was bedeutet, dass sensorische Reize zu Informationen über die Umwelt verarbeitet werden (ebd.). Ein zu hohes oder ein zu niedriges Reizvolumen würden hierbei die Informationsverarbeitung beeinträchtigen (ebd.).
18Jedoch schaffte er es Kommunalpolitiker zu überzeugen, die schlussendlich sogar für seinen hellen Rundbau stimmten und ausdrücklich ein „Haus der Kommunikation, der Vertrautheit, Helligkeit und Harmonie [.] [mit] familiären Charakter und Geborgenheit [.] ohne vom eigentlichen Zweck des gemeinsamen Lernens abzulenken“ in Auftrag gaben (ebd., S. 7).
19Klassische soziologische Texte, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind und vor allem spätere Texte französischer Autoren aus den Aufbruch-Jahren der 1970er, kontextualisierten Raum infolge einer engen Verquickung von soziologischer, historischer und geografischer Ausbildung (Löw & Sturm 2016, S. 2).
20Beispiele dafür sind auch strukturelle, raumgestalterische Vorgaben, wie durch die Bereitstellung bestimmten Mobiliars, die Handeln einschränken.
21Also gewährleisten die Routinen des täglichen Handels und die Institutionalisierung von sozialen Prozessen die Reproduktion gesellschaftlicher, also auch räumlicher, Strukturen gewährleisten (Löw, 2001, S. 172).
22wie ähnlich von Löw (2001) S. 154 beschrieben.
23So beschreibt Löw (2001), was passiert, wenn man als Neuankömmling auf einer Feier erscheint: „Dieser Raum wird zwar auch durch die (An)Ordnungen des Zimmers, das Buffet, Sitzgelegenheiten etc. gebildet, aber ebenso sind die (An)Ordnungen der Menschen und Menschengruppen, die man beim Eintreten erblickt, raumprägend“ (S.154).
24Überdies ist alltäglich zu beobachten, wie Menschen bei freiwilliger, eigenständiger Positionierung zeigen, wie sehr sie Nähe oder Distanz zu anderen Menschen suchen oder nicht (ebd., S. 154) und als Bestandteile einer Raumkonstruktion die Besonderheit aufweisen, dass sie sich selbst platzieren und Platzierungen verlassen, wie durch Mimik, Gestik, Sprache etc. die Raumkonstruktionen beeinflussen (S. 155).
25Diese Sicht unterstützend könnte es, wie Holzbrecher (2012) auf Schulen bezogen beschreibt, auch in einer Hochschule hochwertige Aufenthaltsbereiche geben, Sport- und Spielflächen, Nischen zum Nichtstun, Werkstätten, eine Theaterbühne (vgl. Holzbrecher, 2012), wie zudem bewegungsaktivierende(s) Mobiliar und Ausstattung, genauer beschrieben in den folgenden Kapiteln.
26Es hat sich nach Mehnert (2020) als hilfreich herausgestellt, mit dieser Frage zu beginnen, um sich später nicht in zu vielen Kompromissen der Raumgestaltung zu verlieren.
27In die ruhigste Ecke im Raum diagonal gegenüber vom Eingang, oder doch lieber in die Nähe des Eingangs? (ebd.).
28An Schulen, die nach raumpädagogischen Prinzipien gestalten, sind Schüler: innen mit involviert und bringen etwa Zimmerpflanzen oder Poster für die Wände mit, und in regelmäßigen Abständen wird über die Sitzordnung diskutiert (vgl. ebd., S. 7).
29Der Raum wirke dabei einerseits auf den Menschen ein und sei andererseits Gestaltungsobjekt des Menschen (ebd.).
30Der Erziehungswissenschaftler und Professor sich dabei auf Erkenntnisse der Unterrichtsforschung und vertritt, dass die Umgebung für das Lehren und Lernen besonders bedeutsam ist (Schratz 2007, S. 16).
31Die interviewten Studierenden verbringen durchschnittlich 6 Stunden täglich an ihrer Hochschule. Es wurde festgestellt, dass die räumlichen Möglichkeiten ihrer Hochschulen eine große Rolle spielen (siehe Anhang ausführlich(er)e Fallzusammenfassung).
32In der Pandemie hat sich außerdem gezeigt, dass Lernplattformen, Videokonferenzen, Videostreaming neue Konstellationen erlauben, die über die klassischen Möglichkeiten hinausgehen. So fand Lehre durch erweiterte technische Möglichkeiten, statt, wie Schmidt et al. bereits 2004 beschreiben: netzbasierte Systeme, durch die eine ortsunabhängige Teilnahme möglich ist, auch über große Entfernungen oder zeitversetzt und das elektronische Versenden von Lehrangeboten, eine ortsunabhängige Teilnahme, wie interaktives Präsentieren Schmidt et al. (2004). Um Beispiele zu nennen kann aus eigenen Erfahrungen berichtet werden, dass Student: innen während Online-Veranstaltungen etwa sogar in einer Innenstadt unterwegs waren, sich Draußen auf einer Bank oder im Grünen befanden, manche kochten nebenher oder machten Gymnastikübungen, andere wechselten währenddessen die Räume in ihrer Wohnung, oder ein Dozent hielt sogar eine Vorlesung aus dem Ausland aus seinem Auto heraus. Das Einzige dabei erlebten Hindernis war manchmal eine schlechte Internetverbindung.
33Die Initiatoren stellen dafür nicht nur insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung, sondern zeigen auch noch in einem Positionspapier des Stifterverbandes mit zehn Leitlinien auf, wie zukunftsorientierte Lernräume aussehen können (Groß 2022). Es wird dabei die Ansicht vertreten, dass die sich wandelnde Lebens- und Arbeitswelt ein neues Lernen in innovativen Lernräumen fordert und bauliche Umsetzungen von Hochschulen unbedingt den Bedürfnissen der Lehrenden und Studierenden entsprechen sollte. Außerdem sollten didaktische Prinzipien bedacht werden und individuelle Lernprozesse der Lernenden gefördert werden (vgl. ebd.).
34Unter dem „Shift from Learning to Teaching“ - zu Deutsch der Verlagerung vom Lehren zum Lernen- verstehen die Au- tor:innen des Leitpapiers die „Förderung des selbstgesteuerten Lernens der Studierenden mit einem studierendenzentrierten Lehransatz“ (ebd., S. 3).
35Die Thematik „Studierendenzentrierung und Diversität“ ist hier zentral (ebd.). Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen der Lernsettings ergeben sich aus den neuen Möglichkeiten Erfordernisse an die Nutzungsmöglichkeit, die Zugänglichkeit und die Bedingungen (ebd.). Jedoch fehlen dabei Akteur: innen oft die nötigen Möglichkeiten, sich selbst organisieren zu können da starre Hochschul- und Gesetzrichtlinien wenig Gestaltungsspielraum oder Adaptionsfähigkeit von bestehenden Räumen zu lassen (ebd.).
36Notwendig ist hier dringend ein Perspektivenwechsel auf die Lernenden und damit eine „erhöhte Studierendenzentrierung als primäre Zielgruppe in der Nutzung dieser Räume“ (Koeritz et al. 2022, S. 3). Um dies zu konkretisieren, können als Anreiz neben Selbstorganisationsmöglichkeiten und Partizipation in der Entscheidungsfindung auch erhöhte Autonomie bei Lernenden in Hochschulen genommen werden (ebd.).
37Reformpädagogische Ansätze setzten zudem schon länger als Qualitätsmerkmal das Lernen an außerschulischen Lernorten (vgl. GEW 2007, S. 15, zit. nach Herz 2005). Gleich wie die Öffnung von Schule in lernrelevante Lebensräume hinein ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Schule stellt (vgl. GEW 2007, S. 15, zit. nach Herz 2005), kann ein Umdenken der traditionellen Vorstellung davon, wo Lernen stattfinden kann, auch an Hochschulen zu einer Qualitätssteigerung des Studierendenalltags bedeuten.
38Studierende können dabei ihre Lernumgebungen aktiv gestalten und dadurch Selbstwirksamkeit und Gestaltungskompetenzen erlangen. Koeritz et al. (2022)
39Die beschriebenen Auswirkungen sind die für Autorin dieser Arbeit hervorstechendsten, aufgrund der Begrenzung des Umfangs ist die Liste allerdings nicht vollständig.
40Deshalb wären Springseile oder Kletterwände für einen Außenlernraum sinnvoll.
41Die Flüssigkeit, die sich zwischen unseren Gelenken befindet, „Synovia“ ist auch von Bewegung abhängig, denn sie wird durch solche angeregt (ebd., S. 11). Sie nimmt eine wichtige Position in unserem Körper ein, da sie in der Funktion eines „Schmiermittels“ die Beweglichkeit sicherstellt, gemeinsam mit Knorpel als Stoßdämper wirkt und dem Abtransport von Abbauprodukten des Gelenkknorpels (ebd.).
42Wenn ein Knochen nicht belastet wird, reagiert er mit Demineralisierung, woraus aus Folge Osteoporose entstehen kann. Deshalb ist das beste Entgegenwirken um Osteoporose zu verhindern, Belastung in Form von Bewegung (vgl. ebd.)
43Glöckl und Breithecker (20l8) beschreiben dies wie folgt: „Ein Mensch, der vorwiegend am Schreibtisch sitzt, braucht vorwiegend Glukose für sein Gehirn, nicht aber für seine Muskelzellen. Wenn nun trotzdem vor allem Kohlenhydrate mit einem hohen Glykämischen Index, die also schnell ins Blut übergehen, zugeführt werden, können die vollen Glukosespeicher diese nicht mehr aufnehmen - mit der Folge, dass sich der Büromensch Fettpölsterchen anlegt“ (ebd.). Die Anlage von Fettreserven ist in der heutigen Zeit und im Besonderen in industrialisierten Ländern eher hinderlich, da das Nahrungsmittelangebot sehr oft übermäßig vorhanden ist, während der Aufwand, Nahrungsmittel zu besorgen, bekannterweise geringer geworden ist (ebd.).
44Die Entstehung dieser wird durch den Druck der Vorderkante des Stuhls auf die Unterseite der Oberschenkel begünstigt, da der Rückfluss venösen Blutes aus den Beinen behindert, oder manchmal sogar unterbrochen wird. Die abgeklemmten Gefäße können dann mit Stauungen in den Waden und im Beckenboden reagieren (ebd.).
45Eine valide Untersuchung des Einflusses von motorischem wie musikalischem Training auf geistige Rotationsleistung etwa anhand eines experimentellen Designs steht noch aus.
46Um dies zu untersuchen, hatte sie Kindern einer Klasse Synonyme für das Wort „gehen“ durch Bewegtes Lernen näher gebracht. Eine weitere Klasse, die die Kontrollgruppe bildete, hat diese ohne Bewegung gelernt. Zu drei Messzeitpunkten hatte sie anschließend die Anzahl der erinnerten Synonyme der Kinder beider Klassen festgestellt und miteinander verglichen.
47Alsneurotrophe Faktoren werden alle Faktoren bezeichnet, die einerseits die Nervenzelldifferenzierung - sowohl auf morphologischer als auch auf biochemischer Ebene - stimulieren und andererseits für das Überleben von Nervenzellen mitverantwortlich sind. Bei der morphologischen Differenzierung stimulieren neurotrophe Faktoren definierte Prozesse der Axogenese, Dendritogenese und Synaptogenese (Bildung von Axonen bzw. Dendriten bzw. Synapsen). Die biochemische Differenzierung beinhaltet die Bildung spezifischer Transmitterstoffe (Neurotransmitter) und anderer Neuromediatoren durch Enzyminduktion. - Die meisten der neurotrophen Faktoren zeichnen sich jedoch auch durch eine oder mehrere weitere Funktionen außerhalb des Nervensystems aus. Diese Proteine werden dann wegen ihrer Bedeutung in immunologischen Prozessen als Cytokine oder im Rahmen der Proliferationskontrolle auch als Wachstumsfaktoren i.w.S. bezeichnet, was zu einer Überschneidung dieser Begriffe geführt hat. Zu den bisher gefundenen neurotrophen Faktoren gehören Mitglieder folgender Familien: 1)Neurotrophine(z.B. Nerve growth factor, BDNF, NT-3 [Neurotrophin-3], NT-4/5 [Neurotrophin-4/5]); 2)GDNF- Familie(GDNF [Abk. fürglial cell line-derived neurotrophic factor], Neurturin, Persephin, Neublastin); 3)CNTF-Familie(z.B. CNTF, Cardiotrophin-1); 4)TGFß-Superfamilie(TGFßl, TGFß2, TGFß3 [TGF], BMP, GDF-1 [GDF]); 5)FGF- Familie(z.B. FGF-1, FGF-2, FGF-5, FGF-9 [fibroblast growth factor]); 6)EGF-Familie(z.B. epidermal growth factor, HB- EGF]; 7)IGF-Familie(z.B. IGF-1, IGF-2 [insulin like growth factor]) (vgl. Spektrum.de, Copyright 1999 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg).
48Die Neurotrophine signalisieren sowohl über hochaffine trk-Rezeptoren als auch über den nieder-affinen Rezeptor p75NTR. Eine Defizienz für den BDNF-spezifischen Rezeptor trkB führt beispielsweise zu Veränderungen auf Ebene der dendritischen Dornen im Hippocampus. Dendritische Dornen sind kleine postsynaptische Strukturen die an der Bildung erregender Synapsen beteiligt sind. Diese Strukturen sind entscheidend an neuronaler Plastizität beteiligt. Beispielsweise kann Lernen die Anzahl dendritische Dornen erhöhen. Veränderungen der Anzahl oder der Morphologie dendritischer Dornen findet man auch bei Erkrankungen, wie bei der Depression oder bei einigen Formen der mentalen Retardierung. P75NTR-defiziente Mäuse weisen nicht nur Veränderungen im Verhalten und auf Ebene der dendritischen Dornen auf, sondern auch Veränderungen der cholinergen Innervation des Vorderhirns (vgl. Universitätsmedizin Greifswald, Institut für Anatonomie und Zellbiologie).
49Welches eventuell auch die Sicht einer Trennung von Körper und Geist enthält, wobei geistige Prozesse auch beim Bewegen immer aktiv sind.
50Bei einer relativ kleinen Stichprobe
51Worauf bei dem zweiten Ansatz genauer eingegangen wird.
52Chiara Dold, die Koordination von dem Studentisches Gesundheitsmanagement PHeelGood, des Projektes Kopf-Stehen und des Teilprojekts Leicht bewegt im Rahmen von TRANSFER TOGETHER der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg ist, entwickelte ein webbasiertes Toolkit, das Unternehmen dabei unterstützt, leichte körperliche Aktivität in den Arbeitsalltag zu integrieren. Dold (2020).
53Wie auch im Empirie-Teil dargelegt wird, sind festgeschraubte Bänke und Stühle in Hörsälen nicht nur sehr unbeliebt, sondern verbunden mit wenig Bewegung, schlechterer Konzentration und auch einer eher negativ besetzten LernraumZuschreibung.
54Siehe Anhang Mural Board Seminar “Lenräume gestalten“ WiSe 2020-21
55Schon vor mehr als 1000 Jahren wurde im Gehen meditiert und diskutiert. Gelehrt und gelernt wurde im Stehen und auf dem Boden in Wechselhaltungen (Glöckl & Breithecker, 2018, S. 129). Nach Glöckl und Breithecker (2018) wandelten schon die Schüler von Aristoteles während der Wissensaneignung in großen Hallen umher, weshalb man sie auch man Peri- pathetiker („Umherwandler“) nannte. Außerdem seien die Wandelhallen und Promenaden in den Klöstern und Kirchen der Antike Beweis dafür, dass Bewegung der Unterstützung geistiger Arbeit und Konzentration diente Glöckl und Breithecker (2018, S. 141).
56Um sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt zu entscheiden, sollte auf Prüfsiegel geachtet werden, wie die CE- Zertifizierung, welche Mayer (2021) für obligatorisch hält, da diese aussagt, dass das Produkt die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union erfüllt (ebd.). Zudem zeige das „GS-Zeichen“ die Mindestanforderungen der elektrischen und mechanischen Sicherheit an und das Qualitätszeichen „Quality Choice“ versichere höchste Anforderungen beim Qualitätsnachweis (ebd.). Weiterhin stellen diverse DIN-Normen eine Rolle Mayer (2021)
572019 berichtet Jennifer Gaschler davon, wie der Hochschulsport an der Freien Universität in Berlin noch mit dem Pausenexpress und einem Spielemobil für mehr Bewegung im Studierendenalltag sorgt (ebd.). Das gesamte Projekt der FU Berlin nennt sich „Move4Health“ und hat als innewohnendes Ziel Anreize für mehr Bewegung im Uni-Alltag zu schaffen (vgl. Kuban 2020).
58Der ökologische Aspekt ist ein weiterer Grund dabei. Klaus Ulrich Werner, promovierter Bibliotheksleiter, findet eine Investition in mehrere Räder noch aus einem anderen Grund gut, nämlich aufgrund des ökologischen Aspektes, denn selbst wenn nur wenig Strom produziert wird, findet er, dass es auf die Bewusstseinsänderung ankommt Gaschler (2019).
59Die Gruppe um Bregler et al. (2020-21) bearbeitete den Themenschwerpunkt der bewegungsaktivierendere Lernraumgestaltung (siehe Anhang Mural Board).
60und sollte - im Optimalfall - auch bei den Befragten (Selbst-)Erkenntnisprozesse in Gang setzen.
61Die Übertragbarkeit von Gütekriterien der quantitativen Forschung ohne Weiteres auf die qualitative Forschung wird von vielerlei Positionen kritisiert (vgl. Steinke, 2007 S. 320-321). Als Gründe hierfür können die wissenschaftstheoretischen, methodologischen, wie methodischen Besonderheiten qualitativer Forschung genommen werden (vgl. ebd., S. 320). Manche lehnen sogar generell ab Qualitätskriterien für qualitative Forschung zu formulieren (vgl. ebd., S. 321).
62Siehe Anhang Leitfaden
63„Der Raum wurde bisher in seiner Bedeutung für die Bildung unterschätzt. Er ist der , dritte Pädagoge ‘ neben den Erwachsenen und den anderen Kindern und Jugendlichen.“ (Rheinhard Kahl) Ein Zitat von Reinhard Kahl (Erziehungswissenschaftler, Journalist)
64Nach Kuckartz (2018) stützt sich die heutige qualitative Inhaltsanalyse einerseits auf historische Vorbilder wie Kracauer, welche sich nicht auf den manifesten Textinhalt und dessen Quantifizierung beschränken wollten, aber andererseits auch „auf hermeneutische Traditionen, von der sie eine Menge über die Grundprinzipien des Textverstehens lernen kann.“ (S.21). Kracauers Forderung nach einer um Elemente der Interpretation erweiterten Form der Inhaltsanalyse in den vergangenen Jahrzehnten wurde Kuckartz (2018) zufolge vielfach in Forschungsprojekten wie auch in der Methodenliteratur aufgegriffen (S.26). Nach Kuckartz (2018) wird der Begriff „Qualitative Inhaltsanalyse“ sehr oft häufig mit den in Mayrings Buch gleichen Titels dargestellten Analyseform gleichgesetzt, allerdings existieren in der Forschungspraxis zahlreiche Formen qualitativer Datenauswertung“ (Kuckartz, 2018, S. 26).
65und damit die Interviews der Studierenden höchstwahrscheinlich eine andere Dynamik entwickelten als mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin.
66Kuckartz (2018) nennt weitere Kernpunkte der Hermeneutik, die für eine Inhaltsanalyse von Bedeutung sind(ebd., S. 18).66Es sollte etwa eineBeachtung der Entstehungsbedingungenerfolgen - in dem Sinne, dass sich bewusst gemacht wird, welche Bedingungen mit hineinspielten als der zu analysierende Text, wie zum Beispiel ein Interview, entstanden ist (vgl. Kuckartz 2018, S. 18). Es sollte sich gefragt werden, wer mit wem kommuniziert und welche Bedingungen dabei vorherrschend waren (ebd.). Es ist auch zu beachten, welche Forscher-Feld Interaktionen bereits im Vorfeld des Interviews stattgefunden haben und wie die Interaktion zwischen dem Interviewpartner und dem Interviewer zu beurteilen ist (ebd.). Ein weiterer bedeutsame Kernpunkt der Hermeneutik ist diehermeneutische Differenz.Mit der hermeneutischen Differenz ist gemeint, dass alles, was gedeutet werden soll, zunächst fremd ist, da erst durch den Deutungsprozess ein Verstehen bzw. vermeintliches Verstehen erreicht werden kann(vgl. Kuckartz 2018, S. 19). Die„Angemessenheit und Richtigkeit“ bezieht sich darauf, dass hermeneutische Verfahren „der Versuch, kulturelle Produkte wie Texte, Bilder, Kunstwerke etc. zu verstehen“ sind, jedoch keine Methodik eine Richtigkeit garantieren kann (vgl. ebd., S. 19-20). Die Hermeneutik kommt überdies nicht ohne „den Verstehenden“ aus, der auf natürliche Art und Weise allerdings immer schon ein Vorverständnis über den Gegenstand des Verstehens besitzt (ebd.). Kuckartz (2018) erläutert: „Eine den Kriterien intersubjektiver Übereinstimmung genügende hermeneutische Deutung kann deshalb per se nicht postuliert werden. Es gibt keine richtige oder falsche, sondern nur mehr oder weniger angemessene Interpretation“ (S.20).
67Siehe Anhang „Transkriptionsregeln“.
68Die transkribierten Texte konnten als Dokumente in diese Software geladen werden und mit den Audioaufnahmen minutiös verknüpft werden, sodass bei Klicken auf eine bestimmte Textstelle, die entsprechende Passage abgespielt wird.
69Die dabei entstandenen Kategorien und Codes sind Anhang zu finden.
70Siehe Kategoriensystem und Visualisierungen im Anhang.
71Was wiederum etwas mit den Gelenken zu tun hat.
72„B: okay. (...) Und hast du denn das Gefühl gehabt, dass es dir dann auch gelungen ist, den Lernraum nach DEINEN BEDÜRFNISSEN anpassen zu können? I: naja, in der alten PH hatte man ja diese Stehtische, die man noch zusätzlich neben seinen Tisch stellen konnte, wenn man mal stehen hat wollen. [.] ähm. (...) Von dem her, ein bisschen ja“. (Interview Lisa (w.), Pos. 138-141).
73Bei der Methode „Kugellager“ werden Sitzkreise gebildet, ein Innen- und ein Außenkreis, so dass jede*r einen Gegenüber hat. Mit einem akustischen Signal wird das Zweiergespräch freigegeben und sich mit dem/ der Partner*in über das Thema ausgetauscht. Nach einigen Minuten wird ein erneutes akustisches Signal gegeben, damit die Teilnehmer:innen des Innenkreises zwei Plätze im Uhrzeigersinn weiterrutschen. Mit dem*der neuen Partner*in wird erneut über das Thema diskutiert (vgl. Methodenkartei Universität Oldenburg 2022).
74Siehe Anhang Transkript Luisa Pos. 24 - 35 (0)
75Das studentische Gesundheitsmanagement PHeel Good ist ein Kooperationsprojekt der Techniker Krankenkasse und der PH Heidelberg.
76„[.] Also wie gesagt, ein schönes Beispiel finde ich eben diese Hocker. Die sind jetzt auch nicht besonders teuer. Und, du musst dafür nicht aufstehen ähm und, du bewegst aber trotzdem so deine, dein Becken und deinen Rücken. Und das finde ich halt sehr angenehm, kann manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend sein [.] aber sowas zum Beispiel, das wäre- das ist ja auch was, was nicht, jetzt, keinen großen, also - das brauch ja gar keinen Umbau in irgendwelchen Räumlichkeiten. Ähm, dann, ja. Höhenverstellbare Tische wären echt schon, schon was Schönes [.]“ (Interview Lisa (w.), Pos. 185-188)
77sechs Monate vor den Interviews mit den Studierenden.
78„[...] man merkt den Personen oder den Dozierenden dann manchmal schon an, dass es sie stört, also, oder in dem Fall hat man schon gemerkt, dass es gestört hat einfach“ (Milena, w., Pos. 177 - 177).
79I: man kennt das ja auch, dass die jetzt meistens häufig viel stehen, wenn sie ähm unterrichten und ich mein, vielleicht gäbe es für die auch andere Möglichkeiten, vielleicht wollen die auch mal sitzen (lacht), oder, NICHT immer FRONTAL vorne stehen, sondern auch mal nach hinten laufen[.]“ (Milena, w., Pos. 263 - 263).
80Und. Ja. es ist, es wirkt halt einfach nicht so als wäre das schon NORMALISIERT, dass man auch ANDERS ähm (lacht) also AUFRECHT sich dem Unterrichtsstoff oder dem UNI-Stoff folgen darf, ja. (ebd., Pos. 148 - 151)
81„Da finde ich so Seminarräume für so flexibles Lernen und Lehren eigentlich besser, also da lerne ich lieber, oder gehe ich lieber studieren, so gesagt“ (Milena, w. Pos. 61 - 67 (0).
82Besonders die Beschreibungen, die darauf hinweisen, wie wichtig das Handeln der Akteur:innen in Lenräumen war, sei es als Einfluss darauf welche Norm vorherrschte (siehe Milena), oder die Menschen als Wohlfühlfaktor trotz unpersönlicher Räume (siehe Anna), das Treffen von und der Austasuch mit Gleichgesinnten zum gemeinsamen Studieren (siehe Alex, Milena, Lisa, Anna) zeigt, was für eine wichtige Rolle Menschen für einen Ort oder Raum spielen und wie wichtig nicht nur das Handeln von Menschen, sondern auch das Vorhandensein und das Zusammentreffen von Menschen in Bildungsinstitutionen ist - zumindest für die interviewten Proband:innen. Zumindest scheinen Belange bezüglich der Pädagogische Hochschule trotz des Nicht-mehr-vor-Ort-Seins nicht völlig belanglos und von keinem Interesse mehr zu sein, dagegen würde trotzdem Energie aufgewandt um sich der Fragen ausführlich zu widmen und sich emotional hineinzubegeben.
83Fotos dieses neuen Außenlernraumes, der nach eigenen Beobachtungen im Sommer 2022 sehr rege - sogar an Wochenenden - genutzt wurde, befindet sich im Anhang.
84Siehe Bildanhang: Außenlernraum Pädagogische Hochschule Heidelberg.
85So beschreibt das auch eine Lehramtsstudent: in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg: „hm (bejahend) finde ich schon, ja, also zu diesem BEWEGLICHEREN hin, finde ich schon wichtig, ähm ich hatte auch schonmal ein Seminar dazu besucht und da wurde es mir so richtig bewusst, wie viel man doch SITZT, als Studierende [...] und ähm wie WIR ja dann auch den SCHÜLER.INNEN später weitergeben, oder wie arg das dort trainiert wird, ja und das ist ja genauso wie es bei uns in der Vergangenheit trainiert wurde, dass wir die ganze Zeit SITZEN im Unterricht [.]“ (Interview Luisa (w.), Pos. 53-55).
86Ganz aktuell widmete sich die Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW in ihrer kompletten ersten Ausgabe des Jahres 2022 dem Thema „Mitbestimmung in Bildungseinrichtungen“, denn es wird aktueller denn je.
87In mittelalterlichen Universitäten hatten Studierende zum Beispiel sehr viel zu sagen. Wie Schultheis (2022) darlegt, waren diese nämlich mit ihren Professoren größtenteils gleichgestellt und in Bologna wurde der Rektor sogar aus der Studierendengruppe ausgewählt (S.18).
88In mittelalterlichen Universitäten hatten Studierende zum Beispiel sehr viel zu sagen. Wie Schultheis (2022) darlegt, waren diese nämlich mit ihren Professoren größtenteils gleichgestellt und in Bologna wurde der Rektor sogar aus der Studierendengruppe ausgewählt (S.18).
89Das Interview mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau M. wurde nicht in das Kategoriensystem, mit aufgenommen, da ein anderer Leitfaden verwendet wurde.
90Es kann davon ausgegangen werden, dass sie an dieser Stelle Seminarräume meint.
91Dabei handelt es sich um Bretter, die eine gerade Oberfläche haben und unten gewölbt sind, weshalb es ein Balancieren braucht um sich darauf halten zu können (vgl. Luisa, w., Pos.185 - 199 (0)).
92„in die man so EINsinkt sozusagen und DA kann man also LÄUFT MAN dann auch so ein bisschen drauf rum und ähm (...) ja, das GEWICHT geht dann halt IN diese Matte da rein“ (ebd.)
93So kann man davon ausgehen, dass sie mindestens sechs Stunden in Lernräumen an der PH verbrachte.
94Es handelt sich dabei um die von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin umschriebenen „Stehlabore“.
95Genauere Namensnennungen werden aufgrund der Anonymisierung unterlassen.
96Eine sehr breite Wiesenfläche vor dem Fluss Neckar in Heidelberg.
97„[.] ist natürlich die Frage ob das dann IMMER passt, ähm weil ja dann denn die, nächste, Gruppe vielleicht schon nach eineinhalb Stunden wieder rein muss, dann müsste man es halt zurück stellen, aber wenn man zum Beispiel ähm sich da GEMEINSAM ähm einigt“ (Milena, w. Pos. 257 - 258)
98weil ich da jetzt auch während Corona teilweise gemerkt habe, dass die ähm Schule-äh die PH einfach gesagt hat, ja wir sind aber nicht zu 100% zuständig für die Bib, ähm die machen auch ihre eigenen Regelungen, und das finde ich dann teilweise schwierig (ebd., 253 - 253 (0)).
99Er erwähnt dabei die Platform „Stud.Ip“, eine Abkürzung fürStudienbegleitenderInternetsupport vonPräsenzlehre, die von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg genutzt wird. Mit dieser können Veranstaltungen organisiert werden, Gruppen erstellt, Dateien hochgeladen, Nachrichten verschickt werden, aber auch Links zu Umfragen bei einer Art Startseite eingestellt werden, die jedem/r Nutzer:in angezeigt wird.
100Ein gemeinsam genutztes Gebäude von Universität und Pädagogischer Hochschule- in der Nähe der „alten PH“, siehe Abkürzungsverzeichnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser akademischen Arbeit?
Das Ziel dieser Arbeit ist die Analyse von Chancen und Grenzen einer bewegungsaktivierenden Gestaltung von hochschulischen Lehr- und Lernräumen, basierend auf theoretischen Grundlagen und einer empirischen Untersuchung.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie theoretische Hinführung, gesellschaftliche Entwicklungen, Lehr- und Lernräume, Lernen und Bewegung, empirische Untersuchung, Forschungsfrage, Forschungsdesign, Ergebnisdarstellung, Gesamt-Zusammenfassung und Fazit, Literaturverzeichnis und Anhang.
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen werden in Bezug auf Bewegung betrachtet?
Die Arbeit untersucht gesellschaftliche Entwicklungen wie zunehmende Digitalisierung, Technisierung und deren Auswirkungen auf Bewegungsarmut, sowie die Diskrepanz zwischen genetischer Prädisposition zu Bewegung und modernem, sitzendem Lebensstil.
Welche Schäden werden durch Bewegungsmangel verursacht?
Bewegungsmangel kann zu muskulären Schmerzen, Verspannungen, Beeinträchtigung kognitiver Leistungen, Stoffwechselstörungen, erhöhtem Risiko von Bandscheibenvorfällen, Gefäßerkrankungen und einer Schwächung des Immunsystems führen.
Welche positiven Auswirkungen hat Bewegung?
Bewegung kann die kognitiven Leistungen verbessern, Stress reduzieren, das soziale Miteinander fördern, die Stimmung verbessern und die allgemeine Gehirnleistung steigern.
Welche Ansätze für bewegungsaktivierende Didaktik werden vorgestellt?
Es werden zwei Ansätze vorgestellt: Bewegung getrennt vom Lernen (z.B. Bewegungspausen) und Bewegung in Kombination mit Lernen (z.B. Stationenarbeit, szenische Interpretationen, Videoformate, Walk and Talk).
Was ist das Heidelberger Modell der bewegten Lehre?
Das Heidelberger Modell der bewegten Lehre ist ein Konzept zur umfassenden und nachhaltigen Integration von Sitzzeitreduktion und Bewegungsaktivierung in die Hochschullehre, bestehend aus fünf Praxisbausteinen.
Welche Forschungsmethoden werden in der empirischen Untersuchung verwendet?
Es werden qualitative Expert:innen-Interviews mit Studierenden und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg geführt, um die Chancen und Grenzen einer bewegungsaktivierenden Gestaltung von Lehr- und Lernräumen aus hochschulischer Sicht zu untersuchen. Die Auswertung erfolgt mittels strukturierender Inhaltsanalyse.
Welche zentralen Ergebnisse werden in der empirischen Untersuchung dargestellt?
Die Ergebnisse zeigen, dass Studierende sich mehr Bewegung und bewegungsaktivierendes Mobiliar wünschen, den Einfluss der Raumgestaltung auf ihre Gesundheit und Lernleistung erkennen und sich eine stärkere Partizipation bei der Gestaltung von Lernräumen wünschen.
Welche Grenzen der bewegungsaktivierenden Gestaltung werden aufgezeigt?
Die Grenzen umfassen individuelle Bedürfnisse (nicht jeder wünscht sich mehr Bewegung), normative Hürden (eine sitzende Lerngewohnheit), mangelndes Engagement (fehlende Zeit für die Teilnahme an Gestaltungsprozessen), Handlungsspielräume der Hochschule (strukturelle, gesetzliche und finanzielle Beschränkungen).
Welche Empfehlungen werden gegeben?
Es werden Empfehlungen gegeben, wie beispielsweise durch eine diversitätssensible (Um-)Gestaltung des Hochschulsettings auf Basis einer Analyse der individuellen Bedürfnisse und des Bedarfs der Lernenden und Lehrenden (Stichworte: flexible Lernraumgestaltung, bewegungsförderndes Mobiliar, bewegte Didaktik), die studentische Mitbestimmung und das Recht auf eine barrierefreie Hochschulbildung zu fördern, das Schaffen von Transparenz im Hinblick auf die Möglichkeiten der Mitbestimmung als Studierende und die Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden im Rahmen kollaborativer Lehrforschungsprojekte um diese durchführen zu können.
- Arbeit zitieren
- Pia Bregler (Autor:in), 2022, Bewegungsaktivierende Lern- und Lehrraumgestaltung an der Pädagogischen Hochschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1365274