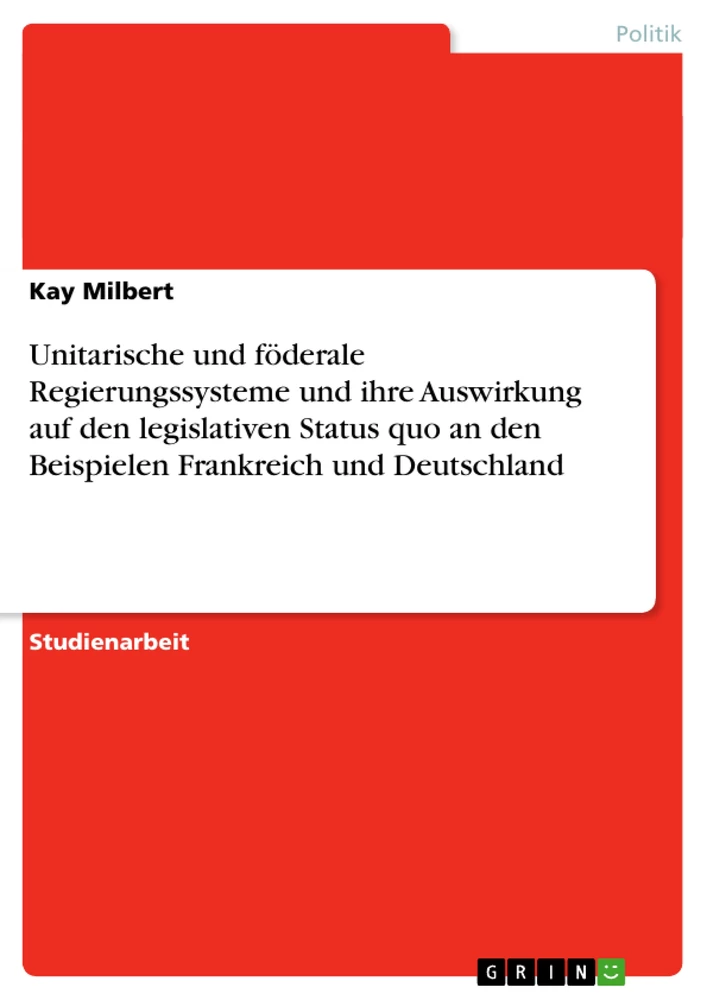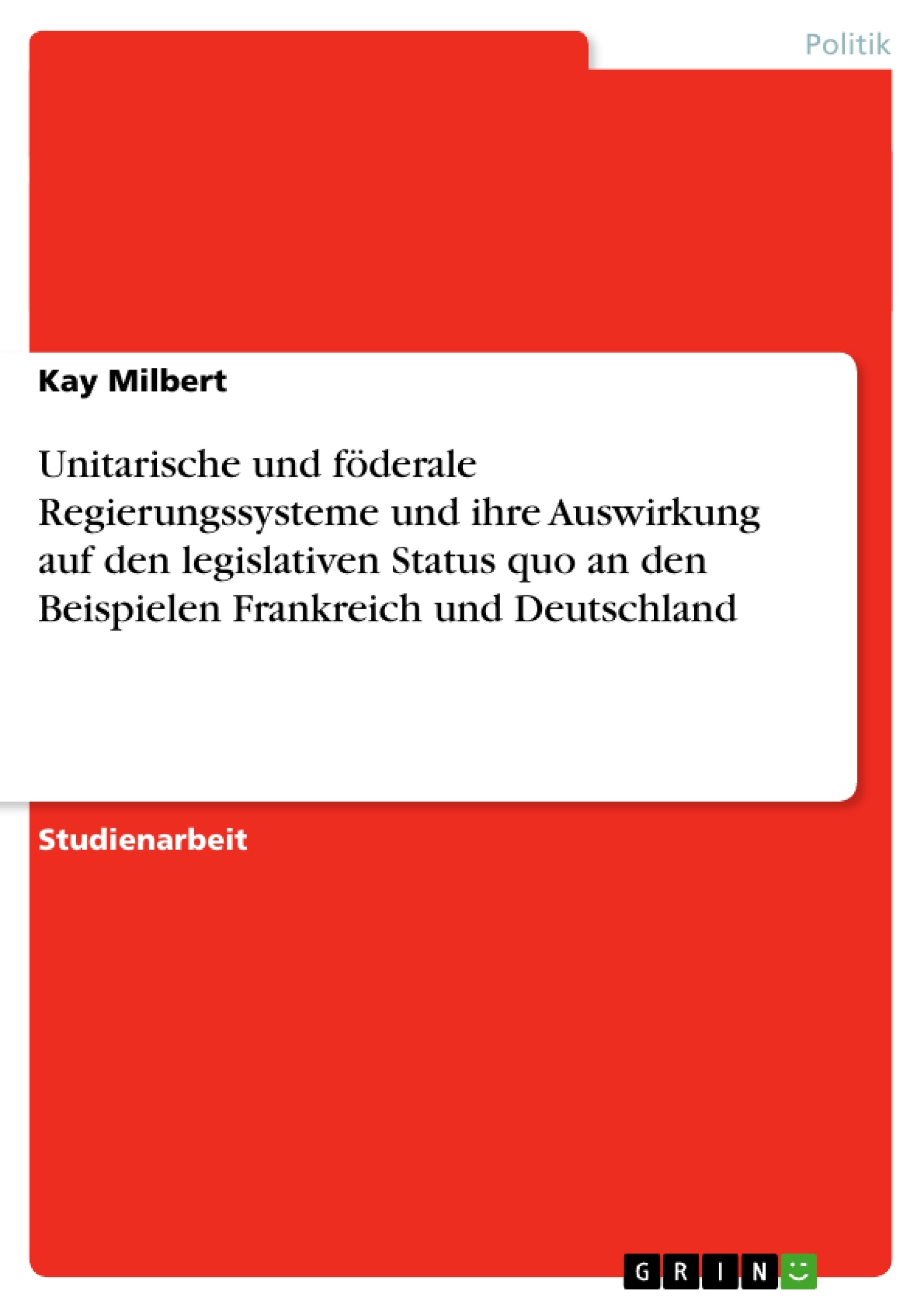Diese Hausarbeit vergleicht das föderale Regierungssystem in Deutschland mit den zentralistischen in Frankreich aus der Sicht des Vetospieler-Ansatzes nach Tsebelis. Dieser Ansatz betrachtet verschiedene politische Akteure die Veränderung von politischen Beschlüssen notwendig ist. Der Vetospieler-Ansatz geht davon aus, das politische Beschlüsse innerhalb der Schnittmege der Positionen der verschiedenen Akteure möglich sind.
Meine Hausarbeit legt den Schwerpunkt auf den Einfluss von Gliedstaaten (in der Bundesrepublik Deutschland Bundesländer) und Gebietskörperschaften auf die Unsetzung von politischen Beschlüssen.
Die Hausarbeit berücksichtig aber nicht nur die Gliedstaaten und Gebietskörperschaften( Department in Frankreich, da sich während meiner Ausführung zeigt, das auch viele andere Akteure Einfluss auf die Änderung politischer Beschlüsse haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Forschungsansätze
- Allgemeine Begriffe
- Forschungshypothesen
- Regierungssystem in Deutschland
- Betrachtung aus verfassungssystematischer Sicht
- Betrachtung aus der Sicht des Vetospieler-Ansatzes
- Regierungssystem in Frankreich
- Betrachtung aus verfassungssystematischer Sicht
- Betrachtung aus der Sicht des Vetospieler-Ansatzes
- Direkter Vergleich des deutschen und des französischen Regierungssystems mit dem Vetospieler-Ansatz
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Regierungssysteme Deutschlands und Frankreichs anhand der Vetospieler-Theorie zu vergleichen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen der föderalen (Deutschland) bzw. unitarischen (Frankreich) Staatsstrukturen auf den legislativen Konsens. Die Arbeit untersucht, ob und wie die Staatsstruktur die Anwendung des Vetospieler-Ansatzes beeinflusst.
- Die Rolle der Eigenständigkeit von Gliedstaaten/Gebietskörperschaften auf den legislativen Status quo.
- Der Einfluss der Anzahl von Gliedstaaten/Gebietskörperschaften auf den Vetospieler-Ansatz und deren jeweilige Positionen.
- Der Einfluss weiterer Faktoren auf den legislativen Prozess.
- Vergleichende Analyse des deutschen und französischen Regierungssystems unter verfassungssystematischer Perspektive.
- Anwendung der Vetospieler-Theorie auf beide Regierungssysteme.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: einen Vergleich der Regierungssysteme Deutschlands und Frankreichs mithilfe der Vetospieler-Theorie, mit besonderem Augenmerk auf die Auswirkungen der föderalen bzw. unitarischen Strukturen auf den legislativen Konsens. Es werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit formuliert, die sich auf die Rolle der Gliedstaaten/Gebietskörperschaften, deren Anzahl und den Einfluss weiterer Faktoren beziehen.
Definitionen: Dieses Kapitel klärt die verwendeten Fachbegriffe, insbesondere im Kontext der Vetospieler-Theorie (z.B. Policy-Stabilität, institutionelle und situative Vetospieler, Winset) und der verfassungssystematischen Betrachtung (z.B. Unitarismus, Föderalismus). Es werden wichtige Konzepte definiert, um eine gemeinsame Basis für die Analyse zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden. Die Definitionen legen den Grundstein für das Verständnis der folgenden Analysen.
Forschungsansätze: Dieser Abschnitt skizziert die methodischen Ansätze der Arbeit. Er beschreibt die Verfassungssystematik als Instrument zur Beschreibung unterschiedlicher politischer Systeme und die Vetospieler-Theorie als analytisches Modell zur Untersuchung legislativer Prozesse. Es wird auf verschiedene Typologien von Parteiensystemen nach Sartori eingegangen, um den Einfluss der Parteienlandschaft auf die Anzahl der Vetospieler zu erläutern. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende empirische Analyse dar.
Allgemeine Begriffe: In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe wie "unitarisch", "föderalistisch", "Gebietskörperschaften" und "Gliedstaaten" definiert und verschiedene Formen des Föderalismus (kooperativer und wettbewerbsorientierter Föderalismus) unterschieden. Dies bildet die Grundlage für das Verständnis der strukturellen Unterschiede zwischen den deutschen und französischen Regierungssystemen.
Regierungssystem in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert das deutsche Regierungssystem sowohl aus verfassungssystematischer Sicht als auch unter Anwendung des Vetospieler-Ansatzes. Es beschreibt die föderale Struktur und die daraus resultierenden Machtbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Im Kontext des Vetospieler-Ansatzes werden die verschiedenen Akteure mit Vetorechten identifiziert und ihre Bedeutung für den legislativen Prozess erläutert. Die Analyse betrachtet die institutionellen und situativen Vetospieler im deutschen Kontext.
Regierungssystem in Frankreich: Ähnlich dem vorherigen Kapitel, wird hier das französische Regierungssystem aus verfassungssystematischer und vetospielertheoretischer Perspektive untersucht. Der Fokus liegt auf der unitarischen Struktur und den daraus resultierenden Auswirkungen auf den legislativen Prozess. Die Identifizierung und Analyse der Vetospieler im französischen System sowie deren Bedeutung für die Policy-Stabilität werden behandelt. Der Vergleich mit dem deutschen System wird vorbereitet.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Unitarismus, Vetospieler-Ansatz, Legislativer Status quo, Regierungssystem, Deutschland, Frankreich, Policy-Stabilität, Verfassungssystematik, Parteiensystem, Gliedstaaten, Gebietskörperschaften.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Vergleich der Regierungssysteme Deutschlands und Frankreichs anhand des Vetospieler-Ansatzes
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Regierungssysteme Deutschlands und Frankreichs unter Anwendung der Vetospieler-Theorie. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen der föderalen (Deutschland) bzw. unitarischen (Frankreich) Staatsstrukturen auf den legislativen Konsens.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob und wie die Staatsstruktur die Anwendung des Vetospieler-Ansatzes beeinflusst. Sie analysiert die Rolle der Eigenständigkeit von Gliedstaaten/Gebietskörperschaften, den Einfluss ihrer Anzahl und weiterer Faktoren auf den legislativen Prozess. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Vergleich der Systeme aus verfassungssystematischer Perspektive und der Anwendung der Vetospieler-Theorie auf beide.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Definitionen zentraler Begriffe, ein Kapitel zu den Forschungsansätzen, ein Kapitel mit allgemeinen Begriffen, Kapitel zur Analyse der Regierungssysteme Deutschlands und Frankreichs (jeweils aus verfassungssystematischer und vetospielertheoretischer Sicht), einen direkten Vergleich der Systeme mit dem Vetospieler-Ansatz, ein Fazit und schließlich ein Literaturverzeichnis.
Wie werden die Regierungssysteme analysiert?
Die Analyse der Regierungssysteme erfolgt sowohl aus verfassungssystematischer Sicht (Betrachtung der föderalen/unitarischen Strukturen) als auch unter Anwendung des Vetospieler-Ansatzes. Dabei werden die verschiedenen Akteure mit Vetorechten identifiziert und ihre Bedeutung für den legislativen Prozess erläutert. Es wird untersucht, welche institutionellen und situativen Vetospieler existieren und wie sie die Policy-Stabilität beeinflussen.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit verwendet?
Zentrale Begriffe sind Föderalismus, Unitarismus, Vetospieler-Ansatz, Legislativer Status quo, Policy-Stabilität, Verfassungssystematik, Parteiensystem, Gliedstaaten, Gebietskörperschaften, sowie Konzepte der Vetospieler-Theorie wie Policy-Stabilität, institutionelle und situative Vetospieler und Winset.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Eigenständigkeit von Gliedstaaten/Gebietskörperschaften auf den legislativen Status quo, den Einfluss der Anzahl von Gliedstaaten/Gebietskörperschaften auf den Vetospieler-Ansatz und deren jeweilige Positionen, sowie den Einfluss weiterer Faktoren auf den legislativen Prozess. Im Kern geht es um den Vergleich der deutschen und französischen Regierungssysteme unter Anwendung der Vetospieler-Theorie.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt die Verfassungssystematik zur Beschreibung der politischen Systeme und die Vetospieler-Theorie als analytisches Modell zur Untersuchung legislativer Prozesse. Es wird auf Typologien von Parteiensystemen nach Sartori eingegangen, um den Einfluss der Parteienlandschaft auf die Anzahl der Vetospieler zu erläutern.
Wie werden Föderalismus und Unitarismus in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit unterscheidet klar zwischen unitarischen und föderalen Systemen und analysiert die Auswirkungen dieser Staatsstrukturen auf die Anzahl und die Rolle der Vetospieler im legislativen Prozess. Verschiedene Formen des Föderalismus (kooperativer und wettbewerbsorientierter Föderalismus) werden unterschieden.
- Citar trabajo
- Kay Milbert (Autor), 2007, Unitarische und föderale Regierungssysteme und ihre Auswirkung auf den legislativen Status quo an den Beispielen Frankreich und Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136519