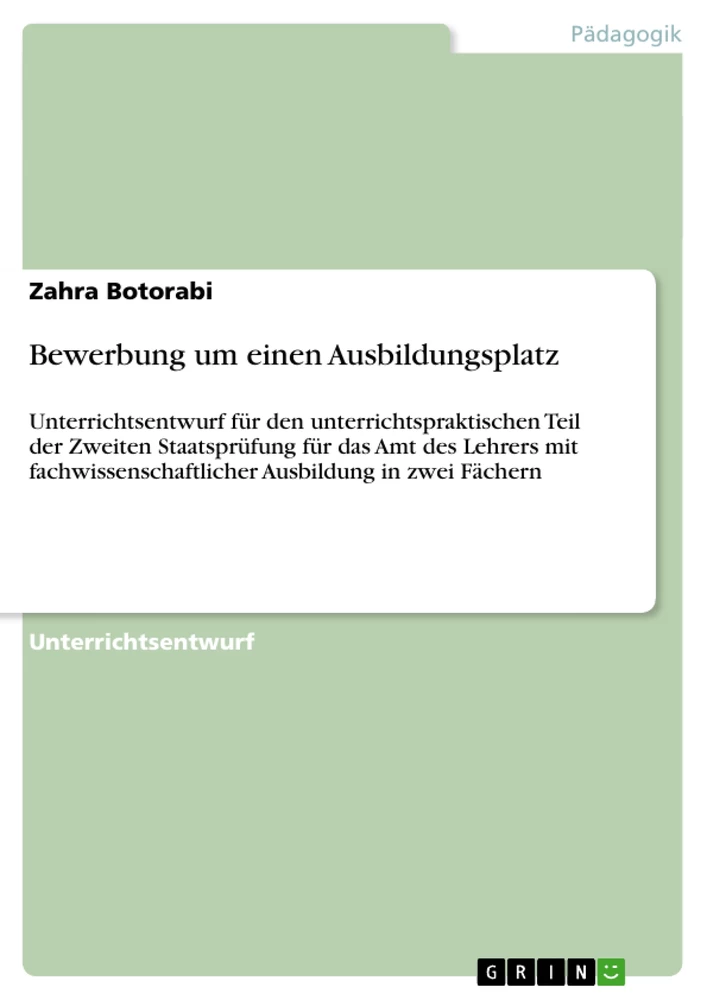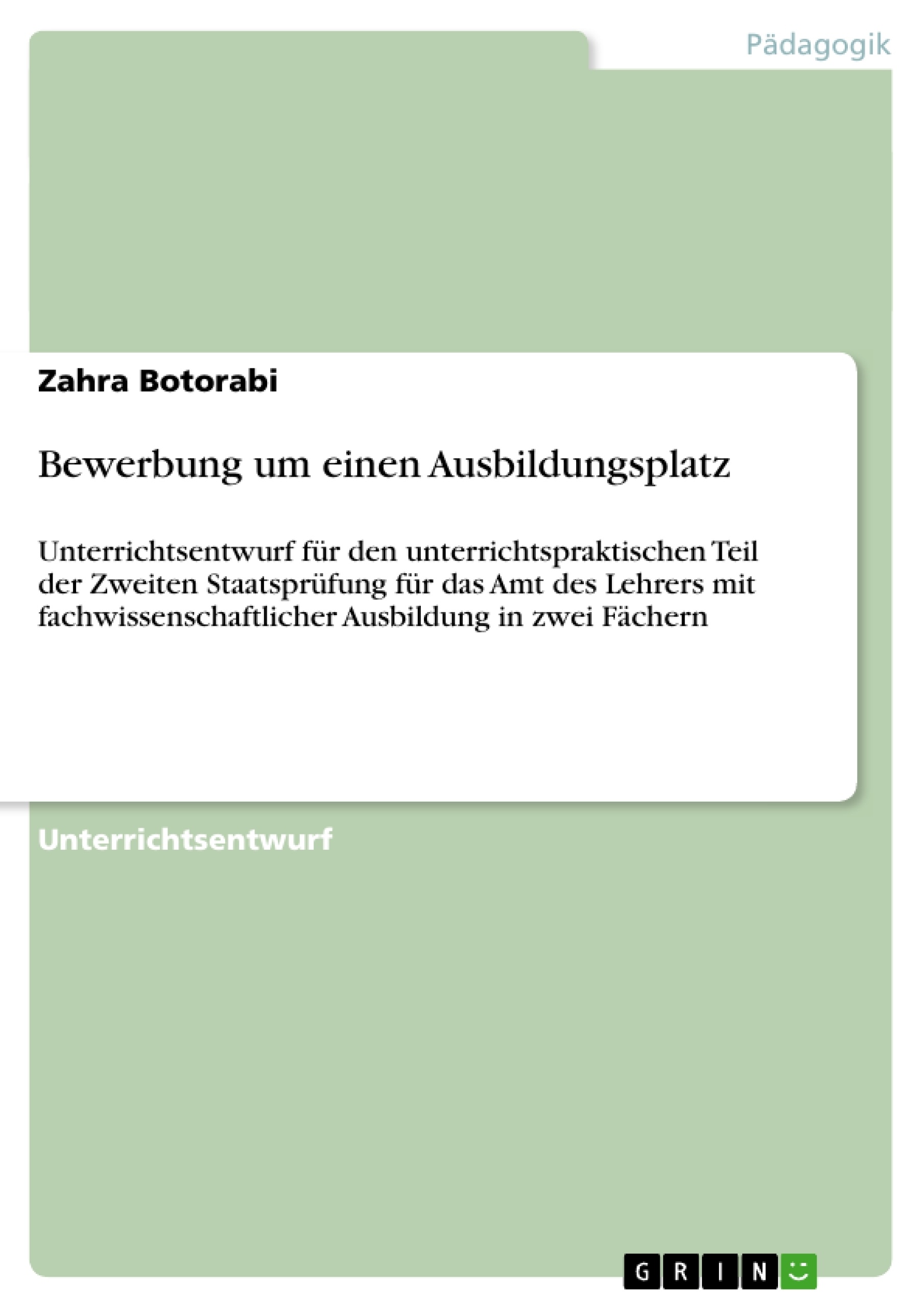Die heutige Jugend hat es besonders schwer, eine erfolgversprechende Zukunftsperspektive aufzubauen. Der Ausbildungsplatzmangel und der Verdrängungswettbewerb stellen ernstzunehmende Probleme für die berufliche Orientierung der Jugendlichen dar.Ein Beweis dafür ist vor allem die sehr hohe Quote der Jugendarbeitslosigkeit, besonders in Berlin. Vielen Schülern ist diese Sorge geradezu anzusehen.Die Sorge zeigt sich vor allem in resignierter Grundeinstellung der Jugendlichen oder im Desinteresse an der beruflichen Zukunft und allgemein psychosozialen Belastungen.Andere hingegen bauen illusionäre Vorstellungen auf und müssen zunächst lernen, ihre Vorstellungen an der Realität zu überprüfen.Nur ein gestärktes Selbstbild und eine hohe Reflexionsfähigkeit können helfen, sich dem Bewerbungsprozess immer wieder stellen zu können.Aufgabe der Schule ist es, die Schüler durch die Förderung der Handlungskompetenz auf das Leben außerhalb der Schule vorzubereiten. Für den Berufs- und Bildungsorientierungsunterricht im 9.Jahrgang bedeutet das die gezielte Vorbereitung für den Prozess der Bewerbung.Dabei ist es besonders wichtig, die personale und soziale Kompetenz sowie die Methodenkompetenz neben der Sachkompetenz verstärkt zu fördern. Die Schüler müssen in der Lage sein, beratende Institutionen und Medien selbständig heranzuziehen.Darüber hinaus müssen sie Problemlösestrategien entwickeln und sich selbst beratend zur Seite stehen.
Die Unterrichtseinheit mündet in der Fertigstellung eines Hinweiskatalogs zur Überprüfung der Bewerbungsunterlagen.
Zur Fertigstellung dieses Hinweiskatalogs werden den Schülern vorab fünf Fallbeispiele von jugendlichen Bewerbern präsentiert. Jeder Jugendliche in den Fallbeispielen hat trotz häufiger Bewerbung um einen Ausbildungsplatz stets Misserfolge.Die Bewerbungsunterlagen der Fallbeispiele wurden von mir aus fünf Berufsfeldern fehlerhaft zusammengestellt.
Die Schüler sollen in Gruppenarbeit die Unterlagen analysieren.Zu untersuchen ist der gesamte Bewerbungsprozess, von der Ausbildungsstellensuche bis hin zum Versand der Bewerbungsunterlagen.Auch das Verhalten der Jugendlichen in den Fallbeispielen zeigt Fehler auf und muss von den Schülern erkannt werden. Schließlich soll ein Beratungsgespräch im Rollenspiel simuliert werden.Auch hierbei wird im Anschluss mit dem Publikum die Reflexionsfähigkeit der Schüler geförderet.Sämtliche Ergebnisse werden nach jedem Rollenspiel in einem Hinweiskatalog festgehalten und reflektiert.
Im Folgenden wird für die Schülerinnen und Schüler der allgemeine Begriff die Schüler verwendet.
1. Unterrichtseinheit: Bewerbung um einen Ausbildungsplatz
1. Ausbildungsplatzsuche
- Öffentlich zugängliche Informationsquellen (sachgerechtes Lesen von Angeboten)
- Nutzung von Jobbörsen im Internet
2. Die schriftliche Bewerbungsmappe
- Vorbereitung eines Lebenslaufs und Bewerbungsschreibens (sachgerechte und
ansprechende Gestaltung am PC)
- Wichtiges beim Versand der Bewerbungsmappe
- Präsentation ausgewählter Bewerbungsmappen
3. Vorbereitung eines Hinweiskatalogs zur Überprüfung der Bewerbungsunterlagen für die Homepage der Schule
- Fallbeispiele zu missglückten Bewerbungen (Misserfolg durch inhaltliche und formale Fehler sowie persönliche Einstellungen)
- Vorbereitung eines Beratungsgesprächs durch die Schüler
- Rollenspiele: Beratungsgespräch mit den Bewerbern (Korrektur der inhaltlichen und formalen Fehler sowie Tipps für die persönliche Einstellung)
- Fertigstellung eines Hinweiskatalogs zur Überprüfung der Bewerbungsunterlagen
4. Alternative Bewerbungen: Onlinebewerbung
5. Alternative Bewerbungen: Telefonbewerbung
2. Thema der Unterrichtsstunde
Fertigstellung eines Hinweiskatalogs zur Überprüfung der Bewerbungsunterlagen
3. Kompetenzen und Standards
3.1 Kompetenzbezug des Rahmenlehrplans:
Die Schüler/innen…
…nutzen und beurteilen Informations- und Beratungsmöglichkeiten für die berufliche Vorbereitung, darunter auch elektronische Medien.
…gestalten ihre Bewerbungsunterlagen anforderungsgerecht.
…treffen eine begründete Entscheidung für die Wahl der weiteren persönlichen Bildung oder Ausbildung und führen notwendige Schritte zur Umsetzung aus.
(RLP, Seite 14)
…gestalten individuelle Bewerbungsunterlagen nach inhaltlichen und formalen
Gesichtspunkten und organisieren selbständig den Bewerbungsvorgang.
…gehen mit Frustration möglichst selbstbewusst um.
…sind bereit, Maßnahmen zur Überwindung von Schwächen einzuleiten.
…kennen ihre Stärken und berufliche Alternativen und lassen sich nicht entmutigen.
(RLP, Seite 25)
3.2 Angestrebte längerfristige Kompetenzentwicklung:
Die Schüler kennen verschiedene Möglichkeiten der Ausbildungsplatzsuche sowie aktuelle Bewerbungsvorgänge und sind in der Lage, individuelle Bewerbungsunterlagen sachgerecht nach inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten zu gestalten und zu überprüfen.
3.3 Konkretisierung der Standards für die Stunde:
Die Schüler sind in der Lage, häufig auftretende Fehler beim Bewerbungsprozess durch Rollenspiele selbständig zu erschließen und adressatenorientiert aus einem erarbeiteten Hinweiskatalog in appellative Sätze zu formulieren.
4. Lerngruppe
Ich unterrichte seit Beginn des Schuljahres 2008/09 die 9.11 im Pflichtbereich Arbeitslehre (Berufs- und Bildungsorientierung). Die Stundentafel der X-Y-Oberschule schreibt diesem Fach im 9. Jahrgang zwei Schulstunden die Woche zu.
Die Lerngruppe besteht aus 29 Schülern. Von diesen 29 Schülern sind 13 weiblich und 16 männlich. 22 Schüler habe ich bereits im letzten Schuljahr unterrichtet. Aus diesem Grund kennt der Großteil der Klasse Methoden des offenen Unterrichts. Während die Einführung dieser Methoden im 8. Jahrgang noch kraftaufwändig war, arbeiten die Schüler nun in der 9. Klasse äußerst effektiv innerhalb verschiedener Methoden.
Allgemein herrscht eine angenehme Lernatmosphäre. Die Schüler haben verstanden, dass ihre berufliche Zukunft im Fokus unserer Arbeit steht. Folglich sind sie größtenteils motiviert und ehrgeizig. Dies zeigt sich auch dadurch, dass einige Schüler sich in den Osterferien um einen freiwilligen Praktikumsplatz bemüht haben. Auch die Durchführung und Auswertung des Betriebpraktikums zeigten mir, dass die Schüler inzwischen selbständig reflektieren können. Sie sind in der Lage, eigene berufliche Vorstellungen an der Realität zu überprüfen und wichtige Erkenntnisse für spätere Entscheidungen zu formulieren. Obwohl sich die Klasse in ihrem Leistungsniveau sehr heterogen zusammensetzt, ist insgesamt festzustellen, dass alle Schüler immer selbständiger werden.
An einigen Beispielen wird im Folgenden das Verhalten einiger Schüler problematisiert:
Oskar und Daniel neigen dazu, den Unterricht zu stören. Ihnen fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Ich muss sie häufig ermahnen. Während Oskar erst nach mehrmaliger Aufforderung beginnt, schriftliche Aufgaben zu erfüllen, neigt Daniel dazu, diese nur oberflächlich und flüchtig zu erledigen. Beide Schüler sind jedoch sehr kreativ.
Benjamin, Alexander und Sören wiederholen den 9. Jahrgang und zeigen ein schuldistanziertes Verhalten. Trotz mehrerer Gespräche erscheinen sie unregelmäßig im Unterricht. Benjamin und Alexander zeigen sich trotzdem motiviert im Unterricht. Sören hingegen ist sehr introvertiert und fühlt sich sichtlich nicht wohl, wenn ich mit ihm ein Gespräch suche.
Nathalie versäumt seit einiger Zeit unentschuldigt den Unterricht. Im Gespräch wurde deutlich, dass sie familiäre Probleme hat. Sie wirkt im Unterricht manchmal abwesend und traurig. Ich versuche, mit ihr regelmäßig Gespräche zu führen. Die Tutoren der Klasse kümmern sich um weitere Maßnahmen.
An einigen Beispielen wird im Folgenden das Verhalten einiger Schüler hervorgehoben:
Franz, Dominik Z. und Jonas sind sehr interessierte und ehrgeizige Schüler. Sie sind in der Lage, schriftliche und mündliche Aufgaben in besonderem Maße zu erfüllen.
Jonas zeigt darüber hinaus eine sehr stark ausgeprägte soziale Kompetenz. Er unterstützt seine Mitschüler zu jeder Zeit und mit einem hohen Empathievermögen.
Dominik Z. ist sehr leistungsorientiert. Obwohl er die Anforderungen erfüllt, muss ich ihn auf soziale Prozesse stets aufmerksam machen. Die Probleme von Außenseitern und Schülern aus sozial schwachen Familien interessieren ihn nicht. Er diskriminiert diese zwar nicht, ist aber nicht bereit sich sozial einzusetzen.
Franz ist ein sehr wissensdurstiger und intelligenter Junge. Sein Allgemeinwissen und seine Fähigkeiten im Bereich Computertechnik sind sehr stark ausgeprägt. Obwohl er eine Bereicherung für den Unterricht ist, muss ich zeitweise darauf aufpassen, dass er sich den anderen gegenüber nicht überheblich verhält. Um ihn nicht zu unterfordern, gebe ich ihm manchmal zusätzliche Aufgaben. Im Computerraum übernimmt er häufig die Expertenrolle.
Stephanie zeigt eine sehr hohe Selbständigkeit. Sie ist stets bemüht, sämtliche Aufgaben in besonderem Maße zu erfüllen. Auch versäumte Inhalte holt sie selbständig nach und legt sie mir vor.
Insgesamt macht uns der gemeinsame Unterricht viel Spaß.
4.1 Stand der Lerngruppe
Fachlich: Die Schüler sind die folgenden wichtigen Schritte des Bewerbungsprozesses durchlaufen:
- Sie können Ausbildungsstellangebote sachgerecht suchen und lesen und für ihre Unterlagen verwenden.
- Formale und inhaltliche Kriterien der Bewerbungsunterlagen sind ihnen bekannt.
- Sie haben jeweils eine individuelle Bewerbungsmappe erstellt und wissen um die zu beachtenden Faktoren beim Versand der Mappe.
Zum Bewerbungsprozess gehört auch die abschließende Überprüfung der Bewerbungsunterlagen: Vier Gruppen haben in den vorherigen Stunden die auffindbaren Fehler in den Fallbeispielen gefunden und ihr geplantes Rollenspiel gezeigt. Die Ergebnisse dieser Gruppen wurden in einer strukturierten Tabelle festgehalten (siehe Foto vom Tafelbild im Anhang).
Methodisch: Die Schüler haben bereits zu unterschiedlichen Fallbeispielen (z.B. Probleme beim Betriebspraktikum) in Gruppenarbeit Rollenspiele vorbereitet, gespielt und reflektiert. Für die Vorbereitung der Rollenspiele kann ich der Lerngruppe zutrauen, in zwei Räumen zu arbeiten. Die Schüler zeigen sich verantwortungsbewusst und sehr selbständig.
4.2. Niveaustufen
Maximalstandard:
Schüler X wird die Anforderungen der Unterrichtsstunde, häufig auftretende Fehler beim Bewerbungsprozess durch Rollenspiele selbständig auszuarbeiten und adressatenorientiert in einem Hinweiskatalog in appellative Sätze zu formulieren, mit großem Erfolg meistern. Er wird seine Gruppenmitglieder unterstützen. Die appellativen Formulierungen der Hinweise werden ihm mühelos gelingen.
Regelstandard:
Schüler Y wird die Anforderungen der Unterrichtsstunde mit Erfolg meistern. Er wird bei der Gruppenarbeit aktiv mitarbeiten. Die appellativen Formulierungen der Hinweise werden ihm mit Hilfestellung seiner Gruppenmitglieder gelingen.
Minimalstandard:
Schüler Z wird die Anforderungen der Unterrichtsstunde meistern. Er wird sich in der Gruppenarbeit eher zurückhalten. Für die Ausformulierung der Hinweise wird er die als Hilfestellung zur Verfügung gestellten Satzanfänge heranziehen.
5. Fachlich - inhaltlicher Schwerpunkt
In der 3. Sequenz der Unterrichtseinheit liegt der Schwerpunkt in der Fertigstellung eines Hinweiskatalogs zur Überprüfung der Bewerbungsunterlagen. Der Hinweiskatalog wird auf der Homepage der Schule (www.csoonline.de / Fach Arbeitslehre, Pflichtbereich, 9. Jahrgang) veröffentlicht.
Zur Fertigstellung dieses Hinweiskatalogs werden den Schülern vorab fünf Fallbeispiele von jugendlichen Bewerbern präsentiert. Jeder Jugendliche in den Fallbeispielen hat trotz häufiger Bewerbung um einen Ausbildungsplatz stets Misserfolge. Die Bewerbungsunterlagen der Fallbeispiele wurden von mir aus fünf Berufsfeldern fehlerhaft zusammengestellt. Die Berufsfelder beziehen sich auf die Berufswünsche der Lerngruppe.
Die Schüler sollen in Gruppenarbeit (5 Gruppen) analysieren, warum die Bewerber bislang keinen Erfolg hatten. Zu untersuchen ist demnach der gesamte Bewerbungsprozess, von der Ausbildungsstellensuche bis hin zum Versand der Bewerbungsunterlagen. Auch das Verhalten der Jugendliche in den Fallbeispielen zeigt Fehler auf und muss von den Schülern erkannt werden. Die Schüler sollen in den Bewerbungsunterlagen formale und inhaltliche Fehler ausfindig machen, unterscheiden und auf Wortkarten festhalten. Schließlich simulieren sie in einem Rollenspiel ein Beratungsgespräch. Jede Gruppe stellt einen ausgewählten Freundeskreis des Jugendlichen dar, der ihm nun beratend zur Seite steht. Dabei geben die Schüler auch persönliche Tipps zur Überwindung der pessimistischen oder falschen Einstellung. Sämtliche Ergebnisse werden nach jedem Rollenspiel in einer strukturierten Tabelle stichpunktartig anhand der vorbereiteten Wortkarten festgehalten und reflektiert.
Der Schwerpunkt dieser Unterrichtsstunde liegt in der Fertigstellung des Hinweiskatalogs durch die Zusammenfassung und der vollständigen Formulierung der Ergebnisse. Die 5. Gruppe zeigt ihr geplantes Rollenspiel. Im Austausch mit dem Publikum, das anhand eines Hör- und Sehauftrages aktiv in das Geschehen einbezogen wird, werden schließlich die letzten Wortkarten mit stichpunktartigen Hinweisen der Tabelle zugeordnet (vollständige Tabelle s. Anhang). Aus den bisherigen Stichpunkten sollen die Schüler nun arbeitsteilig vollständige und appellative Sätze formulieren. Der Leser der Internetseite ist Adressat der formulierten Hinweise.
Im Folgenden wird das Rollenspiel aus fachtheoretischer Sicht untersucht und in Bezug zu dem Vorhaben gesetzt. Im Anschluss werden die Fallbeispiele und die zu findenden Fehler der Bewerbungsunterlagen kategorisiert dargestellt. Schließlich wird dargelegt, welche Funktion der Hinweiskatalog hat und welche Kriterien er erfüllen muss.
5.1. Das Rollenspiel
Die vorherrschende Methode der Arbeitslehre ist der projektorientierte Unterricht. Gleichbedeutend sind aber die Realbegegnungsverfahren (Betriebspraktikum, Betriebserkundung, Expertengesprä-che[1] ) und die Simulationsverfahren (Rollenspiel, Planspiel, Fallstudie[2] ).
Die beschriebenen Fallbeispiele sind zu unterscheiden von der Methode der Fallstudie.
Die Fallstudie ist „eine methodische Entscheidungsübung aufgrund selbständiger Gruppendiskussionen am realen Beispiel einer konkreten Situation“.[3] Sie wird im Rahmen des handlungsorientierten Unterrichts angewandt. Den Schülern wird ein konkreter, problemorientierter Fall aus der Wirtschafts- und Arbeitswelt vorgestellt. Sie sollen nach Lösungsmöglichkeiten suchen, sich für eine Lösung entscheiden und diese begründen können. Die Fallstudie soll Impulse zu eigenständigen Nachforschungen erzeugen. Der Fall sollte real, schülernah und überschaubar sein und mehrere Lösungsmöglichkeiten offenlassen, so dass im Anschluss an die Gruppenarbeit eine Diskussion zu unterschiedlichen Lösungsvarianten in Verknüpfung zu deren Realisierbarkeit geführt werden kann.[4]
Die Fallbeispiele in diesem Unterrichtsvorhaben beziehen sich zwar auf konkrete, problemorientierte Situationen, lassen jedoch nicht mehrere Lösungsvarianten offen. Sie sind vorab so konzipiert, dass bei der Nachforschung der Schüler ein geplanter Lösungskatalog entsteht. Die Fallbeispiele stellen die Ausgangssituation für die darauf folgenden Rollenspiele dar.
„Das Rollenspiel ist ein Verfahren, das in simulierter Form Situationen aus dem Alltäglichen oder Fiktiven darstellt, die entweder aus dem Erfahrungsbereich der Beteiligten stammen oder für sie erfahrungsvorbereitend sind, somit die Interaktionsfähigkeit der Beteiligten anspricht bzw. fördern soll.“[5] Gerade die vorberuflichen und beruflichen Themen des Arbeitslehreunterrichts bieten dem Rollenspiel ein geeignetes Einsatzfeld. Unterschieden werden das spontane und das angeleitete (oder gelenkte[6] ) Rollenspiel. Für das spontane Rollenspiel bieten sich konfliktreiche Situationen an, die den Schülern bekannt sind, wie z.B. Situationen in der Familie, im Freundeskreis oder in der Schule. Beim angeleiteten Rollenspiel steht das Erarbeiten und Lösen von Situationen im Vordergrund, die nicht aus dem Alltageserleben der Schüler stammen, sondern im Vorgriff auf zukünftige Situationen thematisiert werden.[7]
Die Auseinandersetzung der Lerngruppe mit den Fallbeispielen greift in zukünftige Bewerbungssituationen und kann demnach dem angeleiteten Rollenspiel zugeordnet werden.
Kaiser/Kaminski gliedern das Rollenspiel in drei Phasen: die Motivationsphase, die Aktionsphase und die Reflexionsphase. In der Motivationsphase wird die Handlungssituation vorgestellt und Spielregeln festgelegt. Anschließend werden die Spiel- und Beobachtungsrollen an die Schüler verteilt und die Schüler erhalten die Möglichkeit sich in ihre jeweilige Rolle z.B. durch Spielkarten einzuarbeiten. In der Aktionsphase wird das Spiel durchgeführt. In der Reflexionsphase beschreiben die Beobachter den Spielablauf und interpretieren diesen.[8]
Die folgende Abbildung stellt die Phasen des Rollenspiels für dieses Unterrichtsvorhaben dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2. Die Fallbeispiele
In der folgenden Tabelle werden die Fallbeispiele und die von den Schülern zu findenden Fehler dargestellt. Dabei werden die Fehler nicht als solche benannt, sondern stichpunktartige Hinweise formuliert. Die Bewerbungsunterlagen weisen z.T. die gleichen Fehler auf. In der Tabelle werden nur diejenigen aufgeführt, welche nicht mehrfach vorkommen. Das Fallbeispiel des heutigen Rollenspiels wird gekennzeichnet. Die Bewerbungsunterlagen des Fallbeispiels sind dem Anhang zu entnehmen.
[...]
[1] Vgl.: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport: Rahmenlehrplan Sekundarstufe I Arbeitslehre 2006, S. 11.
[2] Vgl.: ebd., S. 11.
[3] Zitat: Kaiser, F.-J.: Entscheidungstraining. Die Methoden der Entscheidungsfindung. Klinkhardt Verlag. Bad Heilbrunn/Odd. 1976, S. 56
[4] Vgl.: ebd., S. 56 ff.
[5] Zitat: Behrens, G.: Rollenspiel. In: Arbeiten und Lernen. Heft 10-10a. Juli/August 1980. Friedrich Verlag. Seelze, S. 73-74
[6] Vgl.: Meyer, Hilbert: Unterrichtsmethoden II: Praxisband. Berlin. Cornelsen. 1987, S. 357.
[7] Vgl.: Behrens, G.: Rollenspiel. 1980, S. 73-74
[8] Vgl.: Kaiser, F.-J./ Kaminski, H.: Methodik des Ökonomie-Unterrichts. Klinkhardt. Bad Heilbrunn.1999, S.151.
- Quote paper
- Zahra Botorabi (Author), 2009, Bewerbung um einen Ausbildungsplatz , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136501