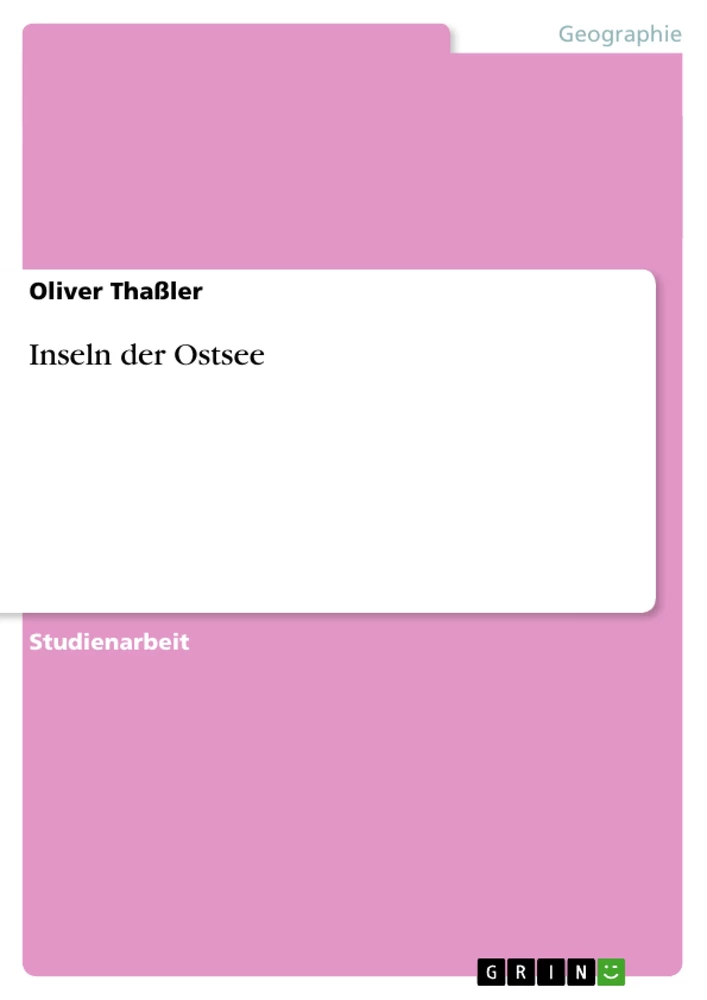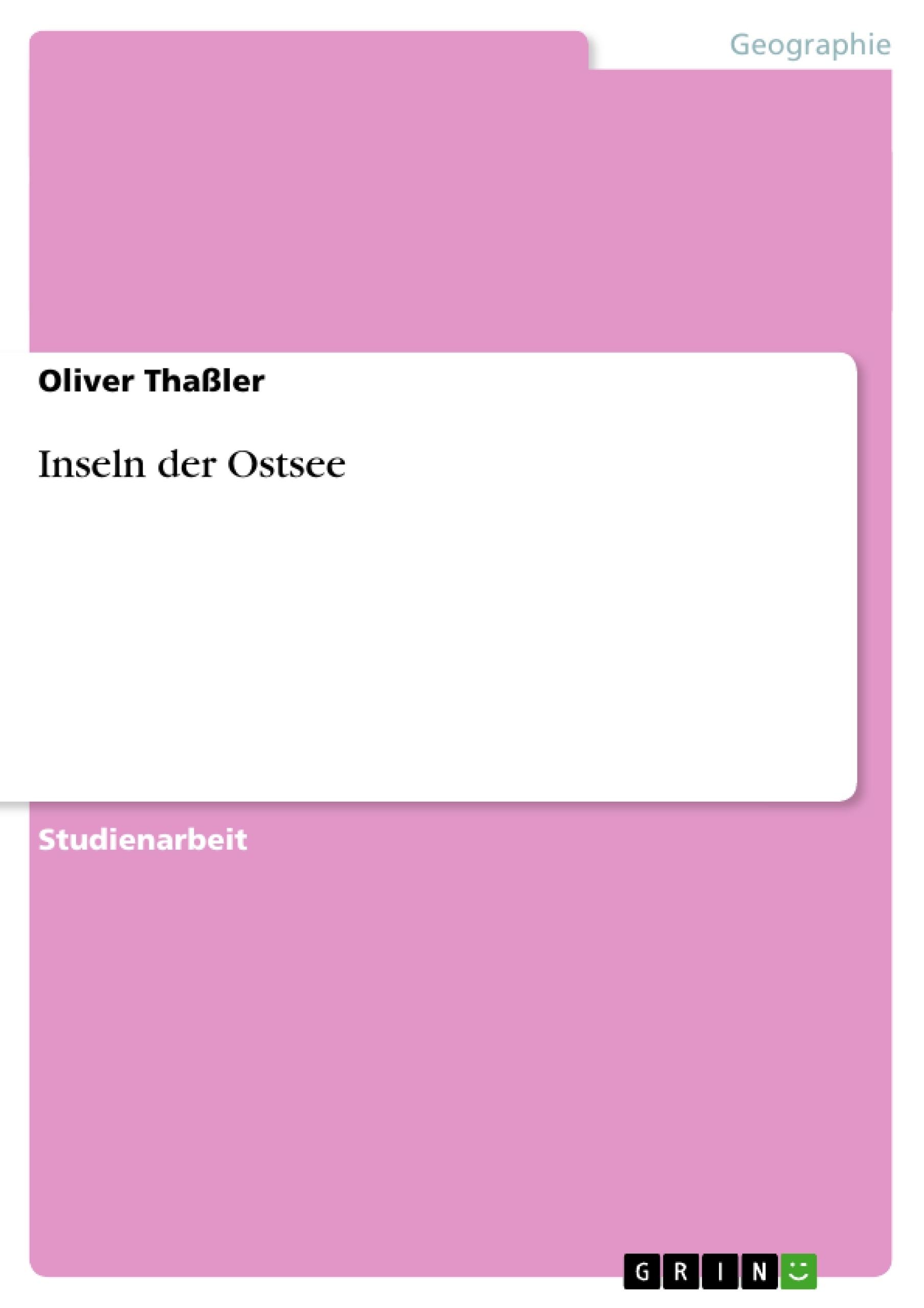Die Ostsee ist ein erst wenige Jahrtausende altes Meer und damit erdgeschichtlich sehr jung.Sie ist durch Meerengen mit der Nordsee verbunden und steht einerseits unter dem Einfluß des salzhaltigen Nordseewassers und andererseits im Regime von Süßwassern, die aus den Einzugsgebieten Skandinaviens in sie fliessen. Diese Begebenheiten machen die Ostsee mit ihren 415 000 km² zu einer der größten Brackwasserflächen der Erde. Neben der auch durch den unterschiedlichen Salzgehalt bedingten Vielfalt an Meeresorganismen stellt besonders das geologische Potenzial, auf dem die Ostsee ruht und von dem sie umgeben ist, eine enorme
Vielfalt dar. Dieses Meer liegt in der transeuropäischen Störungszone der westeuropäischen Plattform und der Osteuropäischen Plattform mit dem Baltischen Schild. Durch diverse
plattentektonische Vorgänge, die schon im Erdaltertum Altpaläozoikum) ihren Anfang fanden, grenzen heute verschiedene geologische Untergründe aneinander oder erheben sich aus der Ostsee. Diese Vielfalt zeichnen auch die Inseln des baltischen Meeres nach. Diese Studienarbeit möchte dabei landschaftsökologische Begebenheiten ausgewählter Ostseeinseln
vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
1.Geographie des Ostseeraums
1.1 Geologie
1.2 Hydro-geographische Gliederung
1.3 Küstenformen
1.4 Vegetation / Landschaftscharakter
1.5 Besiedlung / Geschichte
2.Geographie ausgewählter Ostseeinseln
Inseln der Bundesrebublik Rebublik
2.1 Rügen
2.2 Usedom
2.3 Hiddensee
2.4 Vilm
2.5 Ruden
2.6 Fehmarn
Insel Polens
2.7 Wollin
Insel Dänemarks
2.8 Møn
2.9 Langeland
2.10 Bornholm
Inseln Schwedens
2.11 Öland
2.12 Gotland
2.13 Gotska Sandön
Inseln Estlands
2.14. Saaremaa
2.15. Hiiumaa
2.16. Vilsandi
2.17 Ruhnu
Inseln Finnlands
2.18. Åland
2.19 Hailuoto
Insel der Russischen Förderation
2.20. Gogland
3. Literaturverzeichnis
4. Verwendetes Kartenmaterial
1.Geographie des Ostseeraums
1.1 Geologie
Im Ostseegebiet lassen sich zwei große Teilräume unterscheiden. Der Südwesten ist nach NIEDERMEYER (1996) der tektonisch instabilen Westeuropäischen Plattform zuzuordnen, der Norden, Osten und Südosten der präkambrischen Osteuropäischen Plattform, zu der auch der Baltische Schild als tieferer geologischer Untergrund des nördlichen und mittleren Ostseegebiets gehört.
Während der kaledonischen Gebirgsbildung im Silur wurden Gesteine auf diesen Schild aufgeschoben. Die variszische Gebirgsbildung des Jungpaläozoikums brachte tiefreichende Brüche in die Gesteinskomplexe. Im Quartär kam es aufgrund von Gletschervorstößen aus Skandinavien dann im südlichen Ostseeraum zur Überlagerung der zumeist mesozoischen Ablagerungen. Nach DUPHORN ET AL. (1995) sind Verwerfungen bis heute mobil, jedoch liegen diese neotektonischen Bewegungen der Erdkruste im jährlichen Milimeterbereich.
Die geologisch differente Basis des Ostseeraumes (Abbildung 1) spiegelt sich in den verschiedenen Gesteinen und Ablagerungen wider. Wesentliche Merkmale sind Kristallingesteine des Baltischen Schildes, die Sedimentgesteine der osteuropäischen Plattform aus dem Paläozoikum, die Sedimentgesteine der Westeuropäischen Plattform, die Kreideablagerungen und Sedimente der mitteleuropäischen Senke aus der Kreide und dem Tertiär, sowie die geologisch jungen,glazigenen Ablagerungen der Weicheleiszeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Geologische Karte der vor–eiszeitlichen Bildungen (aus: LOZAN ET AL. 1996).
1.2 Hydro-geographische Gliederung
Die Ostsee wird nach DUPHORN et. al (1995) als ein humides Nebenmeer des Atlantischen Ozeans innerhalb des europäischen Kontinents bezeichnet. Das Einzugsgebiet dieses Binnenmeeres ist nach FALKENMARK in DUPHORN ET. AL (1995) 1 721 233 km2 groß und besitzt ein Wasservolumen von 21 721 km3 bei einer mittleren Tiefe von 52,3 m (459 m max.).Der von Westen nach Osten bzw. Nordosten abnehmende Salzgehalt beträgt ca. ein Drittel der des Atlantischen Ozeans. In der Wasserbilanz der Ostsee beläuft sich der Niederschlag auf 243 km3 / a, die Verdunstung auf 209 km3 / a und die Zufuhr über die Flüsse bei 435 km3 / a. Jährlich strömen 893 km3 über die Nordsee ein, während der Ausstrom um das 1,6-fache mit 1208 km3 / a größer ist.
Neben diesen hydrologischen Verhältnissen der Ostsee finden sich aufgrund der Geomorphologie verschiedene Reliefformen auf dem Meeresboden, die als Schwellen verschiedene Becken voneinander abtrennen. Die Ostsee kann in ein Übergangsgebiet mit der Verbindung zur Nordsee, in die zentrale Ostsee und den Bottnischen Meerbusen gegliedert werden. Die geographische Differenzierung ist aus Abbildung 2 ersichtlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Geographische Gliederung der Ostsee (nach WATTENBERG 1949 / HUPFER 1984 in: DUPHORN, K. ET AL., 1995 : Die deutsche Ostseeküste).
1.3 Küstenformen
Im Ostseeraum sind nach LAMPE (1996) verschiedene Küstentypen ausgebildet. Dabei ist die Genese von verschiedenen Faktoren abhängig:
Von den topographischen , hydrogeographischen und meteorologischen Größen, die Einfluss auf marine Kräfte (Strömung, Wasserstand, Seegang) nehmen; vom voreiszeitlichen Unter-grund mit seinem Relief; der Art und Mächigkeit des skandinavischen Gletschereisvorstoßes und der damit verbundenen Mächtigkeit und Materialeigenschaft der spezifischen glazigenen Ablagerungen; vom holozänen Meeresspiegelanstieg und den isostatischen Hebungs- und Senkungsbewegungen.
Darauf aufbauend weisen LAMPE U. KLUG (1996) 12 verschiedene Küstentypen aus. Aufgrund der vielfältigen abiotischen Einflüsse sind oftmals mehrere Küstenformen auf einer Insel präsent. Abbildung 3 gibt eine Übersicht zu den im Ostseeraum vorkommenden Küstenformen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Räumliche Verteilung der Küstentypen der Ostsee (LAMPE 1995 / nach KLUG
1985 in: LOZÁN, J.L. ET AL. (1996) : Warnsignale aus der Ostsee)
1.4 Vegetation / Landschaftscharakter
Der Ostseeraum gliedert sich geobotanisch in die boreale Zone (B1-B3) im Norden und eine temperate Zone (T1-T4) im Süden. Die boreale und hemiboreale Vegetationszone kennzeichnet sich nach FREY & LÖSCH (1998) durch immergrüne Nadelwälder und Nadel-Laubmischwälder. Die temperate Vegetationszone besitzt temperate Breitlaubmischwälder. In beiden Vegetationszonen, jedoch insbesondere in den temperaten Bereichen sind die Wälder durch Ersatzvegeation überprägt. Darunter fallen insbesondere annuelle Ackerkulturen.
Die potentiell natürliche Vegetation (vgl. BOHN ET AL. 2003) ist dementsprechend der mesophytische, sommergrüne Laubwald und Nadel- Laubwald. Im zentralen Ostseegebiet finden sich zudem hygromesophytische Nadel- und Laub-Nadelwälder. Neben Stieleichen-Hainbuchenwäldern (Fehmarn, Bornholm), kommen innerhalb des Baltischen Buchwaldareals artenreiche eu- und - mesothraphente Buchen- und Buchenmischwälder (Langeland, Møn, Langeland, Rügen, Vilm), sowie artenarme, oligo-mesotraphente Buchen- und Buchenmischwälder (Usedom, Wollin) vor. In nördlicher Richtung finden sich artenarme azidophile Eichen- und Eichenmischwälder, aber auch subkontinentale Wiesensteppen und steppenartige Trockenrasen (Öland).Weiter nördlich treten hemiboreale und nemorale Kiefernwälder auf (Gotland, Öland, Ruhnu, Gogland, Hailuoto).In östlicher Richtung gibt es Restvorkommen hemiborealer Fichten- und Tannen- Fichtenwälder mit Laubbaumarten (Saaremaa, Hiiumaa, Åland).
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass der Landschaftscharakter der Inseln vielerorts durch Wald bestimmt war, der insbesondere mit Beginn des 20. Jh. in forstwirtschaftliche oder ackerbauliche Kulturen überführt wurde. Insbesondere die Landwirtschaft führte zu einer Homogenisierung des Landschaftsbildes mit Verlust an Kleinstrukturen (Feldsäume, Hecken, temporäre Gewässer. etc.). Betrachtet man den Ostseeraum unter dem Aspekt anthropogener Ersatzvegetation zeigen sich ein Gradient in west-östlicher Richtung und ein größerer Anteil natürlicher Vegetation in den östlichen, baltischen Staaten. Dabei nimmt der Grad der Hemerobie in südwestlicher Richtung zu (vgl. KNAPP, H. D.; L. JESCHKE & M. SUCCOW 1985).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Heutige natürliche Vegetation Mitteleuropas
(aus LANG 1994 in FREY u. LÖSCH 1998)
1.5 Besiedlung / Geschichte
Die ersten Spuren menschlicher Tätigkeit im Ostseeraum gehen nach WERNICKE (1996) auf die Zeit 8000 v.Chr. zurück. Von einer Besiedlung kann aber erst ab dem 5. Jahrtausend v.Chr.ausgegangen werden. Die mesolithische Ertebölle- Kultur in Dänemark und an der holsteinisch- mecklenburgisch pommerschen Küste sind Beispiele dafür. Gesellschaftliche Einschnitte waren vor allem die Veränderungen der Jäger- und Sammlerkulturen zu Ackbau-und Viehzuchtgesellschaften vor ca. 3000 v. Chr. In der Folgezeit kam es durch Einwanderungen aus dem osteuropäischen Raum zur Ausbildung verschiedener Kulturen wie z.B. der neolithischen Trichterbecherkultur oder der spätneolithischen Einzelgrabkultur auf Rügen (2000 J. v.Chr.). Landschaftlich relevant war insbesondere der Übergang von Jäger-Sammlerkulturen zu sesshaft werdenden und Ackerbau betreibenden Kulturen mit Beginn der Jungstein (Neolitische Revolution). Die Neolithische Revolution markiert den Übergang von Naturlandschaften zu Kulturlandschaften und den Beginn der Kulturlandschaftentwicklung mit der Rodung von Wäldern für Siedlungen und Felder, der Entwässerung von Feuchtgebieten, wie auch die durch Pollenanalysen nachgewiesenen Florenveränderungen (Gräser- und Kulturpflanzenausbreitung) der Landschaft (KNAPP 2008). In Abbildung 5 wird die Besiedlungsgeschichte mit der Landschaftsgeschichte und der Ostseeentwicklung korreliert
Mit dem Beginn der Bronzezeit um 1800 v.Chr. werden Handelsbeziehungen nach Britannien, in den Donauraum und zum Schwarzen Meer aufgenommen. Die Besiedlung des Ostseeraums durch germanische Stämmme fällt in die Eisenzeit (500 v.Chr.). Danach folgte die römische Kaiserzeit und die Völkerwanderungszeit, die bis 700 n.Chr. anhielt. Die Vormachtstellung im Ostseeraum wurde im 9. und 10. Jh. durch Wikinger behauptet, die neben ihren Raubzügen einen regen Handel betrieben. Die Dänen waren im 12. / 13. Jh. die dominante Macht in der Ostsee, bis es der Hanse im 14. Jh. bis ins 16. Jh. gelang den Handel der Ostseeküsten und der Inseln unter ihre Kontrolle zu bringen (VARJO U. TIETZE 1987).
Eine über 100 jährige Vorherrschaft der Schweden prägte das Balticum bis in den südlichen Ostseeraum, der im 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20 Jh. erst im Besitz Preußens und später des Deutschen Reiches war. Der zweite Weltkrieg brachte die politische Spaltung und Segregation der einzelnen Ostseeräume. Erst das Ende des Kalten Krieges und die Annäherungen der Jahre 89 / 90, der Zerfall der UDSSR, die Erweiterungen der NATO und internationale Wirtschaftsabkommen, auch im Rahmen der EU- Erweiterung, lassen den Ostseeraum zumindest wirtschaftlich wieder stärker kooperieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.Geographie ausgewählter Ostseeinseln
2.1.Rügen (Größe und Lage: 956 km2/ Arkonasee)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Foto: Rolf Reinecke
2.1.1.Geologische Entwicklung
Rügen liegt auf der Westeuropäischen Platte, die voreiszeitlichen Bildungen gehen auf die Kreide des Mesozoikums zurück. Die weitere geologische Entwicklung fand im Pleistozän des Quartärs (Känozoikum) und im Holozän statt. Die Geschehnisse der letzten Eiszeit, der Weiseleiszeit, sind maßgeblich für die Entstehung und Geomorphologie Rügens verantwortlich (DUPHORN ET AL.1995).
Wie BAHLS ET AL. (1990) herausarbeiteten, kam es ca. 13 000 Jahre vor heute zu letzten Eisvorstößen aus dem skandinavischen Ostseeraum. Rügen existierte in seiner heutigen Form noch nicht, sondern war eiszeitliches Moränenland mit Stauchendmoränen und Gletschzungenbecken. Mit dem Abtauen der Gletscher bildete sich vor etwa 11 000 Jahren v.h. der Baltische Eisstausee aus den Schmelzwassern. Dieser war zuerst nicht an den heutigen Atlantischen Ozean angebunden. Erst der Rückgang der Vergletscherung Mittelschwedens ermöglichte der Nordsee das Einströmen in den Baltischen Eisstausee. Das dadurch entstandende Yoldia- Meer blieb aber nur ca. 1000 Jahre erhalten, denn aufgrund einer noch bis die heutige Zeit anhaltenden Landhebung kam es zur Unterbrechung der Yoldia- Meeranbindung zur Nordsee. Es kam in Folge zur Aussüßung des Yoldia – Meeres, das fortan als Ancylus- See (9000 bis 7500 Jahren v.h.) bezeichnet wurde. Erst vor 7500 Jahren brachte ein Salzwassereinbruch aufgrund eines phasenhaften Anstiegs des Weltmeeres die Ausbildung des Litorina- Meeres hervor.
Die Entwicklung zu Inselarchipelen, Kliffbildungen und starker submariner Sedimentation vollzog sich während der ersten litorinen Transgressionshauptphase vor 7000 – 5700 Jahren als das südbaltische Festland durch den Meeresspiegelanstieg aufgelöst wurde.In der litorinazeitlichen Ostsee gab es 6000 Jahre v.h. die Inselkerne Rügen, Granitz, Wittow, Jasmund, Mönchgut, Groß Zicker und Thissow.In der hochlitorinen Regression zwischen 5700 und 5400 Jahren v.h kam es dann zum Beginn der Nehrungsbildung bei einem weiteren Anstieg des Meeres bis zum vergleichbaren heutigen Niveau (RHEINHEIMER 1995).
Die zweite litorine Transgressionshauptphase (5400 – 3900 v.h.), die spätlitorine Regression (3900- 2900 v.h.) und die dritte litorine Transgressionshauptphase (2900- 2000 v.h.) brachte intensive Küstenausgleichsprozesse mit der Bildung von Kliffen, Haken und Nehrungen in dem als Lymnaeameer bezeichneten Lebensraum. Die nun sich durch holozäne Sedimente, Dünensande und Seesande verbundenen Inselkerne wurden zur Insel Rügen.
Nach Durchlaufen einer Stillstandsphase (2000-1500 Jahre v.h.) und einer postlitorinen Transgression (1500 – 800 Jahre v.h.) begann mit 500 Jahren v.h. die Neuzeit, in der das sogenannte Mya- Meer schon die heutige Ostsee darstellte (vgl. DUPHORN ET AL.1995).
Folgt man den Untersuchungen von LANGE ET AL. (1986) lassen sich die differenzierten Landschaften und Böden Rügens zu gewissen Grundeinheiten zusammenfassen. Es herrschen vor allem Geschiebelehm und Mergelablagerungen der End und Grundmoränen vor. Die Endmoränenbögen ziehen sich vom Nordwesten der Insel bis in den Südosten. Vergesellschaftet ist dieser Geschiebelehm mit pleistozänen Sanddecken und Sanden, die sich in der Mitte Rügens und im Südosten konzentrieren, während im Nordosten anstehende Kreideablagerungen zu finden sind. An den Ostküsten finden sich, die einzelnen Moränenkerne verbindend holozäne Seesandnehrungen und Dünen aus Seesand. Moor und Anmoorbildungen sind hauptsächlich im Norden der Insel präsent.
2.1.2. Vegetation und Landschaftscharakter
Rügen liegt im Baltischen Buchenwaldareal in der temperaten Vegetationszone Europas.Rügens Küsten besitzen inseleinwärts Bodden (Flachwasserbereiche) und haben Außenküsten, die von lehmigen und steinigen Steilküsten, über Kreideküsten zu flachen Sandküsten reichen. 15 % der Fläche Rügens ist bewaldet, während 61 % der Flächen durch Landwirtschaft geprägt sind. Insgesamt können nach KNAPP (2008) sieben verschiedene Naturraumtypen auf Rügen festgestellt werden:
- Dazu zählen die ebenen- flachwelligen Grundmoränenlandschaften mit grundwasserbestimmten Lehmstandorten und einer Vegetation von Äckern, Wirtschaftsgrünland, Hochstaudenfluren, Röhrichten, sowie Großseggenriede und Moorgehölze.
- Die kuppigen Grund- und Endmoränenlandschaften mit Tieflehm und Lehmstandorten in Form von Fahlerden und Lehmsandbraunerden mit einer Vegetation von Äckern, kleiner Restwälder und Grünland. An den Steilufern finden sich Pionierfluren, Magerrasen und Gebüsche.
- Die kleinformenreiche Sandlandschaften, die in Form grundwasserferner Standorte Sand- Rosterden und Braunerden ausgebildet haben und neben Lehm–und Sandäckern auch Feldgehölze, Hutungen und Kiefernwälder aufweisen.
- Die hügeligen Endmoränenlandschaften mit Rendzinen und Lehmfahlerden in Kuppenlagen und Lehm-Parabraunerden in Tallagen. Die Vegetation wird größtenteils von Perlgras- Buchenwälder, Eichen- Hainbuchenwäldern und Erlen-Eschenwälder eingenommen. In den Senken finden sich neben Wollgrasbulten und Torfmoos-Seggenrieden auch Birken- Moorgehölze.
- Die im Nordosten zu findenden Kreidelandschaften mit Kreide- und Bergrendzinen , sowie Fahlerden in Kuppenlagen. In Kesseln finden sich Moore und in den Tallagen Lehm und Muldengleye, sowie Parabraunerden. Die auf diesen Standorten anzutreffende Vegetation ist stark differenziert wird aber hauptsächlich durch Schattenblumen-Buchenwälder bestimmt. Auch kommen Schwalbenwurz– Eichentrockenwäder, Halbtrockenrasen und Schlehentrockengebüsche vor. In den Kesselmooren kommen Torfmoos-Seggenriede, Torfmoos-Wollgrasbulte und Birken-Moorgehölze vor.
- Die Seesand- und Küstendünenlandschaften mit Grundwasserstandorten in ihrer Ausprägung als Gleye und grundwasserfernen Sandstandorten mit Braunerden und Podsolen. In Überflutungsgebieten kommt es zur Ausbildung von Mooren. Die Vegetation ist durch Strandhaferdünen, Calluna- Heiden, Kiefernwälder, Kiefern-Moorgehölzen, Sandmagerrasen, Rohrschwingelgrasfluren, Salzröhrichte und Salzwiesen beschrieben.
- Als siebter Naturraumtyp gelten die Niederungslandschaften, wo es zu Moorbildungen kommt. Diese Flächen sind größtenteils zu Wirtschaftsgrünland umgewandelt, an Seeufern und Torfstichen gibt es noch Röhrichte, Großseggensümpfe, Weiden – und Moorgebüsche, sowie Erlenwälder.
2.1.3. Landschaftsprägende Kulturdenkmäler
(nach LOEBE 1910, OHLE & BAIER 1997, PIECHOCKI 1999, BAHLS ET AL. 1990, KNAPP 2008, ABTS 1998)
Jagdschloss Granitz (Schloss in neugotischen Stil des frühen 19. Jh.), Friedrich- Wilhelm – Badehaus in der Goor bei Lauterbach (klassizistisches Gebäude von 1818), Ernst- Moritz – Arndt Museum, Putbuser Theater (Residenztheater aus den Jahren 1819 / 21), Circus/ Marstall (klassizistische Bauanlage die zwischen 1828 und 1845 errichtet wurde) und Schlosspark von Putbus (Landschaftspark mit seltenen Gehölzen und klassizistischen Gebäuden), Marienkirche (älteste Kirche Rügens aus dem 12. Jh.) und Zisterzienserklosterhof in Bergen (Anfang 18. Jh.), Schlossanlage Spyker (Anlage des Schwedischen Generals Wrangels aus dem Jahr 1649), Schloß Ralswiek (Ende 19. Jh.), Schlösschen Lietzow (1893 erbaute Kopie des Schlosses Lichtenstein im Echaztal), Kirche Poseritz (Backsteinkirche um 1300), Kirche Bobbin (Feldsteinbau aus dem 13. / 14. Jh.), Kapelle Bessinn (1482), Pfarrkirche Vilmnitz (gotische Backsteinkirche aus dem 13. Jh.), Museumshof Göhren (bäuerliche Hofanlage aus dem 18. / 19. Jh.), Leuchttürme am Kap Arkona (Leuchtturm von Schinkel aus den Jahren 1826/27 und Leuchtturm von 1902), Großsteingrab Starrvitz (Neolithikum), Hügelgräber Blieschow, Hünengrab Lonvitz (Großsteingrab aus dem Neolithikum), Hügelgräberfeld Woorker Berge bei Patzig (zur Zeit der Slawen), Burgwall am Kniepower See (Slawischer Niederungsburgwall), Prosnitzer Schanze (Anlage aus dem 30 jährigen Krieg und 1808 zum Fort Napoleon durch die Franzosen ausgebaut), Burgwall Garz (Reste der Burg „Charenzia“ aus jungslawischer Zeit) und Burgwallanlage am Herthasee.
2.1.4. Schutzgebiete (nach HELCOM 1996)
Auf Rügen gibt es ein Biosphärenreservat, welches bei einer Gesamtgröße von 235 km2 11 % der Landfläche Rügens unter Schutz stellt. Der Nationalpark Jasmund im Norden Rügens wahrt 2,5 % der Insel (3000 ha), der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft bietet im Nordwesten der Insel Rückzugsflächen für bedrohte Vogelarten. Desweiteren hat die Insel drei Landschaftsschutzgebiete (73 300 ha), ein Ramsargebiet (25 800 ha) und drei BSPA-Gebiete (Baltic sea protected area) mit 251 000 ha Ausdehnung. Zusätzlich wahren 17 Naturschutzgebiete 7,6 % der Insel Rügen (7320 ha).
[...]
- Quote paper
- Oliver Thaßler (Author), 2009, Inseln der Ostsee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136491