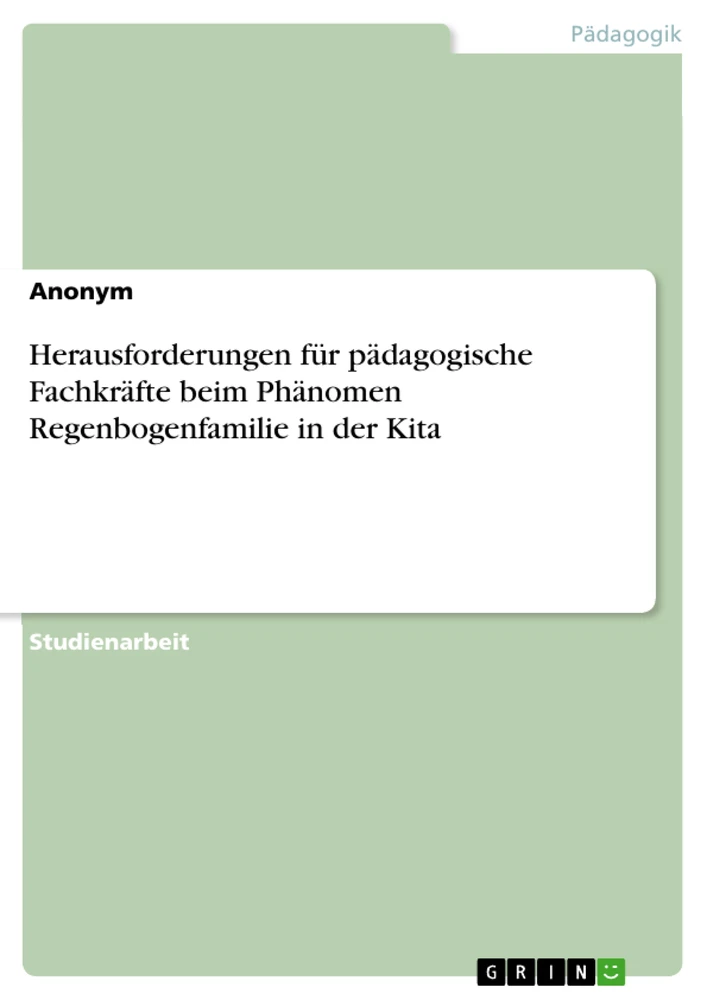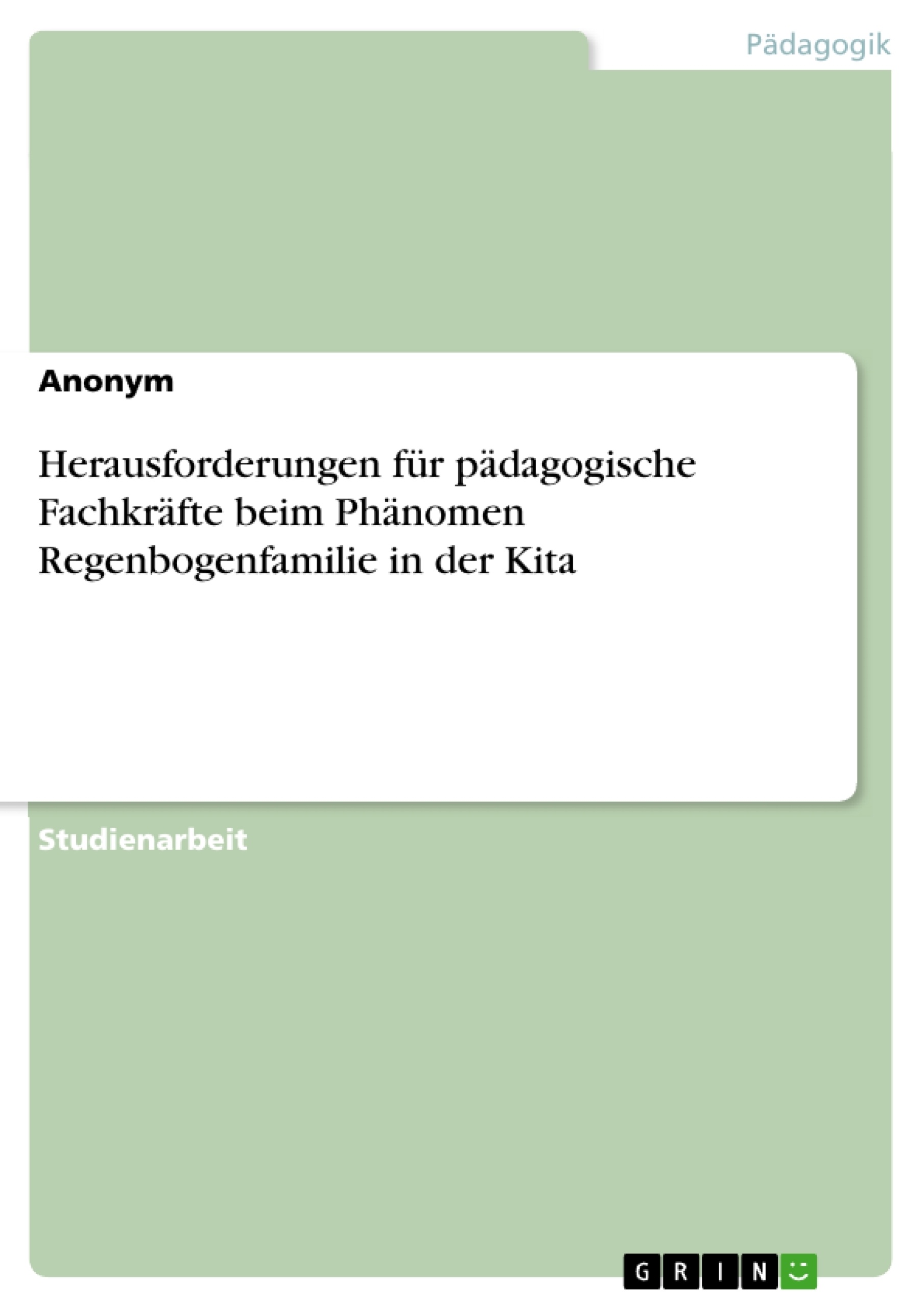Regenbogenfamilien sind heutzutage kein neues Phänomen mehr, dennoch ist es in der Regel nicht selbstverständlich, dass die gleichgeschlechtliche Familienform mitbedacht wird. Die heutige Offenheit und Gesetze ermöglichen es aber, schwulen und lesbischen Paaren ihren Kinderwunsch zu erfüllen, trotz allem stammt die Großzahl der Kinder aus Regenbogenfamilien aus vorherigen heterosexuellen Beziehungen.
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit dem Thema „Welchen Herausforderungen stellen sich pädagogische Fachkräfte beim Phänomen Regenbogenfamilie in der Kita?“. Hierfür werde ich zunächst Allgemeines über die Regenbogenfamilien, wie den Begriff und das bis heute eher schlecht angesehene Bild in der Gesellschaft, ausführen. Anschließend werde ich auf die Forschung über Regenbogenfamilien eingehen. Insbesondere auf die Studie von Marina Rupp im Auftrag des Bundesjustizministeriums (BJM) vom bayrischen Staatsinstitut für Forschung an der Uni Bamberg, ehe ich dann in Kapitel 4 das Thema der Regenbogenfamilien in der Kita behandeln werde. Hierbei werde ich zuerst auf die Herausforderungen an die Pädagogen eingehen, um anschließend anhand eines Bereichs des Kompetenzmodells von Fröhlich-Gildhoff mögliche Änderungen aufzuzeigen. Abschließend folgt ein Resümee, in welchem ich unter anderem meine Ergebnisse noch einmal aufzeige und zusätzlich ein paar Handlungsvorschläge für die Pädagogen nenne.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Regenbogenfamilie
- Begriffserklärung
- Regenbogenfamilien in der Gesellschaft
- Wege zur Regenbogenfamilie
- Die Samenspende
- Bekannter Samenspender
- Samenbank/unbekannter Samenspender
- Schwule Männer und leibliche Elternschaft
- Die Samenspende
- Regenbogenfamilien in der Forschung
- Regenbogenfamilien in der Kita – Hoher fachlicher Anspruch = hohe Professionalität
- Herausforderungen an die Pädagogen
- Kompetenzmodell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die sich pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten im Umgang mit Regenbogenfamilien stellen. Der Fokus liegt dabei auf der besonderen Bedeutung von Professionalität und Kompetenz in diesem Kontext.
- Begriffserklärung und gesellschaftliche Wahrnehmung von Regenbogenfamilien
- Diversität von Familienmodellen und den verschiedenen Wegen zur leiblichen Elternschaft innerhalb von Regenbogenfamilien
- Die Bedeutung von Forschung und wissenschaftlichen Studien im Bereich der Regenbogenfamilien
- Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten im Umgang mit Regenbogenfamilien
- Entwicklung und Implementierung von Kompetenzmodellen für Pädagogen zur professionellen Begleitung von Kindern in Regenbogenfamilien
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beschreibt die Bedeutung der Regenbogenfamilie als ein zunehmend relevantes Thema im gesellschaftlichen Kontext.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Regenbogenfamilie, seiner Entstehung und Bedeutung in der Gesellschaft. Es analysiert die Vielfalt der Familienformen und Wege zur leiblichen Elternschaft innerhalb von Regenbogenfamilien.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Regenbogenfamilien, insbesondere die Studie von Marina Rupp im Auftrag des Bundesjustizministeriums.
- Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die besonderen Herausforderungen, die sich pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten im Umgang mit Regenbogenfamilien stellen. Es beleuchtet die Notwendigkeit von fachlicher Kompetenz und Professionalität.
Schlüsselwörter
Regenbogenfamilien, Diversität, Familienmodelle, leibliche Elternschaft, Samenspende, Inklusion, Kita, pädagogische Fachkräfte, Kompetenzmodell, Professionalität, Forschung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte beim Phänomen Regenbogenfamilie in der Kita, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1364675