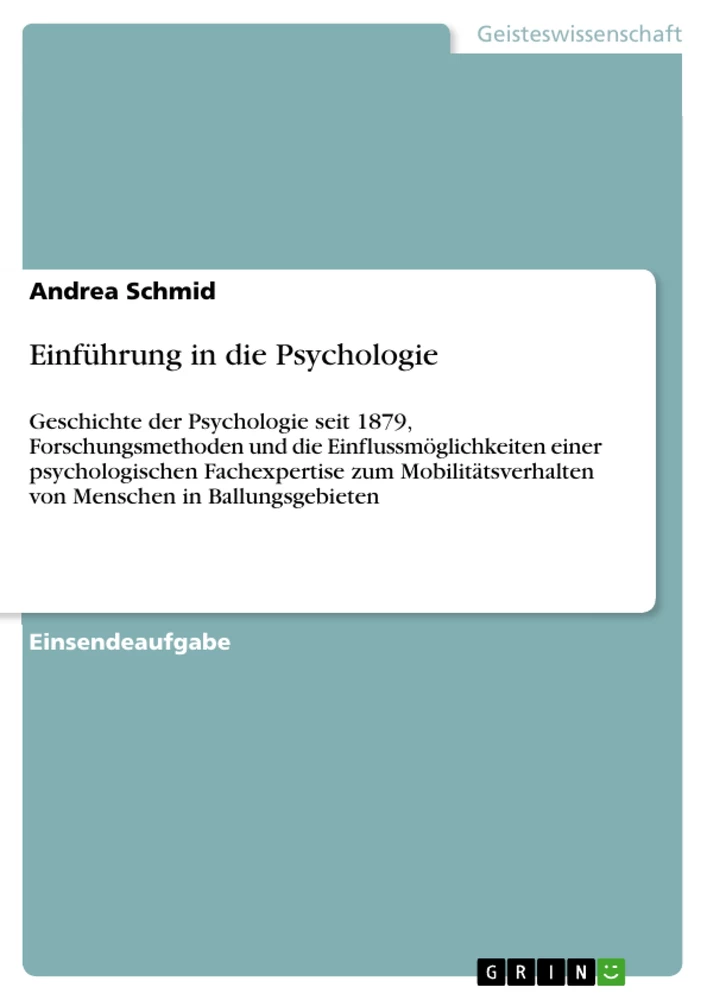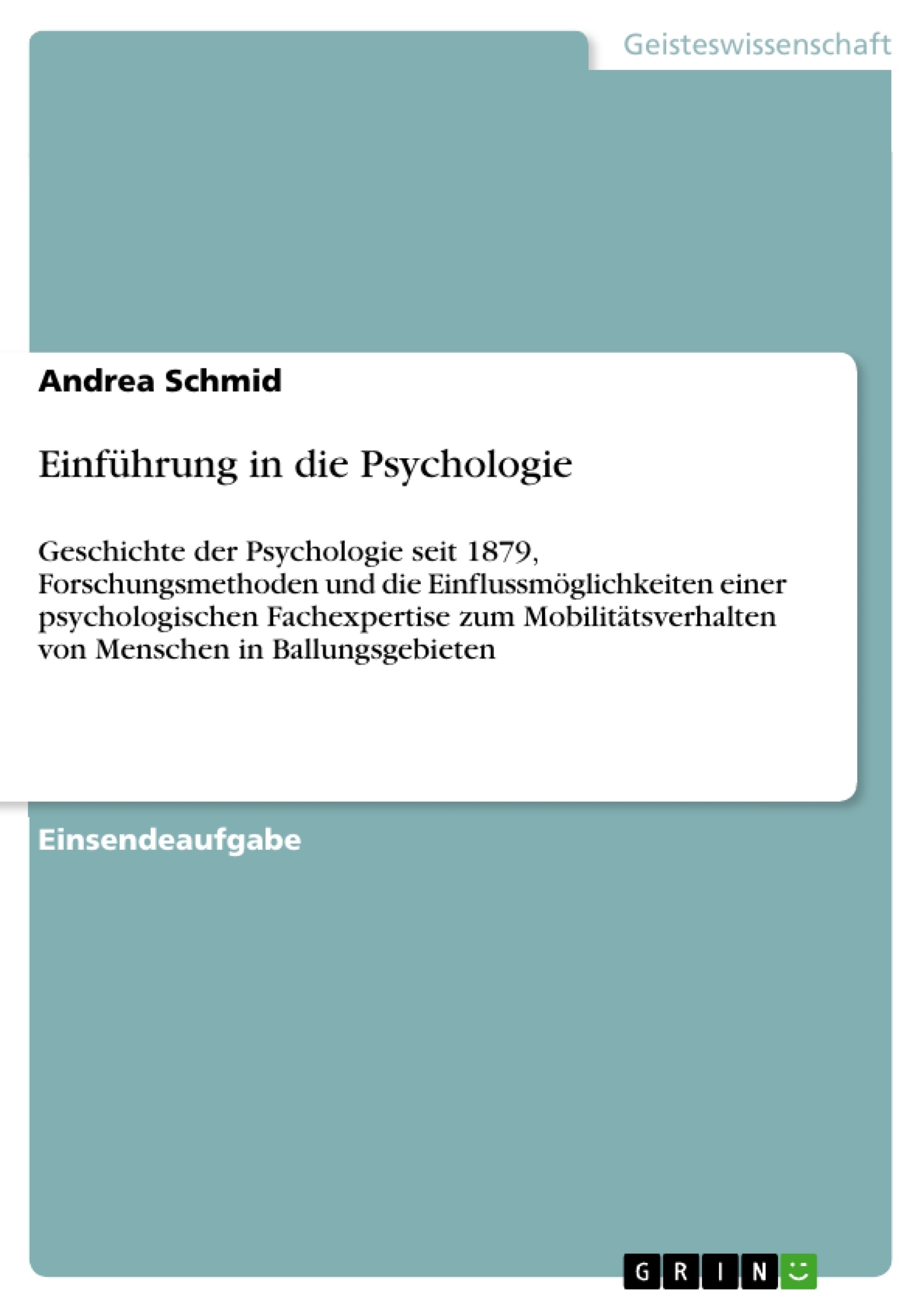Diese Einsendeaufgabe behandelt zunächst die Geschichte der Psychologie seit 1879 und die prägenden Paradigmen des 20. Jahrhunderts. Anschließend geht es um Forschungsmethoden der Psychologie und ihre Vor- und Nachteile, und schließlich um Einflussmöglichkeiten einer psychologischen Fachexpertise zum Mobilitätsverhalten von Menschen in Ballungsgebieten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Geschichte der Psychologie
1.1 Psychologie des 19. Jahrhunderts
1.2 Psychologie des 20. Jahrhunderts
1.2.1 Berliner Schule und die Gestalttherapie
1.2.2 Feldtheorie
1.2.3 Individualpsychologie
1.2.4 Analytische Psychologie
1.2.5 Humanistische Psychologie
1.3 Teildisziplinen der Psychologie im 20. Jahrhundert
1.4 Prägende Paradigmen
1.4.1 Behaviorismus
1.4.2 Kognitiver Ansatz
1.4.3 Psychoanalyse
2 Forschungsmethoden der Psychologie
2.1 Beobachtung
2.2 Befragung
2.3 Experiment
3 Psychologische Fachexpertise
3.1 Marktpsychologisches Handeln
3.2 Beschreiben und Erklären des Mobilitätsverhalten
3.2.1 Gegenstandsbestimmung „Mobilität“
3.2.2 Datenerhebung zum Mobilitätsverhalten
3.2.2.1 Primärforschung
3.2.2.2 Sekundärforschung
3.3 Verändern des Mobilitätsverhaltens
3.3.1 Motivation
3.3.2 Einstellungen und Handlungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Wilhelm Wundt
Abb. 2: Alfred Adler
Abb. 3: C.G. Jung
Abb. 4: John B. Watson
Abb. 5: Sigmund Freud
Abb. 6: Themenbeispiele für Umfragen zum 9-Euro-Ticket von STATISTA
Abb. 7: Umfragebeispiel über PKW-Nutzung zum Arbeitsplatz.
1 Geschichte der Psychologie
1.1 Psychologie des 19. Jahrhunderts
Wilhelm Wundt (1832-1920) gründete 1879 in Leipzig das erste experimentalpsychologische Labor und gilt als Gründervater der modernen und wissenschaftlichen Psychologie. Wundt definierte seine experimentelle Psychologie als Physiologische Psychologie, die in immer mehr Gebieten (z.B. Gefühle, Gedächtnis) Anwendung fand. Dabei orientierte er sich an den damals aufstrebenden Naturwissenschaften. (Schmithüsen & Krampen, 2015a, S. 8-9; Schönpflug, 2016, S. 3). Nach Wundt hat der Mensch Erinnerungen, Gefühle und Stimmungen, welche dem Menschen durch Selbstbeobachtung (Introspektion) zugänglich sind. Wundt lehnte die „kontemplative Introspektion“ (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 65) ab, befürwortete aber die instruierte und kontrollierte Selbstbeobachtung. Er forderte das Experiment als methodischen Königsweg zu neuen Erkenntnissen: genaue Beobachtung und Protokollierung der experimentellen Vorgehensweise; Wiederholbarkeit bzw. Reproduzierbarkeit eines Experimentes; Nachvollziehbarkeit; Eliminierung möglicher Störvariablen und möglichst genaue und exakte Aussagen über die Ursache und Wirkung psychologischen Geschehens. (Solokowski, 2013, S. 15-21; Mühlfelder, 2017, S. 15-16, Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 65). Die wissenschaftliche Herangehensweise prägt nach Mühlfelder (2017) bis heute das Verständnis einer modernen und wissenschaftlichen Psychologie. (S. 19).
Wundt räumte später ein, dass Experimente vorwiegend für das Erforschen „niedriger“ geistiger Funktionen, wie z.B. Empfinden und Gedächtnis geeignet seien, doch „höhere“ Funktionen wie z.B. Denken oder Religion nicht erfasst werden können. Auch ließen sich durch das Experiment keine allgemeingültigen Kriterien postulieren. (Schönpflug, W., 2016, S. 3). Die Würzburger Schule um Oswald Külpe weitete das Experiment mit systematischer und experimenteller Selbstbeobachtung bei Denkprozessen auf höhere psychische Prozesse aus. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 79).
1.2 Psychologie des 20. Jahrhunderts
Während sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterschiedliche Spezialdisziplinen (z.B. Sozial- und Persönlichkeitspsychologie) und Anwendungsdisziplinen (z.B. Psychotherapie und Wirtschaftspsychologie) etablierten, entwickelten sich auf Wunsch der Industrie und des Militärs psychologische Testmethoden (Eignung, Intelligenz, Assessment-Center), um passende Mitarbeiter zu finden oder auszuschließen. (Mühlfelder, 2017, S. 17-18).
In diesem Kapitel wird zur Geschichte der Psychologie noch auf die Feldtheorie, die Individualpsychologie und die Humanistische Psychologie eingegangen. Der Behaviorismus, die Psychoanalyse und die Kognitive Psychologie („Kognitive Wende“) werden im Kapitel 2.5. „Prägende Paradigmen“ ausführlich dargestellt.
1.2.1 Berliner Schule und die Gestalttherapie
Die Berliner Gestaltpsychologie wandte sich ab Ende der 1920er Jahre vom elementarischen Denken Wundts ab und prägte das ganze 20. Jahrhundert mit ihrem ganzheitlichen Ansatz. Die Gestalttherapie ist vor allem mit den deutschen Psychologen Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Koffka verbunden. Sie formulierten die Gestaltgesetze menschlicher Wahrnehmung: Die Wahrnehmung suche nach Gesetzmäßigkeiten und „Gestalten“ in der Umgebung. Damit sei der Wahrnehmungsprozess aktiv und konstruktiv. Ihre Hauptthese: das Ganze ist mehr als die Summe seine Einzelteile. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 79-80; Mühlfelder, 2017, S. 16).
1.2.2 Feldtheorie
Die Feldtheorie hat ganzheitlichen Charakter und wurde von Kurt Lewin aus der Gestalttherapie heraus entwickelt. (Lück-Guski-Leinwand, 2014, S. 94): Nach Bak, (2019) wird menschliches Verhalten „nicht mehr durch biologisch bedingte Triebe erklärt, sondern im jeweiligen Kontext betrachtet und analysiert.“ (S. 86). Die Feldtheorie bildet nach Lück & Guski-Leinwand (2014) die Klammer um „so verschiedenartige Gebiete wie die Verarbeitung von Konflikten, Gruppenprozesse oder psychische Regression.“ (S. 9495).
1.2.3 Individualpsychologie
Die Individualpsychologie Alfred Adlers ist neben der Analytischen Psychologie C. G. Jungs und der Psychoanalyse Sigmund Freuds eine der drei Hauptströmungen der Tiefenpsychologie. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 114).
Adler war ein Schüler Freuds, wandte sich jedoch mit seiner Individualpsychologie von Freuds analytischer Psychologie ab. Er betonte „die Unteilbarkeit des einzelnen Individuums“ (Lück & Guski-Gewand, 2014, S. 116) und sah den Menschen dynamischzielorientiert und nicht von außen getrieben an. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 119). Die Eckpfeiler der Individualpsychologie waren das Minderwertigkeitsgefühl, resultierend aus der Erziehung und die folgende Kompensation. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 120; Lück & Miller, 2005, S. 158) Für Adler waren Krankheit und Neurosen missglückte Kompensationsversuche. (Lück & Miller, 2005, S. 158).
Die Individualtherapie erlebte während des Dritten Reiches in den USA einen großen Aufschwung, da viele Individualtherapeuten nach Amerika immigrierten. In Deutschland verbreitete sich die Individualpsychologie wieder in den 1960er Jahren. (Lück & Guski- Leinwand, 2014, 120-121).
1.2.4 Analytische Psychologie
Carl Gustav Jung wandte sich mit der Ausweitung des Libido-Begriffs von Freuds Sexualtherapie ab. Für ihn war die Libido sowohl sexuelle Energie als auch Lebensenergie, „die durch Mechanismen der Triebverschiebung in akzeptable Bahnen gelenkt wird.“ (Lück & Guski-Leinwand, 2014, 123-124). Weitere zentrale Themen C.G. Jungs waren das kollektive Unterbewusste, Übertragung im therapeutischen Prozess und archetypische Figuren, wie z.B. der Schatten. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, 124).
Zum endgültigen Bruch mit Freud kam es, als Jung in seinem Buch „Wandlung und Symbole der Libido“ die Sexualität als Symbol beschrieb. (Lück & Miller, 2005, S. 154).
1.2.5 Humanistische Psychologie
Die Humanistische Psychologie verstand sich als dritten Strom der Psychologie und wandte sich vom Behaviorismus und der Psychoanalyse ab. Für sie stand der Mensch mit seinem Streben „nach einem erfüllten Leben, nach Anerkennung und Selbstverwirklichung“ (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 151) im Mittelpunkt. Carl Rogers war neben Maslow, Bühler und Pearls von der Humanistischen Psychologie geprägt und entwickelte daraus die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 1 51 ; Mühlfelder, 2017, S. 18).
1.3 Teildisziplinen der Psychologie im 20. Jahrhundert
Die Psychologie machte sich ab Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Forschungsund Anwendungsgebiete zu eigen. Grundlage war ein umfangreicher Methoden- und Theorienkatalog. Es entstanden verschiedene Spezialdisziplinen, interdisziplinäre Ansätze und Anwendungsdisziplinen wie z.B.: psychologische Tests, Eignungsverfahren, Krisenintervention, Organisationsberatung und Therapie. (Mühlfelder, 2017, S. 17-18). Teildisziplinen des 20. Jahrhunderts sind nach Lück & Guski-Leinwand (2014) unter vielen anderen die Persönlichkeitspsychologie, die Entwicklungspsychologie, die Sozialpsychologie (S. 8). Für Mühlfelder (2017) wird es zu weiteren Ausdifferenzierungen kommen. Er nennt Beispiele wie Markt-, Konsum-, Rehabilitations-, Umwelt- und Verkehrspsychologie. (S. 19).
Durch die internationale Vernetzung arbeiten Psychologinnen und Psychologen über die Landesgrenzen hinweg zusammen: „Die Psychologie wächst und zwar in globalem Maßstab. Die Psychologie entwickelt sich ständig weiter, an vielen Orten, auf vielen Ebenen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die von der Untersuchung der Aktivität von Nervenzellen bis hin zu Studie internationaler Konflikte reicht.“ (Myers, 2014a, S. 7).
1.4 Prägende Paradigmen
Um den Menschen zu verstehen, lassen sich psychologische Themen aus verschiedenen Perspektiven betrachten. (Becker-Carus & Wendt, 2017, S. 5). Nach Becker-Carus & Wendt (2017) sind fünf Paradigmen (Denkweisen) der Psychologie entstanden: der neurobiologische, der behavioristische, der psychoanalytische, der kognitive und der humanistische Ansatz. Die Paradigmen schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern können sich ergänzen (S. 5) Gerrig, Dörfler & Roos (2018) geben zwei weitere Paradigmen an: das evolutionäre und das kulturvergleichende Paradigma (S. 16-17).
Exemplarisch wird hier auf drei Paradigmen und ihre Bedeutung auf die Weiterentwicklung der Psychologie eingegangen.
1.4.1 Behaviorismus
Auf der Grundlage von Pawlows („Russische Schule“) und Thorndikes Erkenntnissen begründete John B. Watson (1878-1958) zeitgleich zur Tiefenpsychologie den Behaviorismus, der die Psychologie über Dekaden vor allem in den USA dominieren sollte. (Rauthmann, 2017, S. 119; Gluck, 2010, S. 25; Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 125).
Watson forderte von der wissenschaftlichen Psychologie, sich von der, für ihn, unwissenschaftlichen Introspektive (z.B. Kognition, Emotion, Motivation) ab- und sich ausschließlich der experimentellen Methodik und dem beobachtbaren und messbaren Verhalten zuzuwenden. (Rauthmann, 2017, S. 120).
Watson ging davon aus, dass der Mensch mit nur wenigen angeborenen Verhaltensweisen als „black box“ auf die Welt kommt. (Rauthmann, 2017, S. 121; Mühlfelder, 2017, S. 18).
Wichtige Lernprinzipien des Behaviorismus sind die Klassische und die Operante Konditionierung. (Rauthmann, 2017, S. 121). Durch die Verstärkungstheorie des Operanten Konditionierens zeigt der Mensch motiviertes Verhalten oder nicht. Durch Lernprozesse und die Auseinandersetzung mit der Umwelt bilden sich immer komplexere Gewohnheiten aus. Diese bestimmen die Persönlichkeit eines Menschen. Selbst ursprünglich psychoanalytische Konzepte (z.B. Angst) sollten allein durch Konditionierung erklärt werden. (Kauffeld, 2016, S. 40; Rauthmann, 2017, S. 120-121). Neobehavioristen wie Albert Bandura bezogen Persönlichkeitsmerkmale, Erfahrungen und Emotionen mit ein. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 137).
Der Behaviorismus wurde vor allem in den 1920er Jahren in den USA zum dominierenden Denkansatz in der Psychologie des Lernens. (Gluck, 2010, S. 26). Da der Behaviorismus einen Großteil seiner Erkenntnisse durch Experimente mit Tieren gewonnen hat, dient dieses Vorgehen für Rauthmann (2017) allenfalls als Basis für weitere sozial-lerntheoretische Ansätze. (S. 121). und ist die „Antithese zu psychodynamischen Ansätzen wie Freuds Psychoanalyse.“ (S. 120). Doch hinterließ der Behaviorismus ein bedeutendes Erbe in der Entwicklung der Psychologie: die Notwendigkeit genauen Experimentierens und exakt definierte Standards. (Gerrig et al., 2018, S. 14).
1.4.2 Kognitiver Ansatz
Immer mehr Psychologen wandten sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts von der Idee „eines passiv reagierenden Menschen“ ab und der Vorstellung eines „planenden, selbständig handelnden und wahrnehmenden Individuum“ zu. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 146). Der kognitionspsychologische Ansatz ist als Gegenbewegung zum Behaviorismus und dessen Beschränkungen zu verstehen. (Becker-Carus & Wendt, 2017, S. 8; Gerrig et al., 2018, S. 15). Er leitete die „Kognitive Wende“ ein, die ab den 1970er Jahre vorwiegend die Psychologie bestimmte. (Lück & Guski-Leinwand, 2014, S. 146).
Für Lück & Guski-Leinwand (2014) war durch den revolutionären Charakter der kognitiven Wende eine neue Qualität in der Psychologie möglich (S. 147): untersucht wurden vor allem die geistige Leistung des Menschen. Zudem wandte sich die Psychologie mehr und mehr der neurophysiologischen Forschung zu, die es ermöglicht, psychische Prozesse im Gehirn sichtbar zu machen. (Mühlfelder, 2017, S. 18; Schönpflug, 2016, S. 29).
Aus kognitiver Sicht besitzt der Mensch die Fähigkeit des Denkens. Im Denken geht der Mensch völlig neue Wege und beschränkt sich nicht mehr nur das, was er in der Vergangenheit gelernt hat. Der Fokus des kognitiven Ansatzes liegt auf Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis, Sprache, Erinnern, Verstehen und Problemlösen. (Gerrig et al., 2018, S. 15).
Nach Becker-Carus & Wendt (2017) kehrte die Psychologie mit dem kognitiven Ansatz wieder zu ihren Anfängen zurück, ohne sich dabei von den empirischen Methoden abzuwenden. (S. 8). Der kognitionspsychologische Ansatz möchte durch das Experiment verstehen, „wie diese mentalen Prozesse der Informationsverarbeitung funktionieren und welche Organisationsstrukturen ihnen zugrunde liegen.“ (Becker- Carus & Wendt, 2017, S. 8).
Somit ist menschliches Verhalten im Gegensatz zum Behaviorismus nicht nur eine alleinige Reaktion auf einen Umweltreiz, sondern das Ergebnis, ob und wie der Mensch mit Außenreizen umgeht. (Becker-Carus & Wendt, 2017, S. 8). Über das Modelllernen hat der Mensch zudem die Möglichkeit, durch Imitation von anderen zu lernen. Der Mensch verarbeitet das Beobachtete in kognitiven Prozessen. (Kauffeld, 2016, S. 43).
Für Becker-Carus & Wendt (2017) geht der kognitive Ansatz weit über den behavioristischen hinaus, doch bleiben Fragen nach der Motivation, des Willens und der Emotion offen. (Becker-Carus & Wendt, 2017, S. 8).
1.4.3 Psychoanalyse
Zeitgleich zum Behaviorismus wurde der psychoanalytische Ansatz von Sigmund Freud (1856-1939) Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien entwickelt. Während der Behaviorismus gezielt auf experimentelle Analysen und Untersuchungen setzte, bezog sich Freuds psychoanalytischer Ansatz auf die persönlichen Fallstudien seiner psychisch erkrankten Patientinnen und Patienten. (Becker-Carus & Wendt, S. 2017, S. 13).
[...]
- Quote paper
- Andrea Schmid (Author), 2023, Einführung in die Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1364006