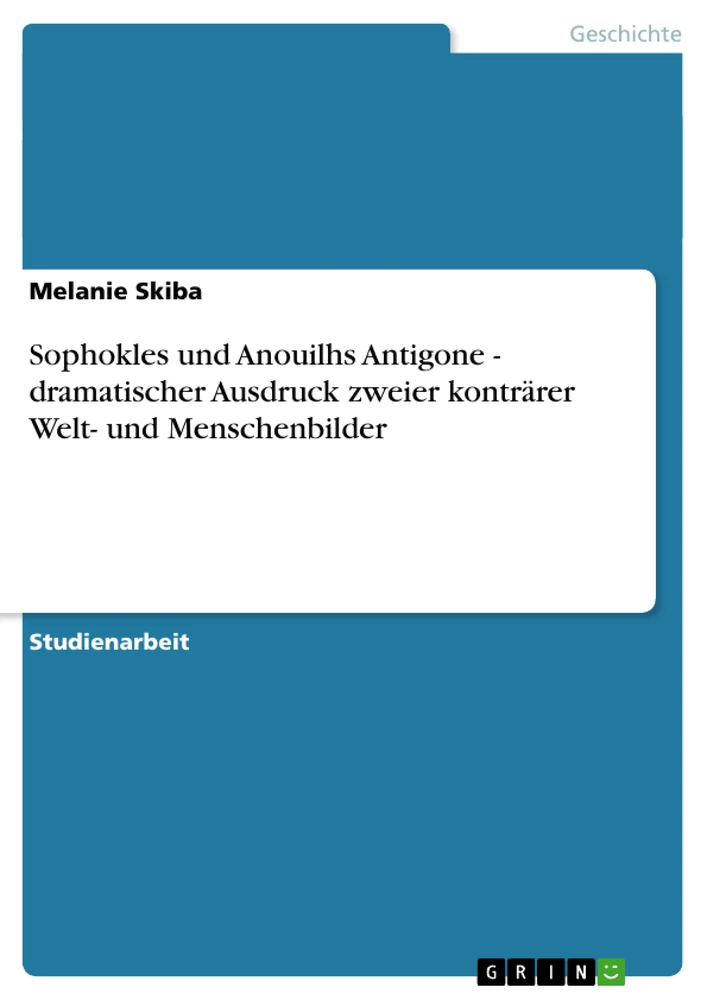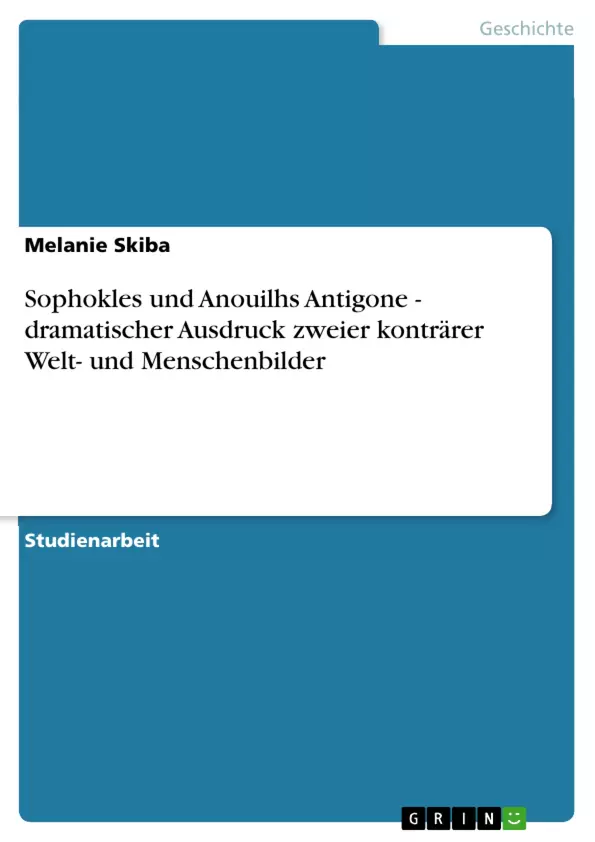„Es ist sinnlos, das Schicksal der Antigone heute dramatisch zu wiederholen, weil die Heldin als krankhaft hartnäckiges, von einer Schrulle beherrschtes, todesgieriges Wesen erscheinen müßte und nicht ein Exempel der Metaphysik, sondern der Pathologie abgäbe“ 1. Dieser Auszug aus Gerhard Nebels Abhandlung „Weltangst und Götterzorn“ beschreibt meiner Ansicht nach äußerst treffend die Unvereinbarkeit zweier Welten, die sich nicht nur historisch, sondern auch geistesgeschichtlich in enormer Distanz zueinander befinden.
Wie sollten demnach zwei Werke, von denen eines ca. im Jahre 442 vor Christus geschaffen worden ist, während das andere auf das Jahr 1944 zu datieren ist, je von einer gemeinsamen Basis ausgehen können?
Und doch trägt sowohl das sophokleische Stück als auch Anouilhs moderne Rezeption den Titel „Antigone“. In Zusammenhang mit der nicht von der Hand zu weisenden Tatsache, dass beide Fabeln außerdem erstaunliche Parallelitäten aufweisen, regt diese Feststellung den Leser des 20. Jahrhunderts zweifelsohne zur Reflexion darüber an, worin genau sich seine Welterfahrung von der des antiken Rezipienten unterscheidet.
Ist es demzufolge - um auf das einleitende Zitat zu rekurrieren - nun tatsächlich „sinnlos“ eine moderne Konzeptualisierung des Antigonestoffs vorzunehmen oder bietet der Rahmen beider Dramen nicht vielmehr gerade in seiner äußerlichen Kongruenz die Möglichkeit einer präzisen Darstellung zweier antithetisch aufeinander bezogenen Welt- und Menschenbilder?
Inhaltsverzeichnis
- Die „Antigonen“ von Sophokles und Anouilh - dramatischer Ausdruck zweier konträrer Welt- und Menschenbilder
- Inhaltliche Zusammenfassung beider Werke
- Handlungsstruktur in der sophokleischen „Antigone“
- Handlungsstruktur in der „Antigone“ von Jean Anouilh
- Einbettung des Individuums in metaphysische Kohärenzsysteme
- Bedeutung von Bestattungsgebot und Bestattungsverbot
- Manifestation des Numinosen
- Metaphysische Grundlage der Figuren
- Präsenz bzw. Absenz des Sehers
- Einbettung des Individuums in gesellschaftliche Strukturen
- Die Familie - Ort des Schutzes?
- Unterschiedliche Ausgestaltung der Liebesbeziehung Antigone-Hämon
- Einsamkeit- gleichberechtigter Teil des Gefühlsspektrums oder Grundgefühl menschlicher Existenz?
- Der Staat und seine Bedeutung fürs Individuum
- Kreons Herrschaftsauffassung
- Sinnstruktur der sophokleischen Polis vs. Absurdität des politischen Handelns bei Anouilh
- Die „Antigonen“ – Lehrstücke politischen Handelns?
- Vergleich der antagonistischen Prinzipien in den Weltbildern beider Dramen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die beiden „Antigone“-Dramen von Sophokles und Anouilh vergleichend zu analysieren und die darin zum Ausdruck kommenden konträren Welt- und Menschenbilder herauszuarbeiten. Es wird untersucht, wie sich die Einbettung des Individuums in metaphysische und gesellschaftliche Strukturen in beiden Werken unterscheidet und welche Bedeutung der Staat für das Individuum in den jeweiligen Kontexten hat.
- Konträre Welt- und Menschenbilder im Vergleich
- Die Rolle des Individuums im Spannungsfeld zwischen göttlichem und irdischem Recht
- Die Bedeutung von Familie und Gesellschaft
- Der Konflikt zwischen Individuum und Staat
- Der Einfluss metaphysischer Konzepte auf das Handeln der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Die „Antigonen“ von Sophokles und Anouilh - dramatischer Ausdruck zweier konträrer Welt- und Menschenbilder: Dieser einleitende Abschnitt untersucht die scheinbare Diskrepanz zwischen Sophokles' antikem Drama und Anouilhs moderner Adaption. Die Autorin stellt die Frage, ob trotz der zeitlichen und geistesgeschichtlichen Distanz ein Vergleich sinnvoll ist und wie die unterschiedlichen Welterfahrungen der Rezipienten beider Epochen die Interpretation beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Möglichkeit, durch den Vergleich der beiden Werke zwei antithetische Welt- und Menschenbilder präzise darzustellen.
Inhaltliche Zusammenfassung beider Werke: Dieses Kapitel bietet eine knappe strukturelle Gliederung der Handlungsverläufe beider Dramen. Es werden die wesentlichen Handlungselemente und Szenen beschrieben, um die Grundlage für die folgende vergleichende Analyse zu schaffen. Dabei werden die Unterschiede in der Dramaturgie und der Figurenzeichnung bereits angedeutet.
Einbettung des Individuums in metaphysische Kohärenzsysteme: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Bestattungsgebots und -verbots, die Manifestation des Numinosen, die metaphysische Grundlage der Figuren und die Präsenz bzw. Absenz des Sehers in beiden Dramen. Hier wird analysiert, wie die Figuren durch metaphysische Konzepte beeinflusst werden und wie diese Konzepte die Handlung vorantreiben.
Einbettung des Individuums in gesellschaftliche Strukturen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Familie, der Liebesbeziehung zwischen Antigone und Hämon, und dem Gefühl der Einsamkeit in beiden Dramen. Es analysiert, wie die gesellschaftlichen Strukturen die Handlung und das Schicksal der Figuren beeinflussen und wie sich die Darstellung der Familie und der Liebe in den beiden Werken unterscheidet.
Der Staat und seine Bedeutung fürs Individuum: Hier werden Kreons Herrschaftsauffassung, die Sinnstruktur der sophokleischen Polis im Vergleich zur Absurdität des politischen Handelns bei Anouilh, und die Frage, ob die „Antigonen“ als Lehrstücke politischen Handelns interpretiert werden können, untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf dem Konflikt zwischen dem Individuum und der staatlichen Ordnung und deren unterschiedlicher Ausprägung in beiden Dramen.
Schlüsselwörter
Antigone, Sophokles, Anouilh, griechische Tragödie, modernes Drama, Weltbild, Menschenbild, Metaphysik, Gesellschaft, Staat, Individuum, Familie, Liebe, Tod, Bestattungsritual, politisches Handeln, Konflikt, Hybris, Schicksal.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu „Die „Antigonen“ von Sophokles und Anouilh - dramatischer Ausdruck zweier konträrer Welt- und Menschenbilder“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert vergleichend die beiden „Antigone“-Dramen von Sophokles und Anouilh. Im Fokus steht der Vergleich der darin zum Ausdruck kommenden konträren Welt- und Menschenbilder und die Untersuchung der Einbettung des Individuums in metaphysische und gesellschaftliche Strukturen sowie die Bedeutung des Staates für das Individuum in den jeweiligen Kontexten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Konträre Welt- und Menschenbilder, die Rolle des Individuums zwischen göttlichem und irdischem Recht, die Bedeutung von Familie und Gesellschaft, den Konflikt zwischen Individuum und Staat, und den Einfluss metaphysischer Konzepte auf das Handeln der Figuren. Konkrete Aspekte umfassen den Vergleich der Handlungsstrukturen beider Dramen, die Bedeutung von Bestattungsgebot und -verbot, die Darstellung der Liebesbeziehung Antigone-Hämon, Kreons Herrschaftsauffassung und die Sinnstruktur der Polis bei Sophokles im Vergleich zur Absurdität des politischen Handelns bei Anouilh.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung mit der Fragestellung des Vergleichs beider „Antigone“-Versionen; Inhaltszusammenfassungen beider Dramen; Einbettung des Individuums in metaphysische Kohärenzsysteme (Bestattungsrituale, Numinoses, Seher); Einbettung des Individuums in gesellschaftliche Strukturen (Familie, Liebe, Einsamkeit); Der Staat und seine Bedeutung fürs Individuum (Kreons Herrschaft, Polis vs. absurdes Handeln, „Antigonen“ als Lehrstücke); und einen Vergleich der antagonistischen Prinzipien in den Weltbildern beider Dramen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die beiden „Antigone“-Dramen vergleichend zu analysieren und die darin zum Ausdruck kommenden konträren Welt- und Menschenbilder herauszuarbeiten. Es soll untersucht werden, wie sich die Einbettung des Individuums in metaphysische und gesellschaftliche Strukturen in beiden Werken unterscheidet und welche Bedeutung der Staat für das Individuum in den jeweiligen Kontexten hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Antigone, Sophokles, Anouilh, griechische Tragödie, modernes Drama, Weltbild, Menschenbild, Metaphysik, Gesellschaft, Staat, Individuum, Familie, Liebe, Tod, Bestattungsritual, politisches Handeln, Konflikt, Hybris, Schicksal.
Wie wird die Handlung der beiden Dramen zusammengefasst?
Die Arbeit bietet eine knappe Zusammenfassung der Handlungsstrukturen beider Dramen, um die Grundlage für die vergleichende Analyse zu schaffen. Wesentliche Handlungselemente und Szenen werden beschrieben, wobei Unterschiede in der Dramaturgie und der Figurenzeichnung bereits angedeutet werden.
Wie wird der Vergleich der beiden „Antigone“-Dramen durchgeführt?
Der Vergleich erfolgt durch eine Gegenüberstellung der Welt- und Menschenbilder, der Einbettung des Individuums in metaphysische und gesellschaftliche Strukturen, und der Bedeutung des Staates für das Individuum in beiden Dramen. Die Analyse berücksichtigt die zeitliche und geistesgeschichtliche Distanz zwischen den Werken und untersucht den Einfluss dieser Distanz auf die Interpretation.
- Citation du texte
- Melanie Skiba (Auteur), 2007, Sophokles und Anouilhs Antigone - dramatischer Ausdruck zweier konträrer Welt- und Menschenbilder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136347