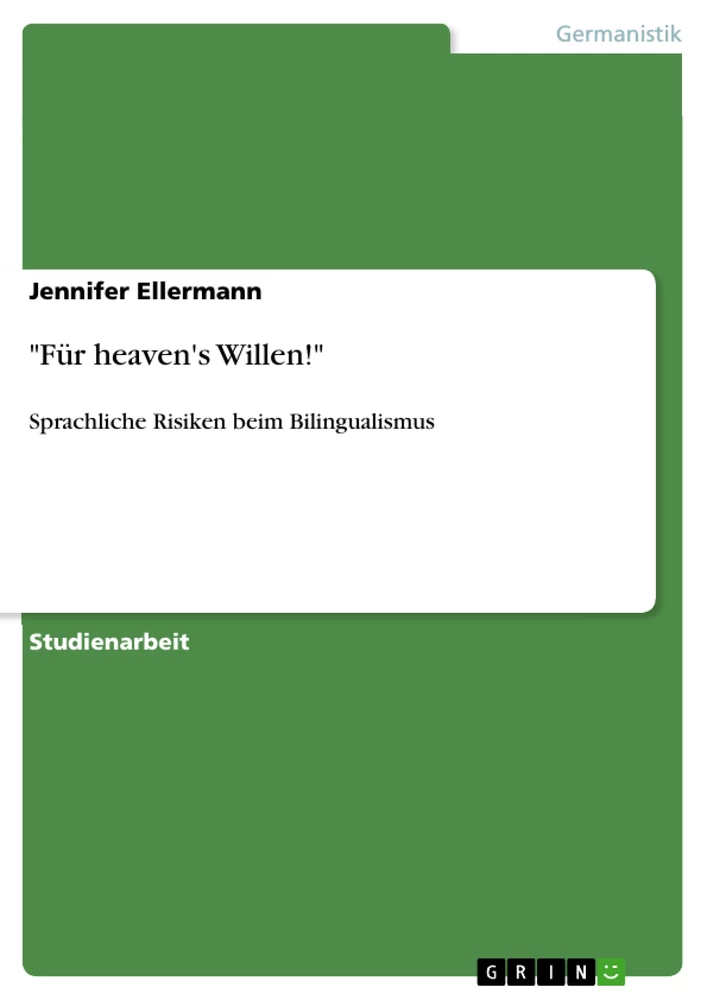„Seit längerer Zeit ist Sprache in mehr als einem Sinn ,in aller Munde’.“
Mit diesen Worten beginnt Rosemarie Tracy ihre Ausführungen zu einem öffentlichen Globalisierungsdiskurs, der nach der weltweiten Vernetzung von Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur und Politik nun auch beim Thema Sprache angelangt ist. Denn die „Zeit, in der es für den Fortschritt der Forschung erforderlich war, jede Gemeinschaft als sprachlich in sich abgeschlossen und homogen anzusehen“ ist längst vorbei, das Gegenteil ist nun der Fall.
Wer wettkampffähig und auf der Höhe der Zeit bleiben will, muss über die Grenzen des eigenen Landes hinausschauen und sich das nötige Rüstzeug für ein Leben im globalen Dorf aneignen. Dazu gehört zweifellos an erster Stelle die Fähigkeit verstehen zu können, was andere einem mitteilen wollen, und selbst verstanden zu werden – Mehrsprachigkeit ist da das Stichwort. So kommen heutzutage nicht mehr nur Kinder mit Migrationshintergrund schon früh mit verschiedenen Sprachen in Kontakt, sondern auch immer mehr Söhne und Töchter muttersprachlicher Eltern, die sich dazu entschieden haben, ihr Kind bewusst bilingual zu erziehen. Doch nach der Entscheidung kommt es schnell zu der Erkenntnis, dass Spracherwerb ohnehin schon eine sehr komplexe Angelegenheit ist, erst recht wenn man dann auch noch dafür sorgen muss, zwei sprachliche Systeme getrennt voneinander zu halten. So kommt es als Ergebnis von unzureichender Kontrastierung zu Sprachmischungen, die an dem Punkt zum Risiko werden, wo sie die Verstehbarkeit und das Verständnis des Sprechers einschränken. Daher werden in dieser Arbeit folgende Fragen erörtert:
Welche sprachlichen Risiken gibt es beim Bilingualismus? Was sind die Konsequenzen der Zweisprachigkeit und ist sie in sprachlicher und kognitiver Hinsicht ein Nachteil oder Vorteil?
Nach den grundlegenden Ausführungen zum Bilingualismus und zu Sprachfehlern im Allgemeinen folgt eine Erörterung der einzelnen sprachlichen Risiken und Konsequenzen bis schließlich in einem resümierenden Fazit die Frage nach dem Nutzen bzw. Schaden von Bilingualismus beantwortet werden kann.
Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass das Thema sehr umfangreich ist und die einzelnen Aspekte hinsichtlich des Rahmens dieser Arbeit somit nicht in Hinblick auf Vollständigkeit, sondern gemäß der Fragestellungen erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Bilingualismus
- 2.1.1 Eine mögliche Definition
- 2.1.2 Problematik der Definition von Bilingualismus
- 2.2 Fehleranalyse
- 2.2.1 Was ist ein Sprachfehler?
- 2.2.2 Unterschied zwischen Fehler und Irrtum
- 2.1 Bilingualismus
- 3 Sprachliche Risiken beim Bilingualismus
- 3.1 Code-switching
- 3.1.1 Definition
- 3.1.2 „situational switching“ vs. „metaphorical switching“
- 3.1.3 Code-switching: Problem oder Kompetenz?
- 3.2 Sprachliche Interferenzen
- 3.2.1 Definition
- 3.2.2 Unterschied zwischen Code-switching und sprachlicher Interferenz
- 3.2.3 Interferenzarten
- 3.1 Code-switching
- 4 Konsequenzen von Bilingualismus
- 4.1 Sprachliche Nachteile (Semilingualismus)
- 4.1.1 Definition
- 4.1.2 Empirische Untersuchung in Peru
- 4.2 Sprachliche Vorteile
- 4.2.1 Die kognitiv-akademische Sprachfähigkeit
- 4.2.2 Immersionsprogramm von St. Lambert
- 4.1 Sprachliche Nachteile (Semilingualismus)
- 5 Erklärungsansätze
- 5.1 Die Schwellenhypothese
- 5.1.1 Darstellung
- 5.1.2 Kritik
- 5.2 Interpendenztheorie
- 5.1 Die Schwellenhypothese
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachlichen Risiken und Konsequenzen von Bilingualismus. Sie beleuchtet die Problematik der Definition von Bilingualismus, analysiert Sprachfehler im Kontext der Zweisprachigkeit und erörtert Phänomene wie Code-switching und sprachliche Interferenzen. Ziel ist es, die Frage nach dem Nutzen oder Schaden von Bilingualismus in sprachlicher und kognitiver Hinsicht zu beantworten.
- Definition und Problematik des Begriffs Bilingualismus
- Analyse sprachlicher Risiken wie Code-switching und Interferenzen
- Konsequenzen von Bilingualismus: Vorteile und Nachteile
- Untersuchung verschiedener Erklärungsansätze für bilinguale Sprachentwicklung
- Bewertung des Nutzens und Schadens von Bilingualismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bilingualismus im Kontext der Globalisierung ein. Sie stellt die zentrale Frage nach den sprachlichen Risiken und Konsequenzen von Zweisprachigkeit und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Herausforderungen und Vorteile, die mit dem Erwerb und der Nutzung zweier Sprachen verbunden sind.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse. Es bietet eine mögliche Definition von Bilingualismus, diskutiert die Schwierigkeiten bei der präzisen Begriffsbestimmung und beleuchtet die verschiedenen Arten von Sprachfehlern, insbesondere im Kontext des Bilingualismus. Die Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum wird hier als entscheidend für die weitere Betrachtung hervorgehoben.
3 Sprachliche Risiken beim Bilingualismus: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den sprachlichen Risiken, die mit Bilingualismus verbunden sein können. Es analysiert Code-switching, unterscheidet zwischen „situational switching“ und „metaphorical switching“ und diskutiert die Frage, ob Code-switching als Kompetenzmangel oder als sprachliche Fähigkeit betrachtet werden sollte. Weiterhin werden sprachliche Interferenzen definiert und ihre verschiedenen Arten erläutert. Der Fokus liegt auf der differenzierten Betrachtung dieser Phänomene, um ein umfassendes Bild der sprachlichen Herausforderungen im Bilingualismus zu vermitteln.
4 Konsequenzen von Bilingualismus: Dieses Kapitel erörtert die Konsequenzen von Bilingualismus, indem es sowohl sprachliche Nachteile (wie Semilingualismus) als auch Vorteile (verbesserte kognitive Fähigkeiten, Vorteile im akademischen Bereich) darstellt. Empirische Studien und konkrete Beispiele wie das Immersionsprogramm von St. Lambert veranschaulichen die jeweiligen Auswirkungen. Es wird ein ausgewogenes Bild der Vor- und Nachteile präsentiert, um die Komplexität der Thematik aufzuzeigen.
5 Erklärungsansätze: Hier werden verschiedene Theorien zur Erklärung der bilingualen Sprachentwicklung vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Schwellenhypothese und die Interpendenztheorie werden im Detail erläutert, wobei ihre Stärken und Schwächen beleuchtet werden. Der Vergleich der Theorien trägt zu einem vertieften Verständnis der komplexen Zusammenhänge bei.
Schlüsselwörter
Bilingualismus, Zweisprachigkeit, Code-switching, sprachliche Interferenzen, Fehleranalyse, Semilingualismus, kognitive Fähigkeiten, Schwellenhypothese, Interpendenztheorie, Sprachkontakt, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachliche Risiken und Konsequenzen von Bilingualismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die sprachlichen Risiken und Konsequenzen von Bilingualismus. Sie beleuchtet die Definition von Bilingualismus, analysiert Sprachfehler im Kontext der Zweisprachigkeit und erörtert Phänomene wie Code-switching und sprachliche Interferenzen. Das Ziel ist es, den Nutzen oder Schaden von Bilingualismus sprachlich und kognitiv zu bewerten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Problematik des Begriffs Bilingualismus, analysiert sprachliche Risiken wie Code-switching und Interferenzen, untersucht die Konsequenzen von Bilingualismus (Vorteile und Nachteile), verschiedene Erklärungsansätze für bilinguale Sprachentwicklung und bewertet schließlich den Nutzen und Schaden von Bilingualismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen (Bilingualismus und Fehleranalyse), Sprachliche Risiken beim Bilingualismus (Code-switching und Interferenzen), Konsequenzen von Bilingualismus (Vorteile und Nachteile, z.B. Semilingualismus), Erklärungsansätze (Schwellenhypothese und Interpendenztheorie) und Fazit.
Was wird unter Bilingualismus verstanden und welche Probleme gibt es bei seiner Definition?
Kapitel 2 definiert Bilingualismus und diskutiert die Schwierigkeiten bei der präzisen Begriffsbestimmung. Es wird auf die Problematik hingewiesen, eine allgemeingültige Definition zu finden, die alle Facetten des Phänomens abdeckt.
Was sind Code-switching und sprachliche Interferenzen?
Kapitel 3 analysiert Code-switching (Wechsel zwischen zwei Sprachen) und unterscheidet zwischen „situational switching“ und „metaphorical switching“. Es untersucht auch sprachliche Interferenzen (Einfluss einer Sprache auf die andere) und deren verschiedene Arten. Die Frage, ob Code-switching als Kompetenzmangel oder Kompetenz betrachtet werden sollte, wird diskutiert.
Welche Konsequenzen hat Bilingualismus?
Kapitel 4 erörtert die Konsequenzen von Bilingualismus, sowohl sprachliche Nachteile (z.B. Semilingualismus) als auch Vorteile (verbesserte kognitive Fähigkeiten, Vorteile im akademischen Bereich). Empirische Studien und Beispiele wie das Immersionsprogramm von St. Lambert veranschaulichen die Auswirkungen.
Welche Theorien zur Erklärung der bilingualen Sprachentwicklung werden vorgestellt?
Kapitel 5 stellt verschiedene Theorien vor und diskutiert sie kritisch. Die Schwellenhypothese und die Interpendenztheorie werden im Detail erläutert, einschließlich ihrer Stärken und Schwächen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bilingualismus, Zweisprachigkeit, Code-switching, sprachliche Interferenzen, Fehleranalyse, Semilingualismus, kognitive Fähigkeiten, Schwellenhypothese, Interpendenztheorie, Sprachkontakt, Sprachentwicklung.
Gibt es empirische Beispiele in der Arbeit?
Ja, die Arbeit beinhaltet empirische Beispiele, wie die Erwähnung einer empirischen Untersuchung in Peru zu Semilingualismus und das Immersionsprogramm von St. Lambert zur Veranschaulichung der positiven Auswirkungen von Bilingualismus.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Der Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" bietet eine detaillierte Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels der Arbeit.
- Quote paper
- Jennifer Ellermann (Author), 2009, "Für heaven's Willen!" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136334