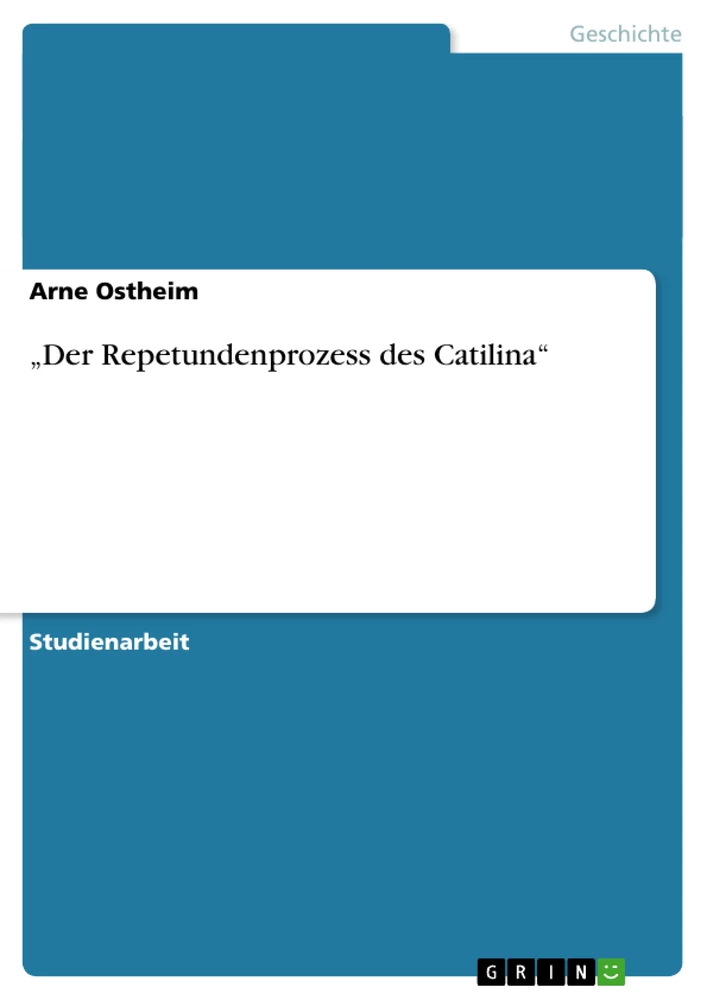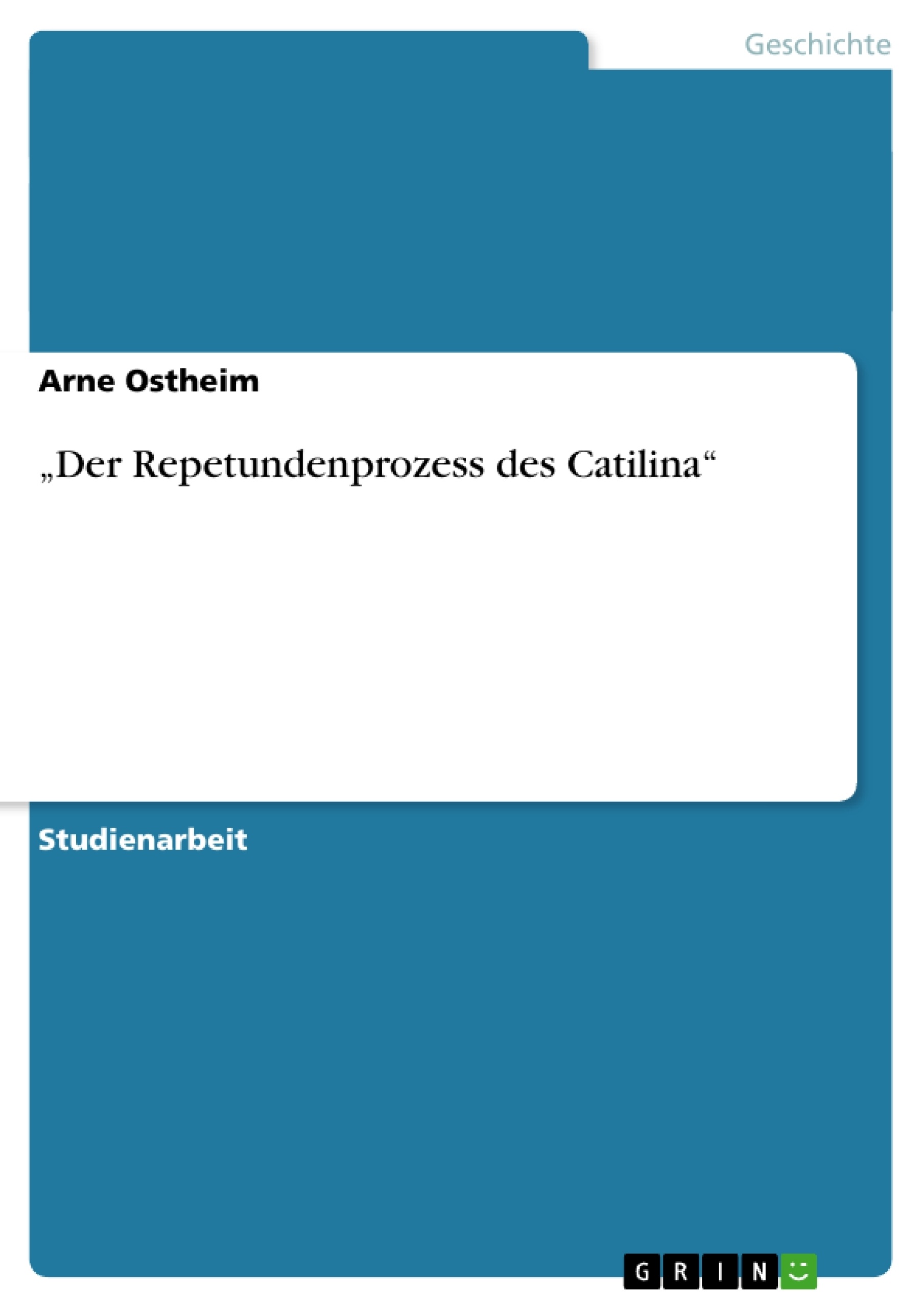1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem besonderen Kapitel des römischen Rechtssystems. Die Prozesse gegen römische Statthalter, die die ihnen unterstellten Provinzen ausgebeutet hatten: den Repetundenprozessen. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Quelle und dieser Arbeit liegen auf dem Repetun-denprozess gegen Lucius Sergius Catilina.
Der Forschungsstand in der Literatur ist sehr umfassend und bietet ein breites Wissen um die Entstehungsgeschichte des Repetundenprozesses und dessen Wandel in der römischen Geschichte. Es gibt aber in der Literatur strittige Fälle, die unter den Historikern diskutiert werden. Ein Beispiel für diese Strittigkeit ist die Frage nach den Beweggründen Ciceros sich gegen eine Verteidigung Catilinas in dessen Repetundenprozess zu entscheiden, obwohl er dies ernsthaft in Erwägung gezogen hatte. Im Rahmen dieser Differenzen ist eine genauere Betrachtung der Quellen von Nöten, da häufig die römische Geschichtsschreibung durch subjektive Meinungen ergänzt wurde.
Um einen Einblick in das Repetundenverfahren zu gewinnen und einen Bezug zu Catilina herzustellen, soll zunächst die historische Entwicklung der Repetundenprozesse betrachtet werden. Es wird gezeigt, was der Grund für das Verfahren gegen Catilina war und wie sich der Prozess entwickelte. Hierbei soll ein Erklärungsversuch für die Motivation Ciceros, Catilina nicht zu verteidigen, gegeben werden. Abschließend wird Bilanz gezogen und die Folgen des Repetundenprozesses für Catilina dargelegt werden.
In dieser Arbeit wird nicht auf einzelne Prozesse oder auf die Auswirkungen auf das weitere Handeln Catilinas bzw. die Verschwörung eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Quellenkritik
2.1) Quellenbeschreibung
2.2) Innere Kritik
2.2.1) Begriffsdefinitionen
2.2.2) Sachliche Aufschlüsselung
3.) Quelleninterpretation
3.1) Inhaltsangabe
3.2) Einordnung in den historischen Kontext
3.2.1) Die Geschichte des Repetundenverfahrens
3.2.2) Die Propraetur Catilinas
3.2.3) Catilina und das Repetundenverfahren
3.2.4) Cicero als Verteidiger Catilinas?
4.) Ergebnis und Ausblick
5.) Quelle und Literatur
5.1) Quelle
5.2) Literatur
6.) Anhang
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem besonderen Kapitel des römischen Rechtssystems. Die Prozesse gegen römische Statthalter, die die ihnen unterstellten Provinzen ausgebeutet hatten: den Repetundenprozessen. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Quelle und dieser Arbeit liegen auf dem Repetundenprozess gegen Lucius Sergius Catilina.
Der Forschungsstand in der Literatur ist sehr umfassend und bietet ein breites Wissen um die Entstehungsgeschichte des Repetundenprozesses und dessen Wandel in der römischen Geschichte. Es gibt aber in der Literatur strittige Fälle, die unter den Historikern diskutiert werden. Ein Beispiel für diese Strittigkeit ist die Frage nach den Beweggründen Ciceros sich gegen eine Verteidigung Catilinas in dessen Repetundenprozess zu entscheiden, obwohl er dies ernsthaft in Erwägung gezogen hatte. Im Rahmen dieser Differenzen ist eine genauere Betrachtung der Quellen von Nöten, da häufig die römische Geschichtsschreibung durch subjektive Meinungen ergänzt wurde.
Um einen Einblick in das Repetundenverfahren zu gewinnen und einen Bezug zu Catilina herzustellen, soll zunächst die historische Entwicklung der Repetundenprozesse betrachtet werden. Es wird gezeigt, was der Grund für das Verfahren gegen Catilina war und wie sich der Prozess entwickelte. Hierbei soll ein Erklärungsversuch für die Motivation Ciceros, Catilina nicht zu verteidigen, gegeben werden. Abschließend wird Bilanz gezogen und die Folgen des Repetundenprozesses für Catilina dargelegt werden.
In dieser Arbeit wird nicht auf einzelne Prozesse oder auf die Auswirkungen auf das weitere Handeln Catilinas bzw. die Verschwörung eingegangen.
2. Quellenkritik
2.1) Quellenbeschreibung
Die Quelle ist ein historisch-kritisch abgefasster Kommentar Quintus Asconius Pedianus zu einer Rede Ciceros. Diese Rede steht im Zusammenhang mit dem Repetundenverfahren gegen Catilina im Jahre 65 v. Chr.. Die Quelle liegt in gedruckter Form vor.
2.2) Innere Kritik
2.2.1) Begriffsdefinitionen
-„Untersuchung“(Zeile 6)
Das consilium publicum ist ein frei gewähltes Gremium, das die Zulässigkeit einer Bewerbung für das Amt des Konsuls prüft.[1]
2.2.2) Sachliche Aufschlüsselung
-„Africa“ (Zeile 2)
Die römische Provinz Africa umfasste zur Zeit Catilinas das heutige Tunesien und einen Teil Algeriens. Sie war eine der wirtschaftlich bedeutendsten Provinzen im römischen Reich.[2] Der Begriff Africa ist aus der Bezeichnung des lybischen Stammes Afri abgeleitet. Nach der Zerstörung Karthagos durch den römischen Feldherrn Scipio, im Jahre 146 v. Chr., gab dieser der neu geschaffenen Provinz die Bezeichnung Africa. Unter Caesar wurde, nach dessen Sieg über Pompeius im Bürgerkrieg, die Provinz vergrößert und in Africa nova umbenannt.[3]
3. Quelleninterpretation
3.1) Inhaltsangabe
Asconius Pedianus führt aus, dass noch vor der Rückkehr Catilinas für die Bewerbung zum Konsulat, sich Gesandte beim römischen Senat über seine Statthalterschaft beschweren. Daraufhin erhebt der Senat Klage und der Konsul Lucius Volcacius Tullus beruft eine Versammlung ein, um die Bewerbung Catilinas zu prüfen. Noch bevor ein Ergebnis feststeht, zieht Catilina die Bewerbung zurück.
3.2) Einordnung in den historischen Kontext
3.2.1) Die Geschichte des Repetundenverfahrens
Auf die Kriege gegen Karthago am Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. folgten in Rom eine Reihe von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umbrüchen. Die Kriegsentschädigungszahlungen der Karthager, Antiochus und den Makedonenkönig Perseus in Höhe von rund 200 Millionen Denaren wurden meist für die Errichtung von monumentalen Bauten verwendet.[4]
Am stärksten waren die sozialen Umbrüche. Viele Familien erfuhren einen sozialen Aufstieg. Für das standesgemäße, verschwenderische Leben mussten alsbald neue Geldquellen erschlossen werden. In Folge dessen nahm die Ausbeutung der römischen Provinzen stark zu. Durch ein Verfahren versuchte der Senat dem Repetundendelikt der Statthalter Herr zu werden.[5]
[...]
[1] Drexler, Hans: Die Catilinarische Verschwörung (Darmstadt 1989) 74
[2] Gilbert, Charles-Dicard: Nordafrika und die Römer (Stuttgart 1962) 10; Huss, Werner: Africa, DNP 1 (Weimar 1997) 222f.
[3] Huss, Werner: Africa, DNP 1 (1997) 222f.
[4] In dieser Zeit erfreute sich Marmor als Baustoff größter Beliebtheit, da er den neuen Reichtum repräsentierte. Manthe/Ungern-Sternberg, 16
[5] Manthe/Ungern-Sternberg, 15ff.
- Quote paper
- Arne Ostheim (Author), 2006, „Der Repetundenprozess des Catilina“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136224