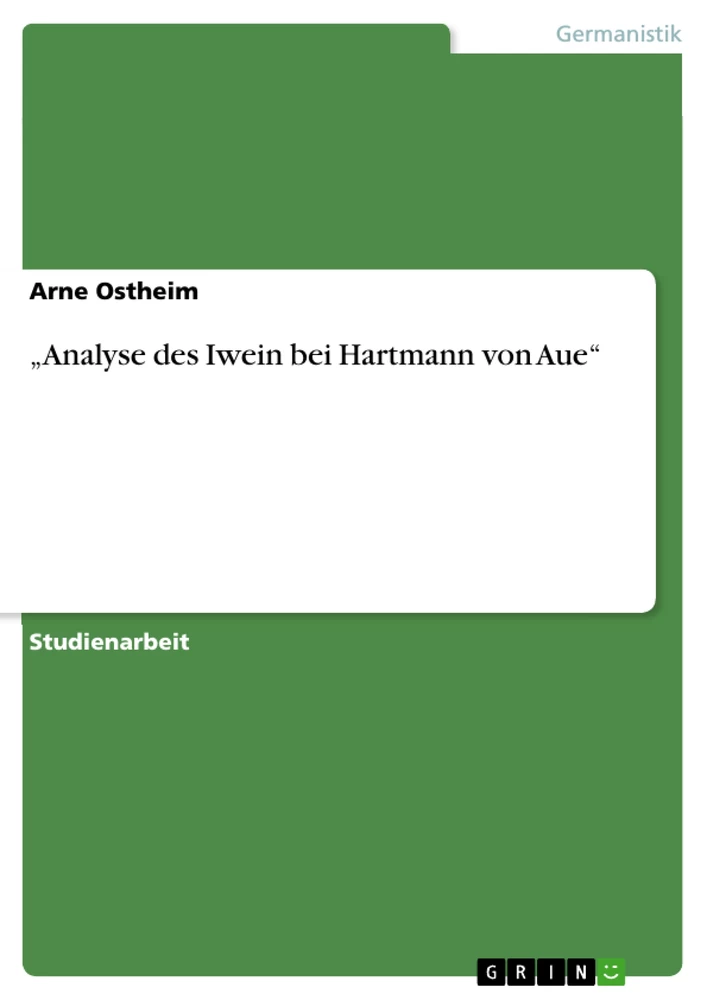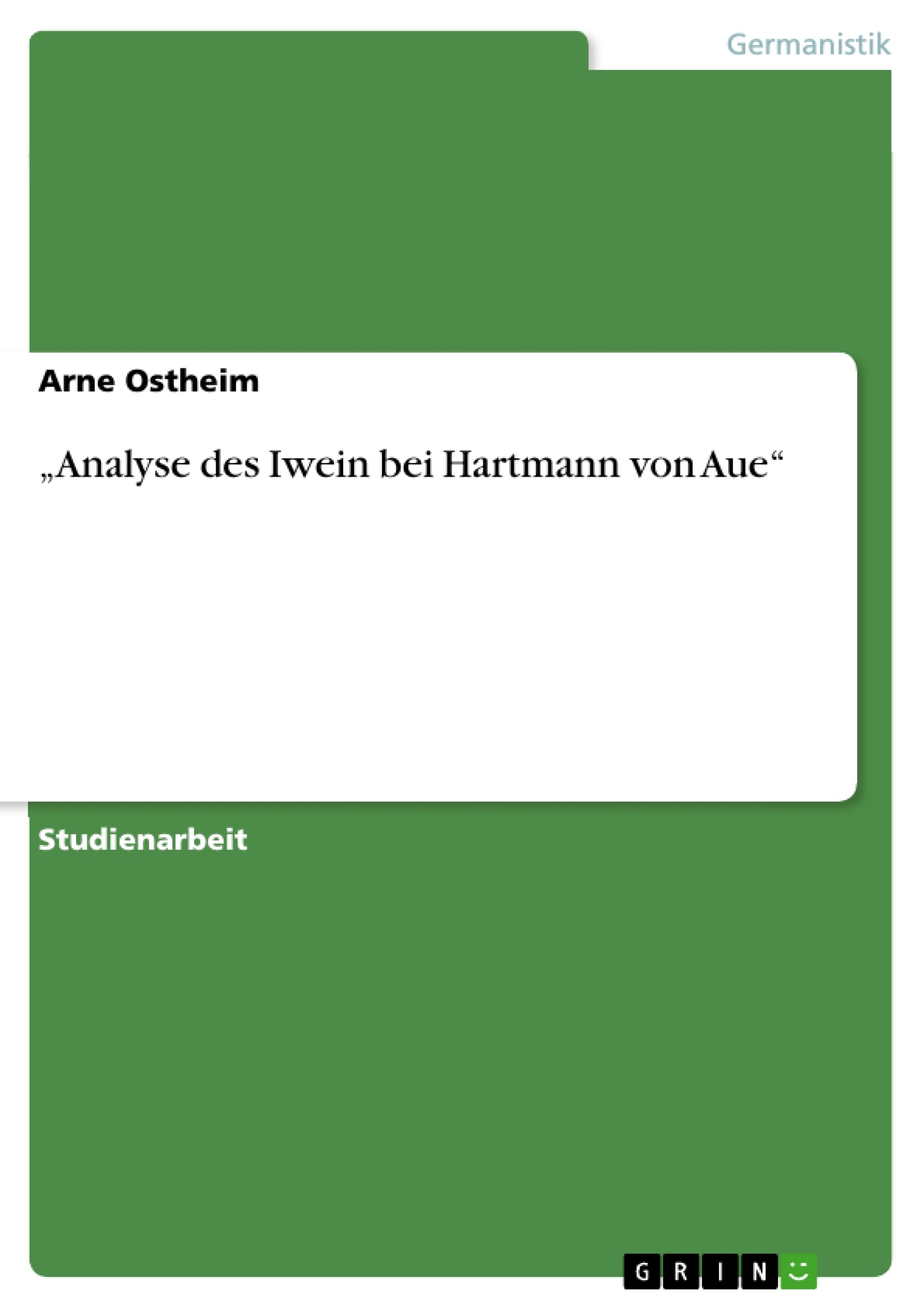1. Einleitung
Eine der frühesten deutschen Literaturepochen war die ritterlich-höfische, auch als staufisch bezeichnet, die von 1170 bis 1250 reichte. Ihre Sattelzeit hatte diese Literatur 1198, ein Jahr nach dem Tode Heinrichs VI. Jedoch mit allmählicher Zersplitterung der alten Machtverhältnisse, der damit verbundenen Zunahme der Partikulargewalten und dem Scheitern der kaiserlichen Politik in Italien kam es zu Krisen, die schwere Erschütterungen hinterließen.
Am Ende des 15. Jahrhunderts schuf der in Tirol regierende Kaiser Maximilian I. ein blühendes Handels- und Kulturzentrum, dessen Mittelpunkt In-nsbruck bildete. Im Zuge der intensiven Beschäftigung mit den überlieferten Kulturgütern wurden auch literarische Texte der von Helmut de Boor benannten „Stauferklassik“ zusammengetragen und schließlich von Hans Ried im „Ambraser Heldenbuch“ eingebunden. Hans Ried wurde in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts geboren. Eine genaue Datierung und die Bestimmung der Herkunft sind nicht möglich. Unter Maximilian I. erhielt er im Jahre 1500 ein Amt als Zöllner am Eisack zu Bozen, ehe er 1504, wegen seiner Schriftgeübtheit den Auftrag erhielt, das Ambraser Heldenbuch zu schreiben. Für diese Aufgabe wurde er von Dezember 1507 bis zum März 1514 von seinem Dienst freigestellt und an die Kanzlei des Kaisers berufen. 1514 jedoch war Ried wegen eines Augenleidens nicht mehr für den Dienst in der Kanzlei geeignet und so musste er die Arbeiten am Heldenbuch weitestgehend einstellen. Das genaue Todesdatum Rieds ist un-bekannt, jedoch kann gesagt werden, dass er vor dem 07. Mai 1516 verstarb.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse des „Iwein“
- Inhalt und Einbindung in die Biographie des Autors
- Textstruktur
- Überlieferung und Rezeption
- Vergleich von „Iwein“ und „Erec“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Stemma des Iwein
- Tabellarische Übersicht der Schriften im Ambraser Heldenbuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Hartmann von Aues „Iwein“ im Kontext des Ambraser Heldenbuchs. Ziel ist die Analyse des Werks hinsichtlich seines Inhalts, seiner Textstruktur, seiner Überlieferung und Rezeption, sowie ein Vergleich mit Hartmann von Aues „Erec“. Die Arbeit beleuchtet den Stellenwert von „Iwein“ innerhalb der höfischen Literatur des Mittelalters und im spezifischen Kontext der Sammlung Kaiser Maximilians I.
- Hartmann von Aue und seine Einbettung in die staufische Literatur
- Analyse der Textstruktur und des Inhalts von „Iwein“
- Überlieferung und Rezeption von „Iwein“
- Vergleich von „Iwein“ und „Erec“
- Der Stellenwert von „Iwein“ im Ambraser Heldenbuch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der staufischen Literatur und die Entstehung des Ambraser Heldenbuchs unter Kaiser Maximilian I. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung von Hartmann von Aues „Iwein“ innerhalb dieser Sammlung. Der Fokus liegt auf der Position des Werkes im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und seiner Rolle in der Bewahrung höfischer Traditionen.
Analyse des „Iwein“: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit Hartmann von Aues „Iwein“. Es analysiert den Inhalt des Werkes und dessen Einbindung in die Biografie des Autors, beleuchtet die Textstruktur und ordnet „Iwein“ in den Kontext anderer Artusromane ein. Die Überlieferungsgeschichte wird anhand eines Stemmas skizziert und die Rezeption des Werkes betrachtet. Das Kapitel verknüpft literarische Analyse mit historischem Kontext und erörtert die Adaption französischer Vorlagen und die Integration keltischer Elemente.
Vergleich von „Iwein“ und „Erec“: Dieser Abschnitt vergleicht die beiden Werke Hartmann von Aues, „Iwein“ und „Erec“, bezüglich ihres Inhalts, ihrer Figuren, ihrer Struktur und ihrer Rezeption. Der Vergleich soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten und die Entwicklung des Autors verdeutlichen. Es wird analysiert, inwieweit beide Romane das höfisch-ritterliche Ideal repräsentieren und wie sie sich in ihren jeweiligen Darstellungen unterscheiden.
Schlüsselwörter
Hartmann von Aue, Iwein, Erec, Ambraser Heldenbuch, Stauferklassik, höfische Literatur, Artusroman, Minne, Rittertum, Mittelalter, Maximilian I.
FAQ: Hartmann von Aues "Iwein" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Hartmann von Aues "Iwein" im Kontext des Ambraser Heldenbuchs. Der Fokus liegt auf Inhalt, Textstruktur, Überlieferung, Rezeption und einem Vergleich mit Hartmann von Aues "Erec". Die Arbeit beleuchtet den Stellenwert von "Iwein" in der höfischen Literatur des Mittelalters und im Kontext der Sammlung Kaiser Maximilians I.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Hartmann von Aue und seine Einbettung in die staufische Literatur; Analyse der Textstruktur und des Inhalts von "Iwein"; Überlieferung und Rezeption von "Iwein"; Vergleich von "Iwein" und "Erec"; Der Stellenwert von "Iwein" im Ambraser Heldenbuch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, eine Analyse von "Iwein" (inkl. Inhalt, Textstruktur, Überlieferung und Rezeption), einen Vergleich von "Iwein" und "Erec", ein Fazit, ein Literaturverzeichnis und einen Anhang (mit Stemma des Iwein und tabellarischer Übersicht der Schriften im Ambraser Heldenbuch).
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der staufischen Literatur und die Entstehung des Ambraser Heldenbuchs. Sie führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von "Iwein" innerhalb dieser Sammlung, mit Fokus auf der Position des Werkes im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit und seiner Rolle in der Bewahrung höfischer Traditionen.
Wie wird "Iwein" in der Arbeit analysiert?
Das Kapitel zur Analyse von "Iwein" untersucht den Inhalt und dessen Einbindung in die Biografie des Autors, beleuchtet die Textstruktur, ordnet "Iwein" in den Kontext anderer Artusromane ein, skizziert die Überlieferungsgeschichte anhand eines Stemmas und betrachtet die Rezeption des Werkes. Es verknüpft literarische Analyse mit historischem Kontext und erörtert die Adaption französischer Vorlagen und die Integration keltischer Elemente.
Worauf konzentriert sich der Vergleich von "Iwein" und "Erec"?
Der Vergleich von "Iwein" und "Erec" konzentriert sich auf Inhalt, Figuren, Struktur und Rezeption beider Werke. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und die Entwicklung des Autors zu verdeutlichen. Analysiert wird, inwieweit beide Romane das höfisch-ritterliche Ideal repräsentieren und wie sie sich in ihren jeweiligen Darstellungen unterscheiden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hartmann von Aue, Iwein, Erec, Ambraser Heldenbuch, Stauferklassik, höfische Literatur, Artusroman, Minne, Rittertum, Mittelalter, Maximilian I.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Arne Ostheim (Author), 2007, „Analyse des Iwein bei Hartmann von Aue“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136222