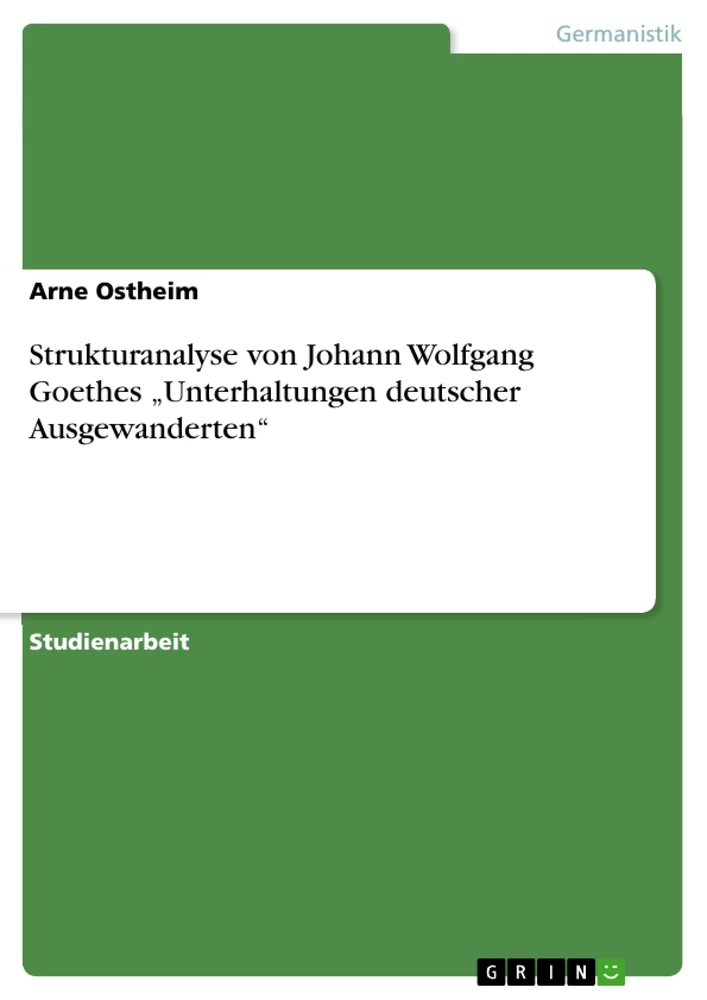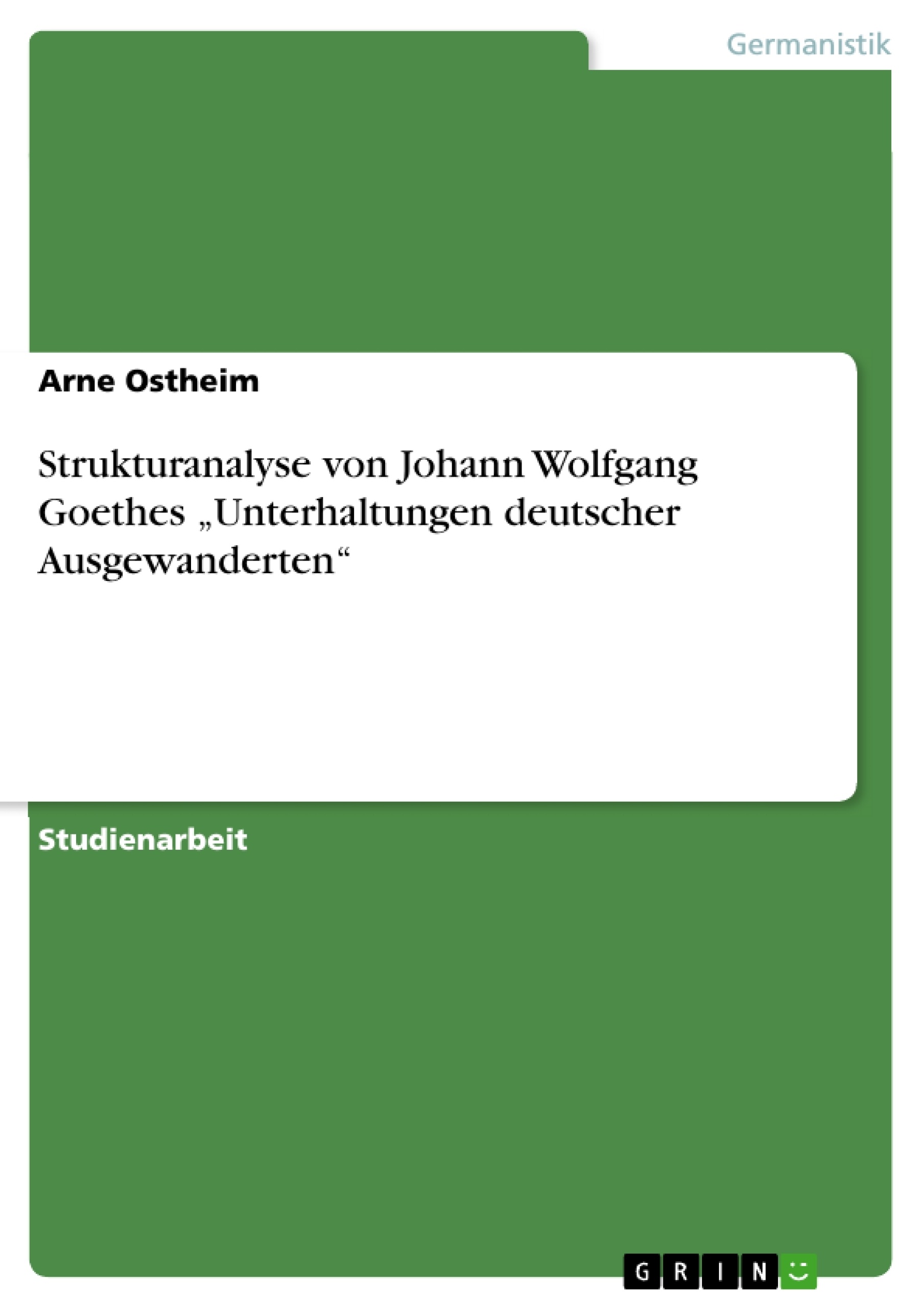Der Novellenzyklus „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ von Johann Wolfgang Goethe erschien zuerst 1795 in der Zeitschrift „Horen“ von Friedrich Schiller.
Beim ersten Lesen gestaltet sich der Text gegliedert und gut überschaubar. Recht schnell wird klar, dass es verschiedene Ebenen des Erzählens gibt. Den Abschluss bildet das Märchen, dessen Umfang ähnlich dem der Rahmenerzählung ist.
Inhaltlich geht es um eine sozial gehobene Gesellschaft, die während des ersten Koalitionskrieges vor den französischen Revolutionstruppen die Flucht ergreift und sich auf einem Gut einrichtet. Nach einem Zerwürfnis politischer Art, beginnt die Gesellschaft Geschichten zu erzählen.
Es soll in dieser Arbeit eine erzähltheoretische Analyse unter Heranziehung des Textes vorgenommen werden, um die Zusammenhänge zwischen den Erzählungen der Figuren und der Gesellschaft selbst zu beleuchten.
Die Erzählung wird einer systematischen Analyse durch die von Martinez und Scheffel angesprochenen Kategorien unterzogen. Auf eine vergleichbare Analyse der einzelnen Binnenerzählungen kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.
Anschließend soll unter Hinzunahme von Sekundärliteratur untersucht werden, inwiefern eine Beeinflussung von Rahmen- und Binnenerzählung statt-findet und bilanziert werden.
Abschließend soll betrachtet werden, was die erzähltechnische Analyse leistet und wie die Ergebnisse zu bewerten sind. Zusätzlich soll die Intention Goethes in Betracht gezogen und noch andere Interpretationsmöglichkeiten vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Erzähltechnische Analyse
2.1) Zeit
2.1.1) Ordnung
2.1.2) Dauer
2.1.3) Frequenz
2.2) Modus
2.2.1) Distanz
2.2.2) Fokalisierung
2.3) Stimme
2.3.1) Zeitpunkt des Erzählens
2.3.2) Ort des Erzählens
2.3.3) Stellung des Erzählers zum Geschehen
2.3.4) Subjekt und Adressat des Erzählers
3.) Interpretation
4.) Fazit
5.) Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Novellenzyklus „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ von Johann Wolfgang Goethe erschien zuerst 1795 in der Zeitschrift „Horen“ von Friedrich Schiller.[1]
Beim ersten Lesen gestaltet sich der Text gegliedert und gut überschaubar. Recht schnell wird klar, dass es verschiedene Ebenen des Erzählens gibt. Den Abschluss bildet das Märchen, dessen Umfang ähnlich dem der Rahmenerzählung ist.
Inhaltlich geht es um eine sozial gehobene Gesellschaft, die während des ersten Koalitionskrieges vor den französischen Revolutionstruppen die Flucht ergreift und sich auf einem Gut einrichtet. Nach einem Zerwürfnis politischer Art, beginnt die Gesellschaft Geschichten zu erzählen.
Es soll in dieser Arbeit eine erzähltheoretische Analyse unter Heranziehung des Textes vorgenommen werden, um die Zusammenhänge zwischen den Erzählungen der Figuren und der Gesellschaft selbst zu beleuchten.
Die Erzählung wird einer systematischen Analyse durch die von Martinez und Scheffel angesprochenen Kategorien unterzogen.[2] Auf eine vergleichbare Analyse der einzelnen Binnenerzählungen kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.
Anschließend soll unter Hinzunahme von Sekundärliteratur untersucht werden, inwiefern eine Beeinflussung von Rahmen- und Binnenerzählung stattfindet und bilanziert werden.
Abschließend soll betrachtet werden, was die erzähltechnische Analyse leistet und wie die Ergebnisse zu bewerten sind. Zusätzlich soll die Intention Goethes in Betracht gezogen und noch andere Interpretationsmöglichkeiten vorgestellt werden.
2. Erzähltechnische Analyse
2.1) Zeit
2.1.1) Ordnung
Die Frage nach der Reihenfolge des Erzählten in der Rahmenerzählung ist recht einfach zu beantworten. Es liegt eine „lineare Verbindung der Segmente“[3] vor, das heißt, dass die Erzählung streng chronologisch ist und es keine Vorausdeutungen auf die weitere Rahmenerzählung gibt.[4]
Der Ablauf der Handlung ist recht einfach zusammenzufassen:
- Die Baronesse flieht mit ihrer Familie vor der herannahenden französischen Armee auf ihr rechtsrheinisches Gut.[5]
- Vetter Karl und der Geheimrat überwerfen sich aufgrund verschiedener politischer Auffassungen.[6]
- Zur Ablenkung von der Politik beginnt die Gesellschaft Geschichten zu erzählen, die die Gesellschaft zu Diskussionen anregen.
- Am Ende findet sich das politische Thema in der Rahmenerzählung nicht mehr wieder.
Eine Unterscheidung zwischen der Chronologie (histoire) und der durch den Erzähler bestimmten Anordnung (discours)[7] der Erzählung ist nicht notwendig, da diese hier einander entsprechen.
2.1.2) Dauer
Die Rahmenhandlung wird dadurch ausgezeichnet, dass in dem Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit sowohl die Raffung, als auch die Szene auftritt.
Während bei der Raffung die Erzählzeit kürzer als das beschriebene Geschehen ist, beinhaltet die szenische Darstellung
[e]ine annähernde Übereinstimmung von Erzählzeit und erzählter Zeit […], wenn nicht mehr erzählt, sondern szenisch dargestellt wird, das heißt, wenn z.B. in einer Dialogszene die Figurenrede ohne Auslassungen oder Erzählereinschübe wörtlich wiedergegeben wird.[8]
Mit zunehmendem Voranschreiten der Rahmenerzählung wird das Szenische gegenüber der Raffung, die zum Ende hin nur noch sporadisch auftritt, dominanter.[9] Das allmähliche Übergewicht der Szene lässt den Schluss zu, dass der Erzähler die Handlung laufen lässt.
Zudem ist noch anzumerken, dass in der Rahmenhandlung, wie schon unter dem Gesichtspunkt der Ordnung bemerkt, eine lineare Erzählung ohne Zeitsprünge, wie Pausen oder Ellipsen, vorliegt.
2.1.3) Frequenz
Versucht man eine Bestimmung des
Verhältnis[ses] zwischen der Zahl der Wiederholungen eines Ereignisses im Rahmen des erzählten Geschehens und der Zahl der Wiederholungen seiner Darstellung im Rahmen der Erzählung,[10]
so ist festzustellen, dass in der Rahmenerzählung keine Wiederholungsschleifen auftreten.
Es wird nur einmal ein Thema, das des Schreibtisches, der auf mysteriöse Weise zerbarst[11], wieder aufgegriffen. Die Aufklärung des mysteriösen Ereignisses erfolgte erst am Schluss der Rahmenhandlung.[12]
Das Erzählen über jenes Ereignis ist jedoch nicht mit der Frequenz zu greifen, wenn auch die singulative Frequenzform am wahrscheinlichsten ist. Bei näherer inhaltlicher Betrachtung handelt es sich lediglich um eine Klärung der Gesamtumstände.
[...]
[1] Pickerodt Gerhart: Seriale Momente in Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewan- derten. In: Endlose Geschichten. Serialität in den Medien. Hrsg. von Günter Giesenfeld. Hildesheim. Georg Olms Verlag. S.26; Koch, Hans-Albrecht: Zum Wechselspiel von Rahmen- und Binnenerzählung in der Geschichte vom Prokurator in Goethes Unterhal- tungen deutscher Ausgewanderten. In: Annali Goethe (Roma) (2001). S.117; Goethe, Johann Wolfgang: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Reclam, Stuttgart 1991. S.125
[2] Martinez, Matias, Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. Verlag C.H. Beck, München 1999.
[3] Pickerodt, S.26
[4] Martinez/Scheffel, S.32f.
[5] Goethe, Johann Wolfgang: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Reclam, Stutt- gart 1991. S.3f.
[6] Goethe, S.11ff.
[7] Martinez/Scheffel, S.23
[8] Martinez/Scheffel, S.39
[9] Neben den Seiten 13-17 und 22-24, stehen die Dialoge der Figuren ab der Geschichte des Prokurators (S.65ff.) nahezu ausschließlich in der szenischen Form.
[10] Martinez/Scheffel, S.45
[11] Der zerberstende Schreibtisch ist der Höhepunkt des Gruselns, nachdem die Spukge- schichten von der Sängerin Antonelli und über das rätselhafte Klopfen vorhergingen. Goethe, S.38
[12] Goethe, S.88
- Quote paper
- Arne Ostheim (Author), 2005, Strukturanalyse von Johann Wolfgang Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136220