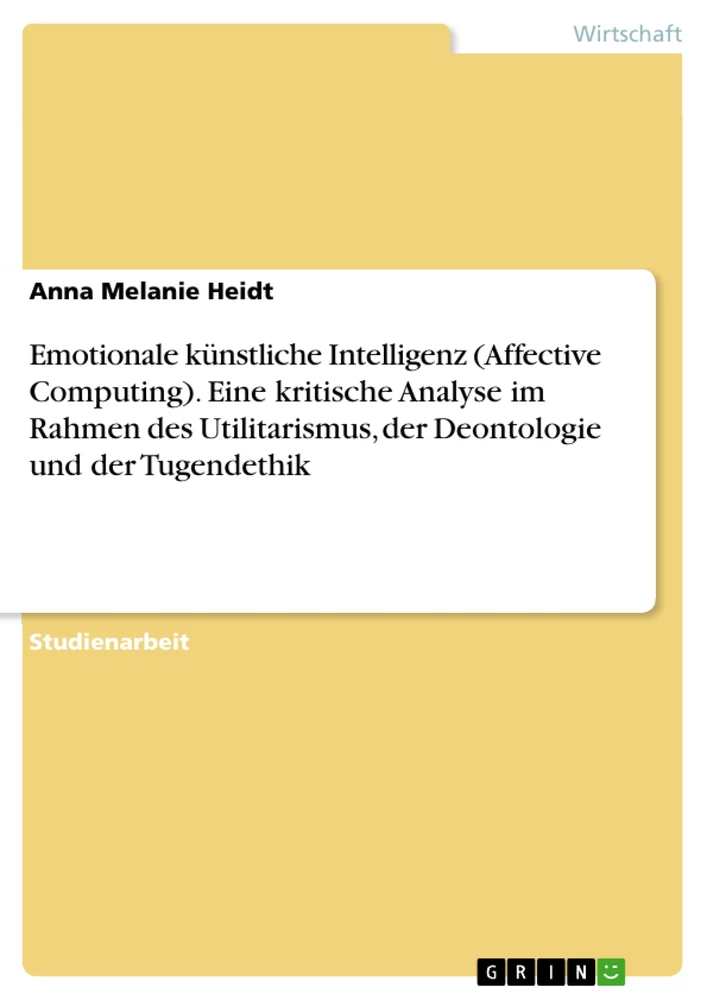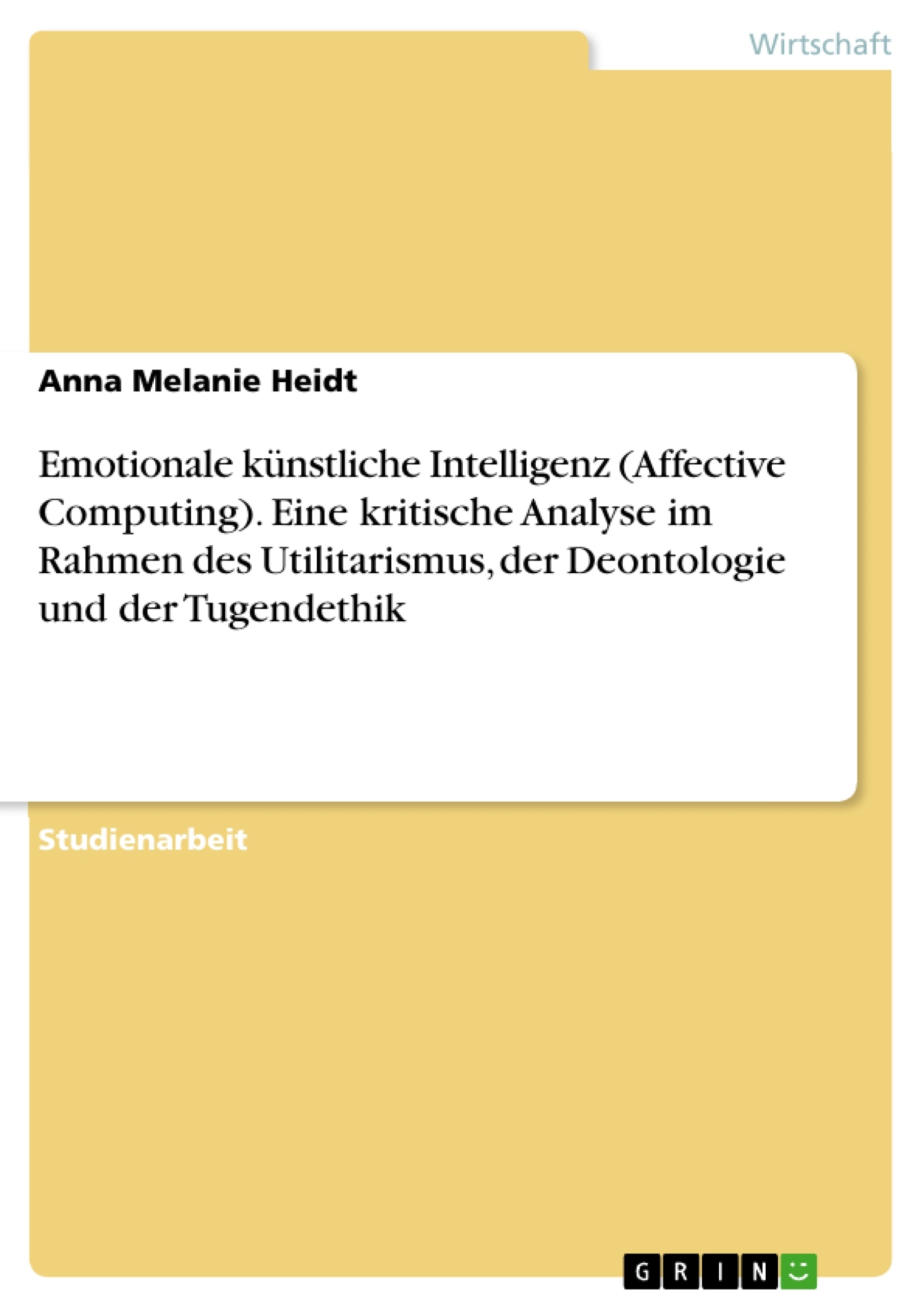Das Ziel dieser Seminararbeit ist es, die ethischen Aspekte der Emotionalen Künstlichen Intelligenz genauer zu durchleuchten und zu hinterfragen.
Künstliche Intelligenz (kurz auch KI) ist eine Thematik, die insbesondere im Zuge der Digitalisierung in der heutigen Gesellschaft zunehmend präsenter wird und in immer mehr Einsatzgebieten gegenwärtig ist. Jedoch beschäftigen sich mittlerweile nicht mehr nur ausschließlich Unternehmen, sondern auch immer mehr Privatpersonen verstärkt mit diesem Thema. Teilweise aus freien Stücken, jedoch auch zum Teil zwangsläufig, da die KI inzwischen aus dem Alltagsleben kaum noch wegzudenken ist. Sei es der in vielen Haushalten vorzufindende Cloud-basierte Sprachassistent "Alexa", Gesichtserkennungssoftwares, wie beispielsweise die "Face-ID"-Funktion von Apple, um das Smartphone zu entsperren, oder "Smart Home-Systeme", welche beispielsweise Einkäufe basierend auf individuellen Konsumpräferenzen im Supermarkt vorbestellen oder auch die Fotovoltaikanlage auf Dächern bedarfsgerecht steuern können.
So erleichtert KI einerseits zwar zunehmend das alltägliche Leben und auch auf Unternehmensebene, auf welcher viele Abläufe mittlerweile schneller und qualitativ besser geworden sind, jedoch stellt sich dabei auch andererseits gleichzeitig immer mehr die Frage, welche Daten gesammelt werden und inwieweit dies noch selbst zu steuern ist. Dennoch schreitet der Siegeszug der künstlichen Intelligenz unaufhaltsam fort und dringt mehr und mehr in Bereiche, die bislang dem Menschen vorbehalten zu sein schienen, vor. So ist eine Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz, die Emotionale Künstliche Intelligenz (kurz EKI). Große Unternehmen wie Apple, Amazon oder Google beschäftigen sich bereits schon seit Jahren mit Emotions-KI beziehungsweise dem sogenannten Affective Computing.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Künstliche Intelligenz
- Emotionale Künstliche Intelligenz (Affective Computing)
- Einsatzgebiete Emotionaler Künstlicher Intelligenz
- Pflege und Medizin
- Automobilbranche
- Ethische Betrachtungsweisen
- Folgenethik/ Utilitarismus
- Pflichtenethik/ Deontologie
- Tugendethik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der Emotionalen Künstlichen Intelligenz (EKI), auch bekannt als Affective Computing. Sie analysiert kritisch die Einsatzmöglichkeiten und ethischen Herausforderungen, die mit der Entwicklung und Anwendung von EKI verbunden sind.
- Definition und Funktionsweise der EKI
- Analyse der Einsatzgebiete von EKI in verschiedenen Sektoren
- Ethische Bewertung von EKI im Kontext des Utilitarismus, der Deontologie und der Tugendethik
- Identifizierung potenzieller Risiken und Chancen von EKI
- Diskussion der ethischen Implikationen von EKI für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Emotionalen Künstlichen Intelligenz (EKI) ein und erläutert die Bedeutung der Thematik im Kontext der aktuellen technologischen Entwicklungen.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der EKI, indem es die Konzepte der Künstlichen Intelligenz (KI) und der EKI definiert und verschiedene Einsatzgebiete von EKI erläutert. Es werden Beispiele aus der Pflege und der Automobilbranche vorgestellt, um die breite Anwendbarkeit von EKI zu verdeutlichen.
- Ethische Betrachtungsweisen: Dieses Kapitel untersucht die ethischen Implikationen von EKI aus verschiedenen Perspektiven. Es analysiert die Folgenethik (Utilitarismus), die Pflichtenethik (Deontologie) und die Tugendethik in Bezug auf die Entwicklung und Anwendung von EKI. Es werden verschiedene ethische Dilemmata und ihre möglichen Lösungsansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Emotionale Künstliche Intelligenz, Affective Computing, Utilitarismus, Deontologie, Tugendethik, Ethische Implikationen, Risiken und Chancen, Einsatzgebiete, Pflege, Medizin, Automobilbranche.
- Quote paper
- Anna Melanie Heidt (Author), 2023, Emotionale künstliche Intelligenz (Affective Computing). Eine kritische Analyse im Rahmen des Utilitarismus, der Deontologie und der Tugendethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1361096