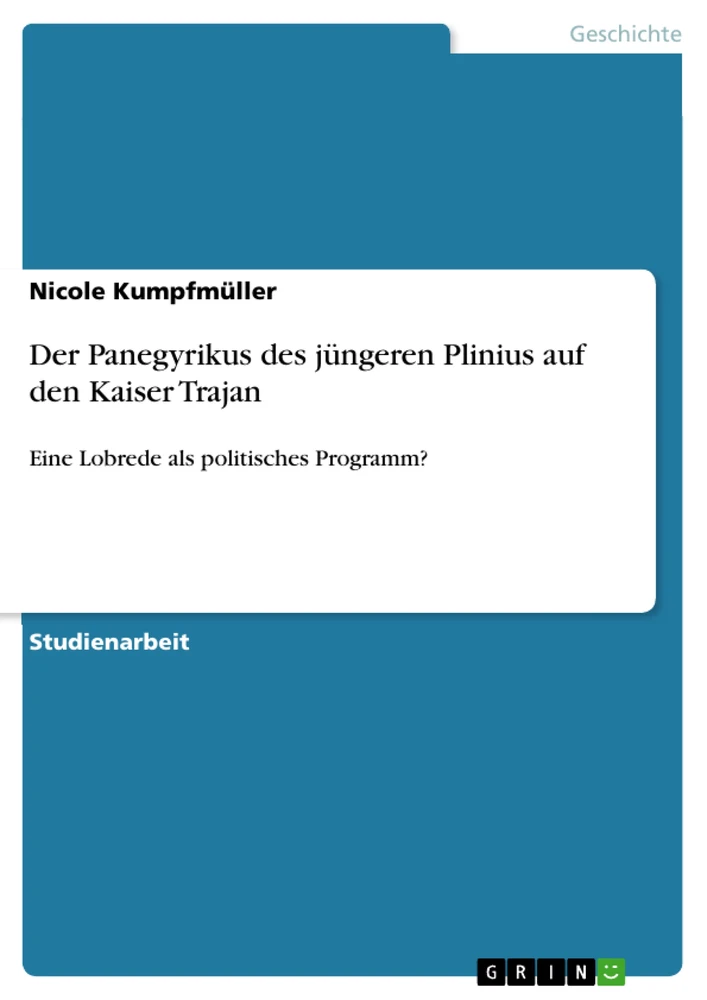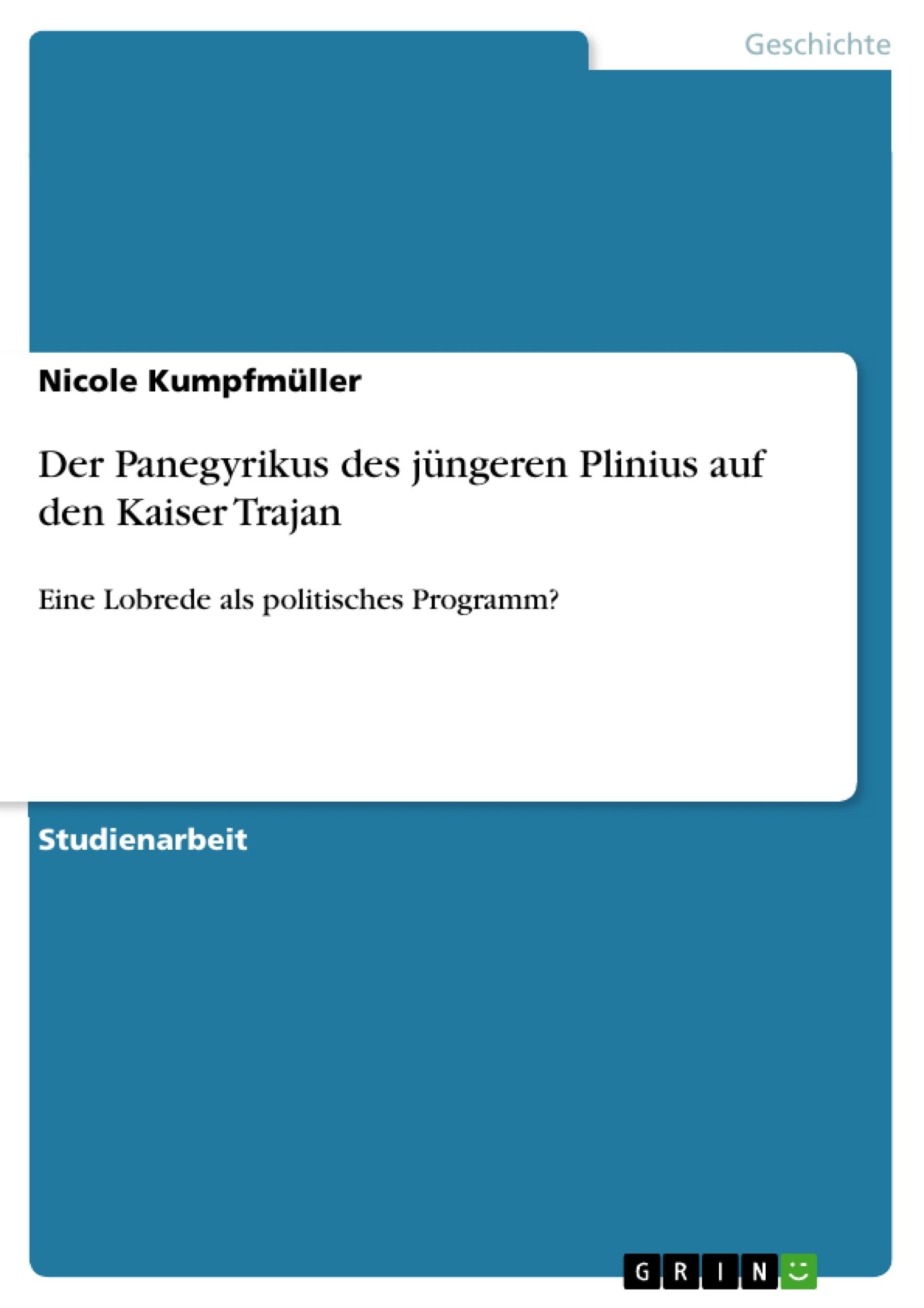Am ersten September des Jahres 100 n. Chr. tritt der Senator Gaius Plinius Caecilius Secundus, kurz Plinius der Jüngere, im Alter von 38 Jahren das Amt des Suffektkonsulats an und krönt somit seine außergewöhnliche und bemerkenswerte Ämterlaufbahn. Aus diesem Anlass hielt er, dem Brauch entsprechend und im Namen des Staates, an seinem ersten Amtstag vor dem vollständig versammelten Senat von Rom und dem ebenfalls anwesenden Kaiser Marcus Ulpius Trajanus eine Dankesrede, die uns als Panegyrikus überliefert ist.
Um ein Grundverständnis der literarischen Gattung „Panegyrikus“ zu schaffen, soll eine kurze Definition hilfreich sein: in der Spätantike wird der Panegyrikus als eine Lobrede auf den Kaiser bezeichnet. Dabei sollte man dennoch unterscheiden, dass der Begriff Panegyrikus nicht jeden Text lobenden Inhalts integriert, sondern ihn auf das Lob gesellschaftlicher Instanzen (z.B. Städte) festlegt. Lobreden können oft auch Tadelreden sein, da sie das Gegenbild darstellen, um das Ideal zu verdeutlichen. Auf diese Weise verurteilt auch Plinius mit dem Lob an Trajan den ehemaligen Kaiser Titus Flavius Domitianus.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HAUPTTEIL
- PANEGYRIKUS DES PLINIUS AUF DEN KAISER TRAJAN
- Redesituation
- Inhalt und Aufbau
- FUNKTION
- Der Panegyrikus als persönliche Mission?
- Der Panegyrikus als aktuelle Herrschaftsdarstellung und Zukunftsprogramm...
- Plinius' Absichten.......
- PANEGYRIKUS DES PLINIUS AUF DEN KAISER TRAJAN
- SCHLUSS
- LITERATUR...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Panegyrikus des Plinius, eine Lobrede auf Kaiser Trajan, die Plinius im Jahr 100 n. Chr. anlässlich seines Suffektkonsulats hielt. Ziel ist es, den Inhalt und Aufbau des Textes zu untersuchen und die Funktion der Rede im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 1. Jahrhunderts n. Chr. zu ergründen. Dabei werden insbesondere die Absichten des Autors, die Beziehung zwischen Plinius und Trajan sowie die Rezeption des Panegyrikus in der Forschung berücksichtigt.
- Die Rede als Ausdruck von Dankbarkeit und Loyalität gegenüber Kaiser Trajan
- Die Rolle des Panegyrikus als Instrument der Herrschaftslegitimation
- Die Beziehung zwischen Plinius und Trajan und die politischen Intentionen des Autors
- Die Funktion des Panegyrikus als literarische Gattung und seine Bedeutung für die Geschichte der römischen Literatur
- Die Rezeption des Panegyrikus in der Forschung und seine Bedeutung für das Verständnis der römischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Panegyrikus und das Konzept der literarischen Gattung dar. Es wird die politische Situation Roms unter Kaiser Trajan beleuchtet und die Bedeutung des Panegyrikus für das Verständnis der römischen Herrschaftsform hervorgehoben. Außerdem werden die Intentionen des Autors Plinius und seine Position im römischen Staatssystem erläutert.
Im Hauptteil wird der Panegyrikus selbst analysiert. Der erste Abschnitt beleuchtet die Redesituation, den Inhalt und den Aufbau des Textes. Der zweite Abschnitt widmet sich der Funktion des Panegyrikus im Hinblick auf die politischen Ziele des Autors und die Rezeption der Rede durch die Zeitgenossen.
Schlüsselwörter
Panegyrikus, Plinius der Jüngere, Kaiser Trajan, römische Geschichte, Herrschaftslegitimation, politische Rhetorik, literarische Gattung, Geschichte der römischen Literatur
- Citar trabajo
- Nicole Kumpfmüller (Autor), 2009, Der Panegyrikus des jüngeren Plinius auf den Kaiser Trajan, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136051