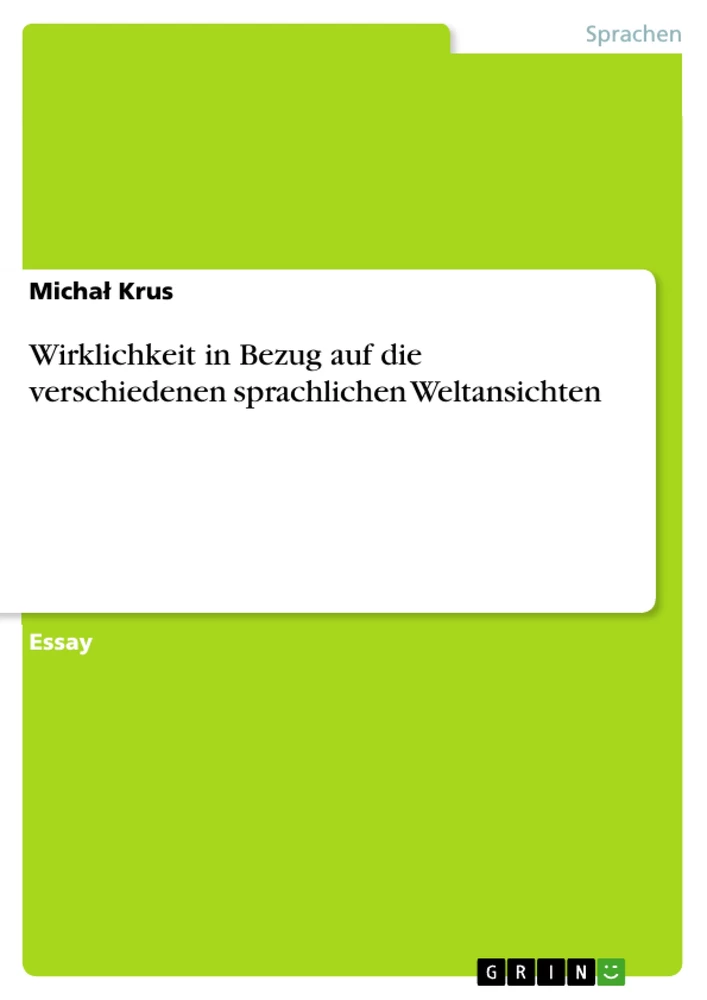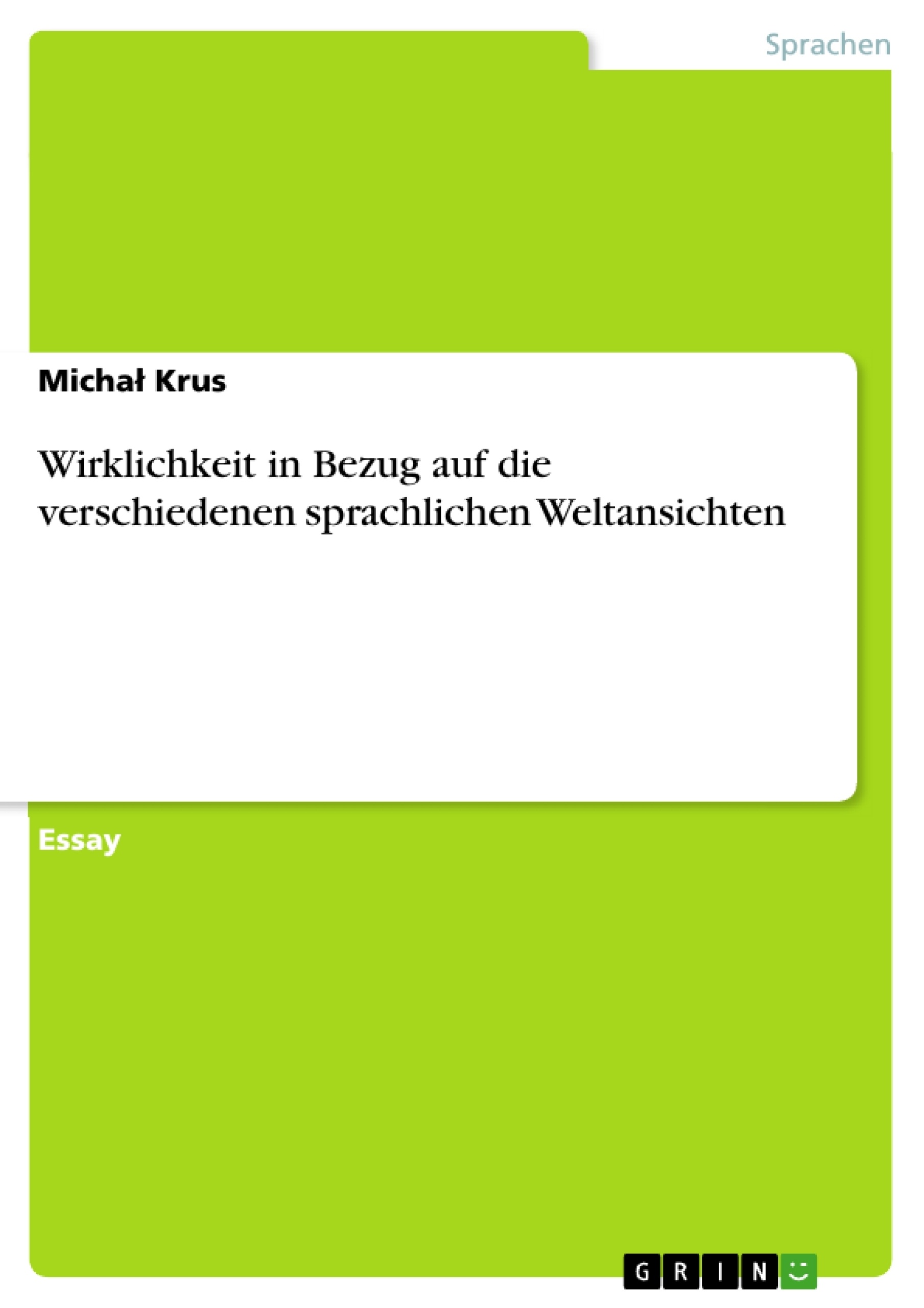Leitend möchte ich mich gleich mit Humboldts Worten bedienen: „Wie das Denken in seinen menschlichsten Beziehung eine Sehnsucht aus dem Dunkel nach dem Licht, aus der Beschränkung nach der Unendlichkeit ist, so strömt der Laut aus der Tiefe der Brust nach außen, und findet einen ihm wundervoll angemessenen, vermittelnden Stoff in der Luft, dem feinsten und am leichtesten bewegbaren aller Elemente, dessen Scheinbare Unkörperlichkeit dem Geiste auch sinnlich entspricht.“ (Humboldt (1836): s.51). Die zitierte Metapher kann als eine Zusammenfassung von Humboldts sprachlicher Philosophie fungieren. Es impliziert den Hauptgedanken, dass Sprache und Geist eine Einheit bilden. Außerdem wird mit den Wörtern, mehr oder weniger direkt, das menschliche Wesen in Hinsicht auf die Sprache charakterisiert. Es strebt nach Selbstverwirklichung, nach Unsterblichkeit, nach Nähe zu anderen Menschen. Sprache dient dazu, die Wünsche zu verwirklichen, deswegen wird Kommunikation zu den Grundbedürfnissen des Menschen gezählt. Ein weiterer Aspekt ist damit verbunden. Menschen sind gesellschaftliche Wesen, die während des Sozialisationsprozesses ihre sprachlichen Fähigkeiten erlernen und immer wieder verbessern können.
In der vorliegenden Arbeit werde ich versuchen, die schon von mir erwähnten Aspekte von Humboldts Sprachphilosophie, ausführlicher zu betrachten, um mich im Anschluss mit dem Problem der Wirklichkeit in Bezug auf die verschiedenen sprachlichen Weltansichten auseinanderzusetzen.
Leitend möchte ich mich gleich mit Humboldts Worten bedienen: „Wie das Denken in seinen menschlichsten Beziehung eine Sehnsucht aus dem Dunkel nach dem Licht, aus der Beschränkung nach der Unendlichkeit ist, so strömt der Laut aus der Tiefe der Brust nach außen, und findet einen ihm wundervoll angemessenen, vermittelnden Stoff in der Luft, dem feinsten und am leichtesten bewegbaren aller Elemente, dessen Scheinbare Unkörperlichkeit dem Geiste auch sinnlich entspricht.“ (Humboldt (1836): s.51). Die zitierte Metapher kann als eine Zusammenfassung von Humboldts sprachlicher Philosophie fungieren. Es impliziert den Hauptgedanken, dass Sprache und Geist eine Einheit bilden. Außerdem wird mit den Wörtern, mehr oder weniger direkt, das menschliche Wesen in Hinsicht auf die Sprache charakterisiert. Es strebt nach Selbstverwirklichung, nach Unsterblichkeit, nach Nähe zu anderen Menschen. Sprache dient dazu, die Wünsche zu verwirklichen, deswegen wird Kommunikation zu den Grundbedürfnissen des Menschen gezählt. Ein weiterer Aspekt ist damit verbunden. Menschen sind gesellschaftliche Wesen, die während des Sozialisationsprozesses[1] ihre sprachlichen Fähigkeiten erlernen und immer wieder verbessern können.
In der vorliegenden Arbeit werde ich versuchen, die schon von mir erwähnten Aspekte von Humboldts Sprachphilosophie, ausführlicher zu betrachten, um mich im Anschluss mit dem Problem der Wirklichkeit in Bezug auf die verschiedenen sprachlichen Weltansichten auseinanderzusetzen.
Um die Verbindung zum Geist herzustellen, muss man zuerst die Sprache, in Humboldts Sinne, als eine Materie in sich vorstellen. Aus den nacheinander folgenden Merkmalen kristallisiert sich dann der Zusammenhang. Strukturell erfasst, besteht die Sprache aus einzelnen Komponenten: „Die Sprache bietet uns eine Unendlichkeit von Einzelnheiten dar, in Wörtern, Regeln, Analogieen, und Ausnahmen aller Art […].“ (Humboldt (1836): s.39). Schon dieses Merkmal weist darauf hin, dass die Sprache unerfassbar ist, so wie der Geist. Weiter schreibt er: „[…] wir gerathen in nicht geringe Verlegenheit, wie wir diese Menge, die uns, der schon in sie gebrachten Anordnung ungeachtet, doch noch als verwirrendes Chaos erscheint, mit der Einheit des Bildes der menschlichen Geisteskraft in beurtheilende Vergleichung bringen sollen.“ (Humboldt (1836): s.39-40). Das erwähnte Chaos ist nur scheinbar, denn „Die Sprache, in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas beständig und in jedem Augenblicke Vorübergehendes.“ (Humboldt (1836): s.41). Jeder Mensch registriert nur einen Gewissen Teil des Systems bzw. verfügt, nach Humboldt, über ein bestimmtes Sprachvermögen, welches er benutzt, um sich zu artikulieren. Obwohl die Sprache ein ständiger Prozess ist: „Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein todtes Erzeugtes, sondern weit mehr eine Erzeugung ansehen […].“ (Humboldt (1836): s.39), kann jeder seine sprachliche Geschicklichkeit verbessern: „Das Sprachenlernen […] ist ein Wachsen des Sprachvermögens durch Alter und Übung.“ (Humboldt (1836): s.55).
Mit dem Berühmten Satz wird die sprachliche Dynamik noch klarer formuliert: „Sie selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine Tätigkeit (Energeia).“ (Humboldt (1836): s.41). Daraus kann man den direkten Bezug zum Geist herstellen. „Sie [Sprache] ist nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen.“ (Humboldt (1836): s.41). Allerdings ist dieser Gedanke nicht revolutionär. Er basiert auf dem Symbolbegriff, der schon von Aristoteles ausgeführt wurde: „Geschriebene Wörter symbolisieren gesprochene Wörter, die gesprochene Wörter wiederum symbolisieren seelische Wiederfahrnisse.“ (Eckard (2006): s. 11). Laut ermöglicht die sinnliche Wahrnehmung des Geistes, dementsprechend ist die Sprache ein Beweis für seine Existenz, denn nur so kommt er zum Vorschein. „Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken. Die intellectuelle Thätigkeit, durchaus geistig, durchaus innerlich, und gewissermaßen spurlos vorübergehend, wird durch Laut in der Rede äußerlich und wahrnehmbar für die Sinne.“ (Humboldt (1836): s.50).
[...]
[1] Die Sozialisation ist ein Prozess einschließlich seines Ergebnisses, in dem das Individuum Werte, Normen und Verhaltungsweisen erwirbt. Es dauert das ganze Leben lang, insbesondere in der Zeit der Kindheit, wenn das Kind sein Leben in der Gesellschaft beginnt.
- Quote paper
- Michał Krus (Author), 2009, Wirklichkeit in Bezug auf die verschiedenen sprachlichen Weltansichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135998