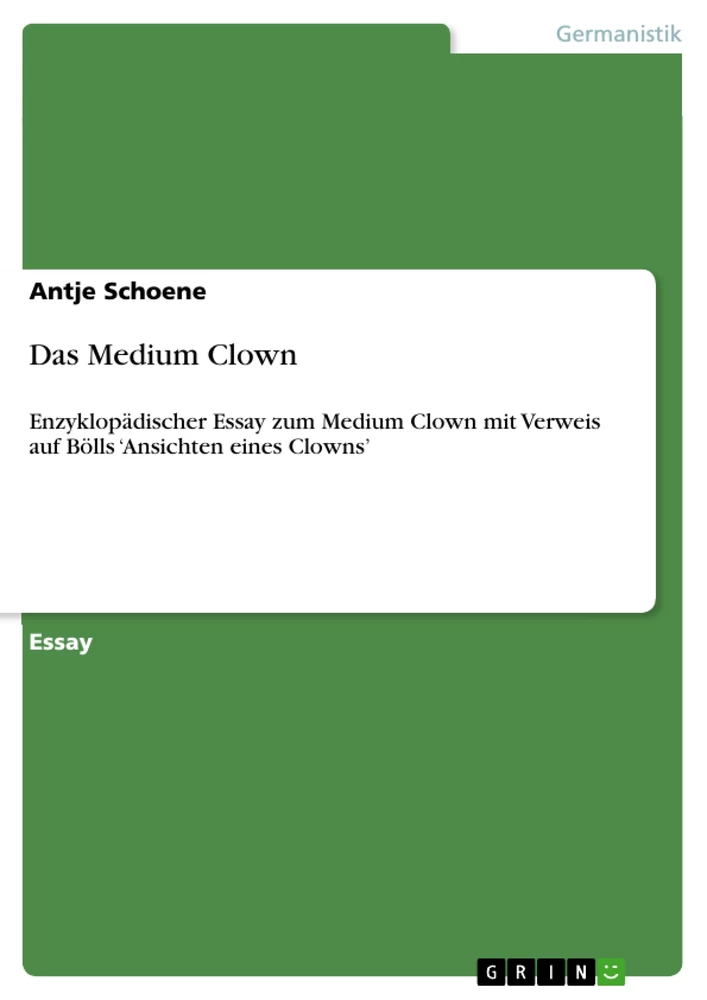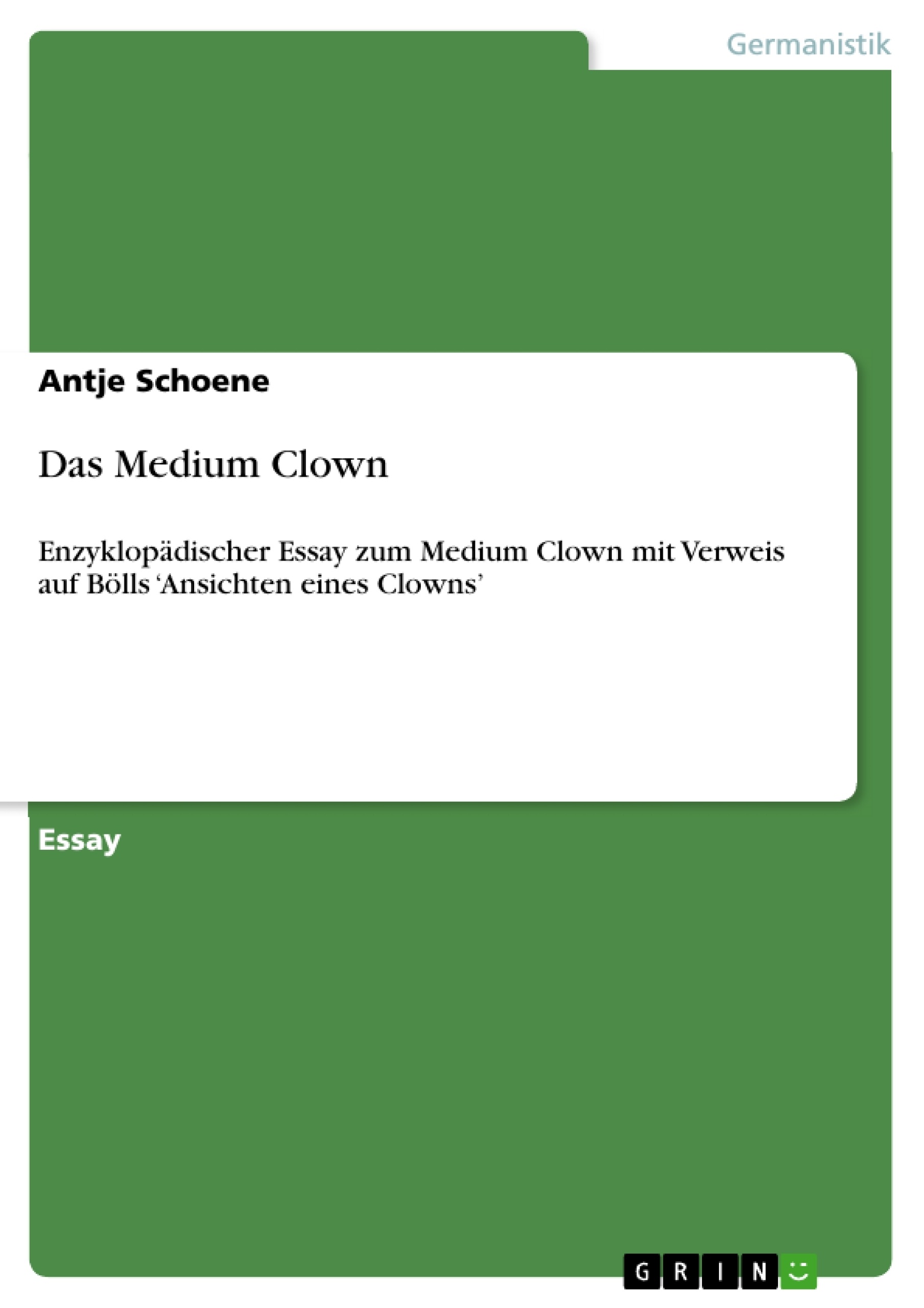Nach einer kurzen Begrifferklärung folgt eine geschichtliche Darsellung und es wird das Medium Clown in Bezug zu Heinrich Bölls 'Ansichten eines Clowns' gesetzt. Das Medium Clown: Das Wort Clown kommt aus dem Englischen, stand ursprünglich für Hanswurst oder Tölpel und ist möglicherweise abgeleitet vom lateinischen colonus, Bauer.
Schon in der Antike gab es komische Figuren im Theater. Zum einen waren sie Spötter, die sich mit ihrem beißenden Hohn gegen Obrigkeiten auflehnten, zum anderen waren sie die Verspotteten, die wegen ihres Äußeren verlacht wurden. Der Clown des Mittelalters war der Hofnarr. Bei Shakespeare beginnend entwickelte sich diese Figur als Künstler. Im Elisabethanischen Theater traten sie in Komödien als komisches Intermezzo auf, kamen in Tragödien vor oder kontrastierten das ernste Pathos der Heldenfiguren. Neben dem Hofnarr im Theater erschienen in anderen Ländern Abwandlungen in Form des weißgeschminkten, eher nachdenklichen Pierrot in Frankreich oder des Harlekin, sowie des Arlecchino in der Commedia dell'Arte, dem italienischen Stehgreiftheater. [...]
Das Medium Clown: Das Wort Clown kommt aus dem Englischen, stand ursprünglich für Hanswurst oder Tölpel und ist möglicherweise abgeleitet vom lateinischen colonus, Bauer.[1]
Schon in der Antike gab es komische Figuren im Theater. Zum einen waren sie Spötter, die sich mit ihrem beißenden Hohn gegen Obrigkeiten auflehnten, zum anderen waren sie die Verspotteten, die wegen ihres Äußeren verlacht wurden. Der Clown des Mittelalters war der Hofnarr. Bei Shakespeare beginnend entwickelte sich diese Figur als Künstler. Im Elisabethanischen Theater traten sie in Komödien als komisches Intermezzo auf, kamen in Tragödien vor oder kontrastierten das ernste Pathos der Heldenfiguren. Neben dem Hofnarr im Theater erschienen in anderen Ländern Abwandlungen in Form des weißgeschminkten, eher nachdenklichen Pierrot in Frankreich oder des Harlekin, sowie des Arlecchino in der Commedia dell'Arte, dem italienischen Stehgreiftheater.[2]
Ab dem 18. Jahrhundert wurde die Figur des Clowns zunehmend in den Zirkus verbannt, wo sie bis heute ein zentraler und nicht wegzudenkender Bestandteil des Programms ist. Hier bildeten sich bald bestimmte Typologien und dramaturgische Grundmuster aus, so etwa die Figur des Clowns in Schlabberhose mit übergroßen Schuhen und struppiger, grellfarbiger Perücke. Die Späße in Clownsnummern beziehen ihren Witz neben der vorgeführten Dummheit der Protagonisten oft aus dem Kampf mit der Tücke des Objekts oder slapstickartigen Zweikämpfen. Auch Elemente der Pantomime finden sich wieder. Mit Pantomime und nicht unbedingt mit Zirkus, wird auch der moderne Clown mit dem geschminkten Gesicht in Verbindung gebracht.[3]
Ferner wurde das Medium Film von, vor allem aus music halls[4] abgewanderten Bühnenkomikern, erobert. Die gesamte Stummfilmära und Anfänge des Tonfilms waren von clownesken Figuren geprägt. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Charlie Chaplin.[5]
Bis heute ist der Mensch mit all seinen Möglichkeiten zur Kommunikation und der Schaffung seiner Kommunikationsmittel erster Träger und Vermittler von Informationen und damit einhergehend auch Medium. Dabei fungiert er als erstes Medium vor, existiert jedoch auch innerhalb anderer, später hinzugekommener Medien. Clowns sind Artisten, deren Kunst es ist, als grotesk kostümierte, tölpelhafte oder pantomimische Gestalten, Kunststücke zu vermitteln und damit Menschen zum Staunen, Nachdenken und auch zum Lachen zu bringen. Diese Vermittlung kann in einer face-to-face-Situation vor Publikum geschehen, etwa im Zirkus oder Theater, aber auch durch neue Medien wie das Fernsehen oder neuste digitale Medien. Das Medium Clown kann allerdings auch selbst vermittelt werden, etwa auf einem Bild oder in einem Roman.
Im Folgenden soll auf den Clown im Roman Ansichten eines Clowns[6] von Heinrich Böll eingegangen werden. Bölls Roman wurde 1963 erstmals vollständig veröffentlicht. Bereits der Vorabdruck in der Süddeutschen Zeitung löste eine heftige Diskussion bezüglich seines Inhalts aus. Handlungsort des Romans ist Bonn, die Bundeshauptstadt, als Demonstrationsort der Restaurationspolitik. Die zeitliche Rahmen sind nur wenige Stunden eines Märztages des Jahres 1962. Der Roman erzählt die Geschichte eines Mannes, dessen Beziehung und Liebe zu einer Frau, und so auch er selbst, an der wertmobilen Nachkriegsgesellschaft der fünfziger und sechziger Jahre zerbricht. Der Protagonist Hans Schnier bricht mitten im restaurierten Nachkriegsdeutschland die Schule ab, wendet sich bewusst von den Traditionen seiner vom Wirtschaftswunder geprägten Familie ab und entscheidet sich gegen eine Karriere als Politiker oder Unternehmer. Er wünscht sich weder in den Apparat des väterlichen Großbetriebes noch in die Kulturorganisation der Mutter eingegliedert zu werden. Sehr früh wählt der mit hohen moralischen, jedoch vom Glauben völlig unabhängigen Werten ausgestattete junge Mann sich eine Frau: die katholische Marie Derkum. Schnier beendet sein Abitur nicht, lernt auch keinen ‚anständigen’ Beruf. Er lässt sich nicht einmal von seinem Vater eine gründliche Ausbildung als Mime bezahlen. Stattdessen beginnt er einfach so als pantomimischer Clown eine erfolgsversprechende Laufbahn, die schließlich dadurch beendet wird, dass Marie, die fünf Jahre mit ihm gelebt hat, ihn verlässt, um „Züpfner, diesen Katholiken zu heiraten“ (7). Von diesem Tag an geht es mit dem recht erfolgreichen Clown, „offizielle Berufsbezeichnung: Komiker“ (7), bergab. Schnier ergibt sich dem Alkohol und erlebt einen rasanten Abstieg.
Der Titel des Romans Ansichten eines Clowns lässt offen, ob der Clown Subjekt oder Objekt dieser Ansichten ist. In nachstehender Betrachtung soll der Clown Objekt sein. Für ihn ergeben sich drei Funktionen: der Clown als Künstler, als Außenseiter und als Kritiker.[7]
Als Künstler werden kreativ tätige Menschen auf den Gebieten der bildenden Kunst, der angewandten Kunst, der darstellenden Kunst und der Musik bezeichnet. Ein Clown bedient sich der darstellenden Kunst und leistet sowohl schauspielerische als auch pantomimische Arbeit. Die von ihm gewählte Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Empathie und psychologischem Einfühlungsvermögen, falls er seine Choreografie selbst entwickelt und auf die Interaktion mit dem Publikum eingeht.
Der Clown Hans Schnier sagt von sich: „Am besten gelingt mir die Darstellung von alltäglichen Absurditäten: ich beobachte, addiere diese Beobachtungen, potenziere sie und ziehe aus ihnen die Wurzel, aber mit einem anderen Faktor als mit dem ich sie potenziert habe.“ (102). Leidenschaftlich sieht und spielt der Clown nur diese Details, da er großen Zusammenhängen und Gefühlen misstraut.[8] Er führt Pantomimen mit Titeln wie ‚ Kardinal’, ‚Ankunft in Bonn’ oder ‚Aufsichtsratssitzung’ auf und reist damit durch Deutschland. Besonders bei und mit Marie fühlt sich Schnier als Künstler. Sie war immer stolz auf den Beruf ihres Mannes: „Und Marie sagte mit ihrem wunderbaren Pathos: ‚Mein Mann ist Künstler, ja, ein Künstler.’“ (159-160). Auch im Telefongespräch mit Kinkel bekennt er sich zu seiner clownesken Existenz und zum Künstlertum (90-96).
Dabei war Schniers Berufswahl nicht reflektiert, eher eine Art Befreiung, eine Abreaktion, wie es das Malen für den Maler ist. Sein Talent als Clown beginnt sich seit dem Tod der Schwester zu entfalten. Er wächst in den Beruf des Clowns hinein, weil es die einzige Art und Weise für ihn ist, mit seiner Umwelt zurecht zu kommen.[9] Allgemein ergibt sich aus dem beruflichen Zwang, sich immer witzig und pointiert darstellen zu müssen, für den Künstler selbst oft eine innere Anspannung, die er nicht mit in das Privatleben nehmen kann. Die extreme Trennung von beruflichem Erleben und privater Sozialisation bringt für den Clown oft eine langsame aber stetige Entfremdung mit sich, die bei fahrendem Gewerbe zusätzlich noch mit sozialer Entwurzelung außerhalb des Kollegiums einhergeht. Hans Schnier beschreibt das folgendermaßen:
„Was ein Clown braucht, ist Ruhe, die Vortäuschung von dem, was andere Leute Feierabend nennen. Aber diese anderen Leute begreifen eben nicht, daß die Vortäuschung von Feierabend für einen Clown darin besteht, seine Arbeit zu vergessen, sie begreifen es nicht, weil sie sich, was für sie wieder vollkommen natürlich ist, erst an ihrem Feierabend mit sogenannter Kunst beschäftigen. […] Die künstlerischen Menschen fangen immer genau dann von der Kunst an, wenn der Künstler gerade das Gefühl hat, so etwas wie Feierabend zu haben.“ (99-100)
Gleichzeitig ist der Clown auch Außenseiter, ein schwarzes Schaf unter einer „großen Herde von scheinbaren weißen Schafen“[10]. Hans Schnier etwa betrachtet sein Clown-Dasein als Beruf und wird zornig, wenn man ihn mit der offiziellen Berufsbezeichnung Komiker tituliert, denn unter dieser Rubrik könnte man ihn bequem von und in der Gesellschaft integrieren. Beim Clown ist das etwas heikler, aus inneren und äußeren Gründen. In Wahrheit steht ein Clown aber außerhalb der Gesellschaft, ist nirgendwo eingegliedert. Das Dasein als Clown macht die Teilnehmerschaft, beispielsweise an einer Gruppe, Religion oder Ideologie nahezu unmöglich. Weil der Clown, besonders wenn man ihn sich als wortlosen Pantomimen wie Hans Schnier vorstellt, alles immer nur affektlos von außen betrachtet und Neugierde nur in Hinsicht der technischen Schwierigkeiten zeigt, um den Vorgang möglichst exakt nachspielen zu können.[11]
Hans Schnier ist sich bewusst darüber, dass andere ihn auch als Außenseiter sehen: „Offenbar war ihr meine Existenz zwar bekannt, aber sie hatte keine klaren Anweisungen mich betreffend. Wohl nur dunkle Gerüchte im Ohr: Außenseiter, radikaler Vogel.“ (31) Und er ist vermutlich zu Recht der Meinung: „Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der einen Clown versteht, nicht einmal ein Clown versteht den anderen, da ist immer Neid oder Mißgunst im Spiel.“ (97) Er will von seinem Publikum nicht als Possenreißer begriffen werden: „Diese Leute verstehen nichts. Sie wissen zwar alle, daß ein guter Clown melancholisch sein muß, um ein guter Clown zu sein, aber daß für ihn die Melancholie eine todernste Sache ist, darauf kommen sie nicht.“ (192) Der Clown Hans Schnier „stellt sich […] als einziger Unschuldiger in einer totalen Konsumgesellschaft“[12] dar, als der einzig Normale, Ehrliche in der betrügerischen Welt. Er ist der „Verteidiger der wahren Werte“[13], der „seine Umgebung mit der ‚clownesken Phantasie’ sieht, so wie sie wirklich ist, doch keineswegs weltanschauungsfrei, sondern verknüpft mit der Vorstellung umfassender Erneuerung und Wiedergeburt.“[14]
[...]
[1] Fried, Annette und Joachim Keller. Was heißt hier Clown? In: Faszination Clown. Düsseldorf: Patmos Verlag.
1996. S. 9
[2] Vgl.: Borne, Roswitha vom dem. Der Clown. Geschichte einer Gestalt. Stuttgart: Urachhaus. 1993.
[3] Vgl.: Borne, Roswitha vom dem. Der Clown. Geschichte einer Gestalt. Stuttgart: Urachhaus. 1993.
[4] Music Halls waren Unterhaltungsstätten vor allem in London und Paris bis in die 1930er Jahre, die ihrem
Publikum ein Bühnenspektakel kombiniert mit Restaurant oder Bar anboten, manchmal auch mit der Gelegenheit, zu tanzen
[5] Fried, Annette und Joachim Keller. Als die Bilder laufen lernten. In: Faszination Clown. Düsseldorf: Patmos
Verlag. 1996. S. 60
[6] Böll, Heinrich. Ansichten eines Clowns. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 1967.
Im Folgenden werden die Quellenangaben aus diesem Werk in Form von Seitenzahlen in Klammern
erfolgen.
[7] Vgl.: Kim, Lee-Seob. Dualität, Humanität und Utopie in Heinrich Bölls Roman „Ansichten eines Clowns“.
Europäische Hochschulschriften: Reihe I – Deutsche Sprache und Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften. 1994. S. 13-22
[8] Reich-Ranicki, Marcel. In Sachen Böll – Ansichten und Aussichten. Köln/ Berlin: Kiepenheuer &Witsch.
1968. S. 25
[9] Fetscher, Irving. Menschlichkeit und Humor: Ansichten eines Clowns. In: Reich-Ranicki, Marcel (Hrg.). In
Sachen Böll – Ansichten und Aussichten. Köln/ Berlin: Kiepenheuer &Witsch. 1968. S. 280-281
[10] Kim, Lee-Seob. Dualität, Humanität und Utopie in Heinrich Bölls Roman „Ansichten eines Clowns“.
Europäische Hochschulschriften: Reihe I – Deutsche Sprache und Literatur. Frankfurt am Main: Peter
Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften. 1994. S. 13
[11] Mayer, Hans. Köln und der Clown. In: Reich-Ranicki, Marcel (Hrg.). In Sachen Böll – Ansichten und
Aussichten. Köln/ Berlin: Kiepenheuer &Witsch. 1968. S. 23-24
[12] Blamberger, Günter. Ansichten eines Clowns. In: Bellmann, Werner (Hrg.). Heinrich Böll. Romane und
Erzählungen. Stuttgart: Reclam. 2000.S. 212
[13] Blamberger, Günter. Ansichten eines Clowns. In: Bellmann, Werner (Hrg.). Heinrich Böll. Romane und
Erzählungen. Stuttgart: Reclam. 2000.S. 212
[14] Kim, Lee-Seob. Dualität, Humanität und Utopie in Heinrich Bölls Roman „Ansichten eines Clowns“.
Europäische Hochschulschriften: Reihe I – Deutsche Sprache und Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften. 1994. S. 13
- Quote paper
- Antje Schoene (Author), 2009, Das Medium Clown, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135994