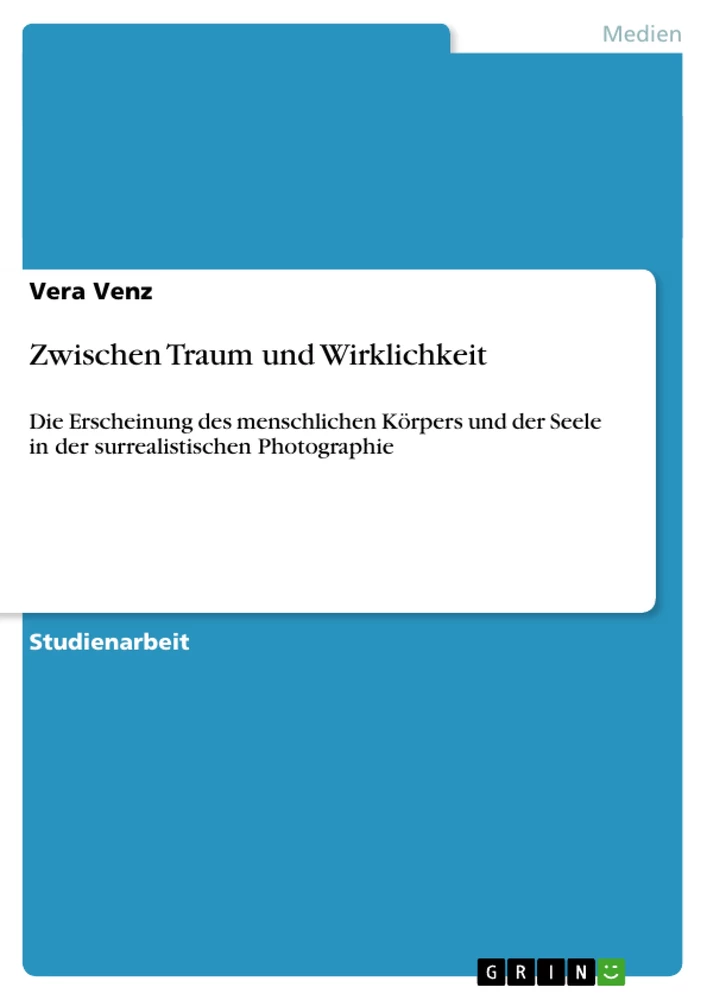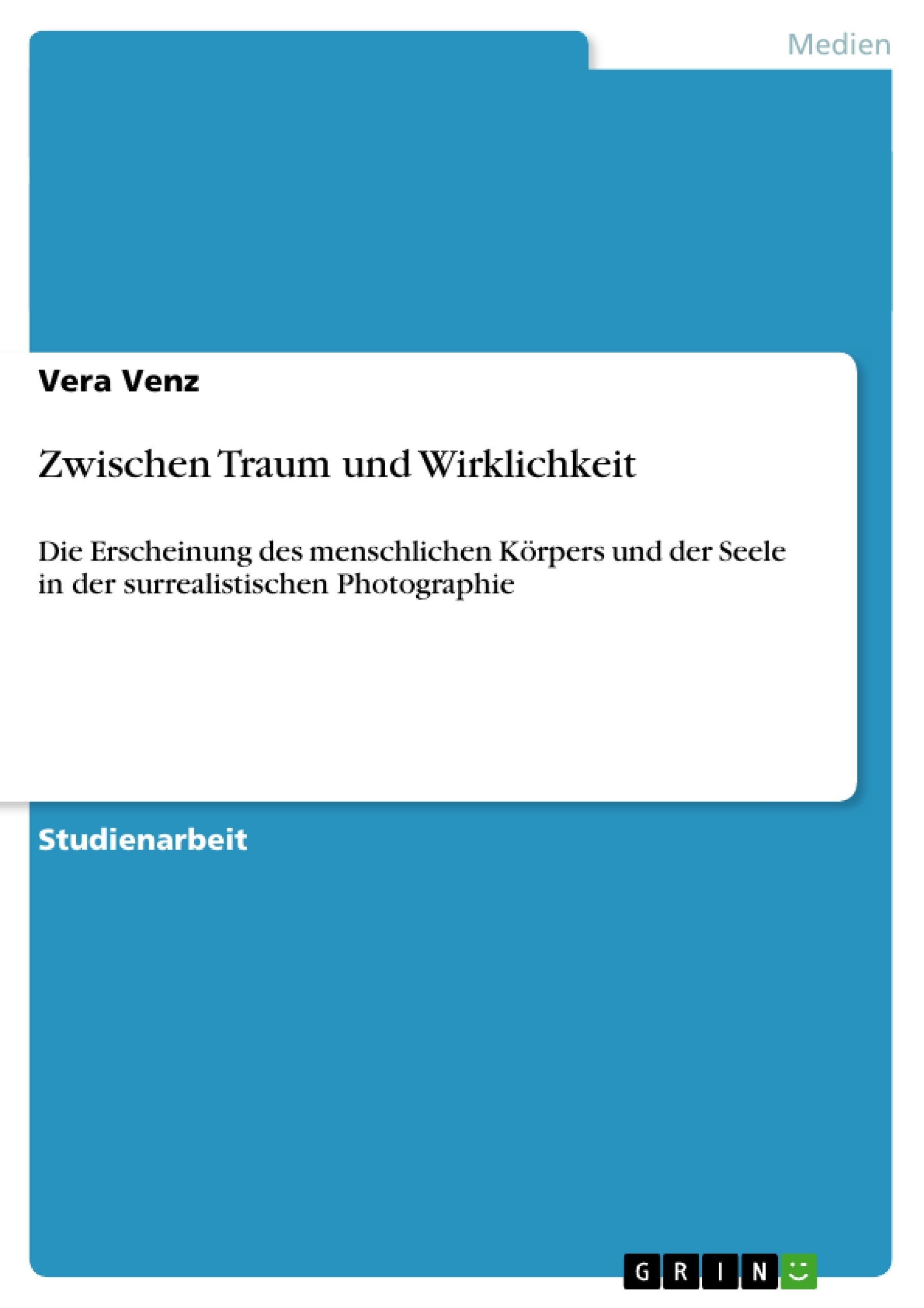Bilder sind nicht nur, wie Ornamente, mehr oder weniger komplexe visuelle Muster. Sie beziehen sich auf etwas, das sie sind oder nicht sind. Bilder sind eine besondere Art von Zeichen. Sie bieten etwas dar, sie beziehen sich auf etwas, das auf ihrer Fläche sichtbar oder unsichtbar ist.
Ein fotografisches Bild wird nicht allein dadurch zum Bild, weil es durch Gegenständen oder Körpern ausgehende Lichtreflexe verursacht wurde, sondern in dem es die Verwendung erhält, aus einer Situation auf eine andere Situation zu verweisen.
Die Surrealisten verwiesen in ihren Fotografien auf ein menschliches Erscheinungsbild, welches der gewohnten Sichtweise befremdend gegenüber steht. Durch perspektivische Verkürzung, Drehung der Horizontalachse in die Vertikale und Ausleuchtung besonderer Körperausschnitte (u.a.) entstanden Bilder von menschlichen Körpern, die nicht mehr nur als solche erkennbar waren. Sie führten den Betrachter in eine Welt der Erscheinung zwischen Traum und Wirklichkeit.
Die Darbietungen der menschlichen Gestalt blieben zwar an dessen Körper gebunden, verwandelten sich aber in der Wahrnehmung des Betrachters zu einer piktoralen Explikation von Eigenschaften, die dem Bild metaphorisch zukommt. Die Differenz zwischen der gewohnten Sichtweise auf den menschlichen Körper und seiner Bilddarbietung als Traumwesen öffnete einen Raum, der über das Geschehen auf der Fläche des Bildobjektes zu einer metaphorischen Erfahrung von Sichtweisen und Wahrnehmungen führte.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Die Erscheinungsform der Surrealität
2.1. Zum Begriff der Surrealität
2.2. Fotografie als Kunstform
3. Begriffe und Bilder
3.1. Tiergestalt
3.2. Die Gottesanbeterin
3.3. Mimikry
3.4. Das Schattenreich
4. Elemente und Figurale
4.1. Zur Einschreibung der Haut
4.2. Der weibliche Akt als Assoziationsfläche
5. Literaturverzeichnis:
1. Einleitung
Bilder sind nicht nur, wie Ornamente, mehr oder weniger komplexe visuelle Muster. Sie beziehen sich auf etwas, das sie sind oder nicht sind. Bilder sind eine besondere Art von Zeichen. Sie bieten etwas dar, sie beziehen sich auf etwas, das auf ihrer Fläche sichtbar oder unsichtbar ist.
Ein fotografisches Bild wird nicht allein dadurch zum Bild, weil es durch Gegenständen oder Körpern ausgehende Lichtreflexe verursacht wurde, sondern in dem es die Verwendung erhält, aus einer Situation auf eine andere Situation zu verweisen.
Die Surrealisten verwiesen in ihren Fotografien auf ein menschliches Erscheinungsbild, welches der gewohnten Sichtweise befremdend gegenüber steht. Durch perspektivische Verkürzung, Drehung der Horizontalachse in die Vertikale und Ausleuchtung besonderer Körperausschnitte (u.a.) entstanden Bilder von menschlichen Körpern, die nicht mehr nur als solche erkennbar waren. Sie führten den Betrachter in eine Welt der Erscheinung zwischen Traum und Wirklichkeit.
Die Darbietungen der menschlichen Gestalt blieben zwar an dessen Körper gebunden, verwandelten sich aber in der Wahrnehmung des Betrachters zu einer piktoralen Explikation von Eigenschaften, die dem Bild metaphorisch zukommt. Die Differenz zwischen der gewohnten Sichtweise auf den menschlichen Körper und seiner Bilddarbietung als Traumwesen öffnete einen Raum, der über das Geschehen auf der Fläche des Bildobjektes zu einer metaphorischen Erfahrung von Sichtweisen und Wahrnehmungen führte.
Das Wirkliche, das sonst in dieser oder jener Gestalt wahrgenommen und dieser oder jener Gestalt zumeist diesen oder jenen Sinn zugewiesen wurde, diese Wirklichkeit erschien hier nun teilweise ohne diese Gestalten und ohne den bisher mit ihnen verbundenen Sinn. Die Auflösung der Grenzen zwischen Körper und Raum zeigt sich in einer Realität, die in allem Erfassen niemals vollständig erfasst werden kann. Die Auflösung der Grenzen in Form von Mimikry erschien dabei nicht als eine ungestaltete Wirklichkeit, sondern als Gestaltung des gestaltlosen Erscheinens des Unbewussten nach Sigmund Freud.
Das die von den Surrealisten gewählte Schlüsselfigur ein Frauenkörper war, ist nach meiner Ansicht kein stilistisches Mittel zum Zweck, sondern lässt sich aus dem Kontext Surrealität in Verbindung zum Begriff Anima schließen.
2. Die Erscheinungsform der Surrealität
2.1. Zum Begriff der Surrealität
Während noch in Europa bis ins 20. Jahrhundert hinein von Künstlern bei der Gestaltung ihrer Werke verlangt wurde, auf die Rezeptionsgewohnheiten des Betrachters Rücksicht zu nehmen, wendeten sich die Surrealisten gegen die gewohnte Sichtweise des menschlichen Körpers. Ihr Ziel war es Darstellungen zwischen Traum und Wirklichkeit zu produzieren, die eine andere Wirklichkeit in das Zentrum des Blicks stellen würden :
„Kann nicht auch der Traum zur Lösung von Grundfragen des Lebens verwendet werden. [...] Ich glaube an die zukünftige Lösung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Wirklichkeit, der Surrealität.“[1]
Die Sehnsucht nach Entdeckung der „absoluten Wirklichkeit“ durch Auflösung des Widerspruchs der eigenen Wahrnehmung in Traum und Wachzustand war nicht erst durch den Begriff der Surrealität und der Freudschen Theorie vom „Unbewussten“ entstanden. Viel mehr lassen sich die Anfänge dieser Sehnsucht bereits in der Romantik nachvollziehen. So schrieb Georg Christoph Lichtenberg, einer der bedeutendsten deutschen Experimentalphysiker des 18. Jahrhunderts, in seinen Aphorismen folgendes über den Traum:
„Wenn Leute ihre Träume aufrichtig erzählen wollten, da ließe sich der Charakter eher daraus erraten, als aus dem Gesichte.“ [E494]
„Die Träume können dazu nützen, dass sie das Resultat, ohne den Zwang der oft gekünstelten Überlegung, von unserem ganzen Wesen darstellen.“ [J72][2]
Mit der Vorstellung einer (inneren) Einheit und (organistischen) Ganzheit des Menschen wurde in der Regel ein organisierendes Zentrum, ein Kern, ein immanentes „Etwas“ mit gedacht, dessen Ort im materiellen Sinne nicht auszumachen war, welches aber Kontinuität und Zusammenhang überhaupt erst gewährleistete. Was sich so charakterisierte war zugleich das Denkmodell des Subjektivismus, des sich selbst genügenden autonomen Ichs. Jede Frage nach verborgenen Ursachen des Denkens und Fühlens führte zu jenem Kern zurück, jedenfalls um die Vielfalt der Erscheinungen der Wahrnehmung zu erklären. Der Traum stellte den Zugang zu jenem „Etwas“ im Menschen dar; das äußere Gebaren wurde dagegen als suggestive Täuschung bewertet. Im Wachzustand galt das Prinzip der Erfahrung, des Verstandes und der Gewohnheit, dazu gehörten auch die Interessen, die Erwägung von Nützlichkeit und die gesellschaftlichen Stereotypen etc. Der Traum konnte einen Blick in das „dahinter liegende“ erheischen, wo keine Zensur durch das Bewusstsein stattfand, sondern eine Offenheit nach „innen“, ein „Zu-Wort-Kommen“ (besser: Ein Zu-Bild-Kommen) der Einheit und Ganzheit der Lebenszusammenhänge.[3]
Bereits eine, vermutlich aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammende, Hippokratische Abhandlung mit dem Titel Die Regelung der Lebensweise enthält auch ein Buch über Träume und deren Deutung. In diesem Werk versuchte der Verfasser das Verhältnis der Seele zum Körper zu erläutern:
„Die menschliche Seele, die eine Mischung ist aus Feuer und Wasser, den Bestandteilen des Menschen[4], geht in jedes Lebewesen ein, das da atmet, und so auch in den Menschen [...]. Die Seele, die, in viele Teile geteilt, dem wachen Körper dient, ist nicht Herrin ihrer selbst, sondern gibt einen Teil jedem Organ des Körpers ab, dem Gehör, dem Gesicht, dem Tastsinn, dem Gehen, kurz den Handlungen des ganzen Körpers. Herr seiner selbst ist der Geist dann aber nicht.
Wenn der Körper in Ruhe ist, bewegt sich die Seele und ist wach. Sie verwaltet ihr eigenes Haus und führt Handlungen des Körpers selbst aus. Denn der Körper, der schläft, hat keine Wahrnehmung. Die Seele aber, die wach ist, erkennt alles, sieht das Sichtbare und hört das Hörbare, geht, berührt, empfindet Leid und Zorn. Obwohl sie nur einen kleinen Raum einnimmt, führt die Seele im Schlaf alles das aus, was sonst Dienstleistungen des Körpers oder der Seele im wachen Zustand sind.“[5]
Demnach besitzt die Seele im Wachzustand des Menschen keine Autonomie. Sie muss statt dessen kontinuierlich „Serviceleistungen“ für den Körper erbringen. Die Seele erscheint fremd bestimmt und folglich nicht authentisch erkennbar. Nur im Schlaf kehrt sich das Verhältnis um: Jetzt ruht sich der Körper aus; die Seele wird von ihren Routineaufgaben entlastet und frei für eigene, intellektuelle Ziele, die sie im Traum auch virtuell realisieren kann.
Diese Gedanken sind Ausdruck der Fremdbestimmtheit des Selbst im eigenen Körper.
Die von André Breton seit 1921 geführte Bewegung der Surrealisten suchte im Unbewussten[6] die eigentliche Wirklichkeit des Menschen. Animiert durch die Schriften von Sigmund Freud befassten sie sich mit dem Begriff des „psychischen Automatismus“[7], durch den, sei es mündlich, sei es schriftlich, sei es auf eine ganz andere Weise, wirkliches Funktionieren der Gedanken ausgedrückt werden könne. Vom Gedanken diktiert, ohne jede von der Vernunft geübten Kontrolle, außerhalb jeder bisher geführten ästhetischen oder moralischen Voraussetzung, fügten sie Wort an Wort und Bilder zusammen.
Der Surrealismus wird in der Enzyklopädischen Philosophie als der Glaube an die überlegene Wirklichkeit gewisser bisher vernachlässigter Assoziationsformen, die Allmacht des Traumes, des selbstlosen Spiels des Gedankens beschrieben, der danach strebt, endgültig alle anderen psychischen Mechanismen zu zerstören und sich an ihrer Stelle zur Lösung der hauptsächlichen Lebensprobleme einzusetzen.
André Breton definierte die Positionen des Surrealismus in den beiden Manifesten und in Die kommunizierenden Gefäße (1932) wie folgt:
„Ich wünschte, dass der Surrealismus dafür gelte, als habe er nichts Besseres versucht, als ein Kondukt zwischen den allzu getrennten Welten des Wachens und des Schlafens, zwischen der äußeren und der inneren Wahrheit, zwischen der Vernunft und der Torheit, zwischen der Ruhe und der Erkenntnis und der Liebe, zwischen dem Leben um des Lebens willen und der Revolution [...] zu stellen.[8]
Als Beispiel der surrealistischen Ästhetik zitierte Breton aus Isidore Ducasses Gesänge des Maldoror von 1869 den Satz:
„Schön [...] wie die unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirmes auf einem Seziertisch.“
Breton erläuterte diese Ästhetik, wie folgt:
„Zwei möglichst weit voneinander gelegene Dinge zu vergleichen, sie auf schroffe und Besitz ergreifende Art gegenwärtig zu machen, dass bleibt die höchste Aufgabe, die Poesie sich zuerkennen kann. Darin soll ihre unvergleichliche, einzigartige Kraft mehr und mehr zu üben versuchen, eine Kraft, die der konkreten Einheit in Verbindung gebrachter, sonst verschiedener Faktoren zur Erscheinung bringen und jedem einzelnen, wer es auch sei, die Stärke vermitteln soll, die ihm fehlte, solange er als einzelner genommen wurde.“[9]
Bretons Ästhetik, der Verbindung von Dingen, die vorher in keinerlei Bezug zueinander standen, fand auch im Traum statt: Materielle und geistige Formen verbanden sich, insbesondere im Kontext der Psychoanalyse, zu einer neuen inhaltlichen Verbindung. Durch ihre neue Zusammensetzung, aus ihrem bisherigen Bezugssystem enthoben, erhalten sie Inhalte, mit denen sie vorher nicht „besetzt“ waren. Durch ihre neue Zusammensetzung zueinander und der daraus resultierenden Verbindung entstanden nach Breton eine Kraft der Einheit, eines Ganzen, welches durch die vorher herrschende getrennte Existenz nicht erkannt werden konnte.
Dagegen formulierte Salvador Dali die surrealistischen Gegenstände als:
„Gegenstände, die ein Minimum mechanischer Funktionen haben, auf Trugbilder und Darstellungen beruhend, die bei der Verwirklichung unbewusster Handlungen entstehen können.“[10]
Im Gegensatz zu Breton suchte Dali eine gefühlsmäßige Ursache anstelle einer Geistigen. Der gefühlsmäßige Impuls als die Quelle zur Herstellung surrealistischer Gegenstände. So setzte er sich insbesondere mit den psychischen Automatismen, dem Traum und der Begierde in seinen Arbeiten immer wieder auseinander.
Über die gewaltige, sinnliche und sexuelle Begierde schrieb er:
„Die Inkarnation dieser Begierden, ihre Art durch Substitution und Metamorphose greifbar zu werden, ihre symbolische Verwirklichung bilden den typischen Prozess der sexuellen Perversion, die in allen Phasen dem Prozess der poetischen Tat gleicht. [...] Der Begriff der wirklichen geistigen Kultur des Menschen wird mehr und mehr im Zusammenhang mit seiner Fähigkeit erscheinen, seine Gedanken zu pervertieren; denn Perversion setzt immer Führung durch die Begierde voraus, mit der degradierenden Kraft des Geistes, die unbewussten Gedanken umzukehren und ins Gegenteil zu verwandeln, die im elementaren Trugbild der Phänomene erscheinen.“[11]
So unterschiedlich auch die jeweiligen Gedanken waren, fanden sie sich als Bewegung der informe wieder. Zu ihr wurden Fotographen wie Man Ray, Boiffard, Brassai, Ubac, Bellmer Tabard und Parry und Dora Maar zugezählt. informe war ein Begriff, der von Dali aufgenommen, ursprünglich aber ein Ausdruck Bataille war.
Nach Bataille sollte dieser Ausdruck für die Beseitigung von Grenzen stehen. Durch Auflösung formaler Kategorien wäre es nach seiner Meinung möglich, Konzepte der Realität neu zu organisieren, sie wie kleine Sinnpakete in neuer Formation zusammenzustellen, um dadurch mehr über ihre ursprünglichen Eigenschaften zu erfahren. Nach Bataille besaß kein Ding eine „eigene“ Form, vielmehr wäre sie wie Spucke und hätte folglich eine überaus amorphe Eigenschaft.[12]
Die Auflösung von (statischen) Formen lässt sich besonders gut in Verwesungsprozessen beobachten. Verfault z.b. ein Apfel so schrumpelt seine Haut, bis er völlig zersetzt, von Erde nicht mehr zu unterscheiden ist. Er verliert Form, Farbe und Geschmack und damit alle seine Eigenschaften, die mit einem Apfel suggeriert werden.
Bataille assoziierte den Übergang von einer Form in eine andere mit dem Begriff der informe.
2.2. Fotografie als Kunstform
Die Fotografie wurde von den Surrealisten nicht sofort als Mittel für ihre Arbeiten entdeckt. Viel mehr sprach die literarische Bewegung[13] der Surrealisten der Fotografie die Möglichkeit ab, „innere Vorgänge“ darzustellen. Man Ray war einer der ersten Fotographen dem es gelungen war, Fotografie als Kunstwerk zu etablieren. Er gehört damit zu den bekanntesten Fotographischen Künstlern jener Zeit.
Als Man Ray, der zur selben Zeit wie Max Ernst, 1935 in Paris eintraf, wurde er als eine Art „HausFotograph“ eingestellt. Empfohlen von der Mäzene Katharina Dreier, trat er den Weg von New York an, um sich einer Gruppe von Künstlern anzuschließen, die sich weder mit der Mechanik noch mit den chemischen Prozessen der Fotografie auskannten. Die Künstler hießen: Tzara, Picabia, Rigaut, Breton, Aragon und Soulpault. Anfangs fotografierte er die Bilder seiner Freunde, welches ihm aber kaum Geld einbrachte, später machte er Porträts von ihnen, aus Freundschaft, aber auch um sich eine Mappe anzulegen. Er wollte sich „seines Apparates, wie einer Schreibmaschine bedienen“[14].
Fotographen, wie Reutlinger, Seeberger, Manuel und Harcourt standardisierten ihre Fotografie zu einem Einheitsstil.[15] Man Ray wollte einen eigenen Stil: Was in der Avantgarde der zwanziger Jahre als fachliche Fehler eingestuft und abgewertet wurde, wählte er als seine künstlerische Art von Fotografie: systematisch schiefe Bildausschnitte, visuelle Posen, Bildmontagen, Überlagerung von Negativen (z.b. das Porträt von Tristan Tzara, 1921), Doppelbelichtungen, bewusste Unschärfen und Solarisation. Die Ideen zur Weiterverarbeitung von Fotos und Negativen ergaben sich zufällig oder waren Experimente. Das Endprodukt war eine Mischung aus verschiedenen Techniken, die sich durch ihre Verbindung zu einem Kunstwerk auszeichneten. (Vgl.: Bretons Zitat zur surrealistischen Ästhetik)
Man Rays Experimentierfreude führte zur Anerkennung des Foto als Kunstwerk:
„Mit Hilfe der Solarisation gelang es Man Ray dem fotografischen Porträt Anerkennung als Kunstwerk zu verschaffen. Er erzeugte mit dieser Technik einen Effekt, der in der damaligen Zeit großen Eindruck und Erstaunen hervorrief, und der in einer Art Materialisierung der Aura einer Person bestand. In dem er die berühmtesten Künstler seiner Zeit (Picasso, Braque, Duchamp, Breton, Max Ernst) fotografierte und anschließend diese solarisierte, unterstützte er die Theorie, der zufolge manche Künstler Genie und damit eine Aura besäßen. [...] Die Fotografie wurde damit mehr als zu einem bloßen Dokument, sie zeigte damit nicht nur was der Mensch sehen kann; sie ging weiter, in dem sie das Charisma einer Person dem Auge wahrnehmbar und anschaulich machte, jene unsichtbare Eigenschaft also, die der Mensch nur in Gegenwart einer Person spürt, der diese Macht gegeben ist.“[16]
Breton akzeptierte keine mechanischen „Handlanger“. Allein der „Zufall“ galt für ihn als der existentielle Faktor der surrealistischen Poetik. Dieser würde aber in der Fotografie ausgeschlossen sein, da Mechanik und die bewusste Handlung des Fotographen für den Zufall keinen Platz ließen. Bataille dagegen war der Fotografie aufgeschlossener. Für ihn entstand durch die Verbindung von Sprache und Bild eine neue Form der surrealistischen Komposition.
Aufgrund der gegensätzlichen Interpretationen der Surrealität aus Schrift und Foto kam es zu einem Bruch zwischen Breton und Bataille. Bataille gründete eine eigene Zeitung: Documents. Sie erschien in den Jahren 1929 bis 1930. Der fortwährende Streit zwischen Breton und Bataille führte zum Boykott der Documents von Seiten Bretons Anhänger. Breton hielt die ihn umgebenden Künstler davon ab, ihre Bilder in Documents reproduzieren zu lassen. Für Bataille ergab sich daraus der Zwang, diese Bilder nur rein schematisch abhandeln zu können.[17]
Drei Jahre später gab Bataille 1933 die Zeitschrift Minotaure heraus, die neben den Essays von Breton, Raynal, Dali u.a. auch Fotografien von Man Ray, Boiffard, Brassai u.a. abbildeten. Das sich Breton und Batailles zwar nur exemplarisch in einer Zeitung wiederfanden, ging aus der entstandenen hohen Anhängerschaft Batailles und der damit verbundener Popularität hervor.[18]
Der Titel Minotaure lehnt sich an die Sage des Minotaurus[19], der einen menschlichen Körper mit einem Stierkopf besaß. Rosalind Krauss schreibt hierzu in ihrem Essay, Corpus delicti:
„Minotaure“ war ein Titel von Batailles, aber es war auch ein Bataillisches Konzept, denn, wie wir sehen werden, dieses Mensch-Tier, das blind durch das Labyrinth wandert, in das es gefallen ist, leidet unter Schwindel und Desorientiertheit. Diese Kreatur, die den Sitz ihrer Vernunft – den Kopf – verloren hat, ist eine weitere Verkörperung der informe. [...] Für Bataille ist informe die Kategorie, die es erlaubt, alle Kategorien undenkbar zu machen. [...], die sich sowohl auf die Abstraktheit von Konzepten bezieht, wie eine Zueinandersetzung mit der Mimikry verbindet [...]“[20]
[...]
[1] Aus: Les’ Manifestes du Surréalisme, Document, 1946, S. 117
[2] G.-C. Lichtenberg, Aphorismen, Beginn der Eintragungen in von ihm sogenannter Sudelbücher ca. 1764, S. 2
[3] Vgl. Wolfram Mauser, Georg Christoph Lichtenberg - Vom Eros des Denkens, S. 113
[4] Entsprechend der Lehre des vorsokratischen Philosophen Empedokles von Agrigent (490-430 v. Christus) besteht der gesamte Kosmos aus nur vier Elementen, nämlich Luft, Feuer, Erde und Wasser.
[5] Axel W. Bauer, Körperbild und Leibverständnis, 1998
[6] dtv-Lexikon, März 1972: „seelische Vorgänge, die nicht unmittelbar der Selbstbeobachtung zugänglich sind, aber an ihren Wirkungen erkannt werden und unter Umständen das bewusste Erleben und Verhalten beeinflussen oder steuern: Traum, posthypnotische Suggestion, viele Alltagserfahrungen, wie das Weiterwirken eines Vorsatzes“.
[7] Vgl. Kap.3.2.: Die Gottesanbeterin, S. 14
[8] André Breton, Die kommunizierenden Gefäße, 1932
[9] André Breton, a.a.O., 1932
[10] Salvador Dali, Paranoia-Kritik, 1933
[11] S. Dali, a.a.O.
[12] Vgl. R. Krauss, Corpus delicti, in: Das Fotographische – Eine Theorie der Abstände- , München, 1998, S. 171/172
[13] Anm.: Die in Schriften übertragenen surrealistischen Vorstellungen wurden von seinen Mitgliedern nicht als
literarisch deklariert. W. Benjamin schrieb in Der Surrealismus, 1929, S. 19:
„Wer aber erkannt hat, dass in den Schriften dieses Kreises es sich nicht um Literatur, sondern um anderes: Manifestation, Parole, Dokument, Bluff, Fälschung, wenn man will, nur eben nicht um Literatur handelt, weiß damit auch, dass hier buchstäblich von Erfahrungen, nicht von Theorien, noch weniger von Phantasmen die Rede ist.“
[14] 6. Brief von Man Ray an Katharina Dreier, 20. Februar 1921
[15] Vgl. M. Frizol, Wie ich Man Ray wurde. Der Fotograph bei der Arbeit,1998, S. 23
[16] Emanuele de L´Ecotais, Die Kunst und das Porträt, Aus : Man Ray – Das Fotographische Werk- Hrg. : Emanuele de L´Ecotais und Alain Sayag 1998, München
[17] Vgl. R. Krauss, a.a.O., S. 170
[18] Vgl. R. Krauss, a.a.O., S. 171
[19] Nach der griechischen Mythologie lebte auf Kreta König Minos, Sohn des Zeus und der Europa, Vater der Ariadne und der Phädra. Weil er einen von Poseidon aus dem Meer gesandten schneeweißen Stier nicht geopfert hatte, verliebte sich seine Gattin Pasiphaë durch die rächende Fügung des Gottes in den Stier und gebar von ihm den Minotaurus, ein Ungeheuer mit Menschenleib und Stierkopf. Dieser wird aus Schmach von Minos in ein Labyrinth eingesperrt. Aus Rache für die Tötung seines Sohnes Androgeos bekriegte Minos die Athener und zwang sie alle 9 Jahre 7 Jünglinge und 7 Jungfrauen abzugeben, die er dem Minotaurus vorwarf, bis Theseus diesen mit Hilfe von Ariadne (Ariadnefaden) tötete. Nachdem beide flohen, wurde Ariadne von Theseus auf Naxos zurückgelassen und wurde die Gattin von Dionysos.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um eine Analyse surrealistischer Fotografie, insbesondere im Kontext des Surrealismus.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt Themen wie die Erscheinungsform der Surrealität, den Begriff der Surrealität, die Fotografie als Kunstform, Begriffe und Bilder (Tiergestalt, die Gottesanbeterin, Mimikry, das Schattenreich), Elemente und Figurale (Einschreibung der Haut, der weibliche Akt als Assoziationsfläche).
Wer sind einige der im Text genannten Personen?
Zu den im Text genannten Personen gehören unter anderem Georg Christoph Lichtenberg, Sigmund Freud, André Breton, Salvador Dali, Man Ray, Georges Bataille, Rosalind Krauss.
Was ist die Definition von Surrealität im Kontext des Textes?
Surrealität wird als eine Art absoluter Wirklichkeit definiert, die durch die Lösung des scheinbaren Widerspruchs zwischen Traum und Wirklichkeit entsteht. Es ist ein Zustand zwischen Traum und Wachzustand, der eine andere Wirklichkeit in den Mittelpunkt stellt.
Wie wird die Fotografie als Kunstform im Text diskutiert?
Der Text diskutiert die Entwicklung der Fotografie als Kunstform im Surrealismus, insbesondere durch die Arbeit von Man Ray. Er betont die Verwendung von Techniken wie Solarisation, schiefe Bildausschnitte, visuelle Posen, Bildmontagen und Doppelbelichtungen, um die Fotografie über ein bloßes Dokument hinaus zu erheben.
Was ist der Begriff "informe" und wie bezieht er sich auf den Surrealismus?
"Informe" ist ein Begriff von Georges Bataille, der die Beseitigung von Grenzen und die Auflösung formaler Kategorien bezeichnet. Im Surrealismus bezieht er sich auf die Neuorganisation von Realitätskonzepten und die Amorphie der Dinge.
Was war die Rolle von "Documents" und "Minotaure" im Surrealismus?
"Documents" war eine von Georges Bataille gegründete Zeitschrift, die zum Bruch mit André Breton führte. "Minotaure" war eine spätere Zeitschrift von Bataille, die Essays und Fotografien von verschiedenen Surrealisten enthielt.
Was sind die Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit den surrealistischen Objekten nach Breton und Dali?
Nach Breton entstehen surrealistische Objekte durch die Verbindung von Dingen, die vorher in keinerlei Bezug zueinander standen. Nach Dali beruhen sie auf Trugbildern und Darstellungen, die bei der Verwirklichung unbewusster Handlungen entstehen.
Was ist der Bezug zur griechischen Mythologie, insbesondere zum Minotaurus, im Text?
Der Minotaurus wird als Verkörperung der "informe" dargestellt, ein Mensch-Tier, das blind durch das Labyrinth wandert und unter Schwindel und Desorientiertheit leidet.
Wie beeinflusste die Psychoanalyse den Surrealismus?
Die Psychoanalyse, insbesondere die Schriften von Sigmund Freud über das Unbewusste, beeinflusste die Surrealisten, die im Unbewussten die eigentliche Wirklichkeit des Menschen suchten und sich mit dem Begriff des "psychischen Automatismus" befassten.
- Quote paper
- Vera Venz (Author), 2000, Zwischen Traum und Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135939