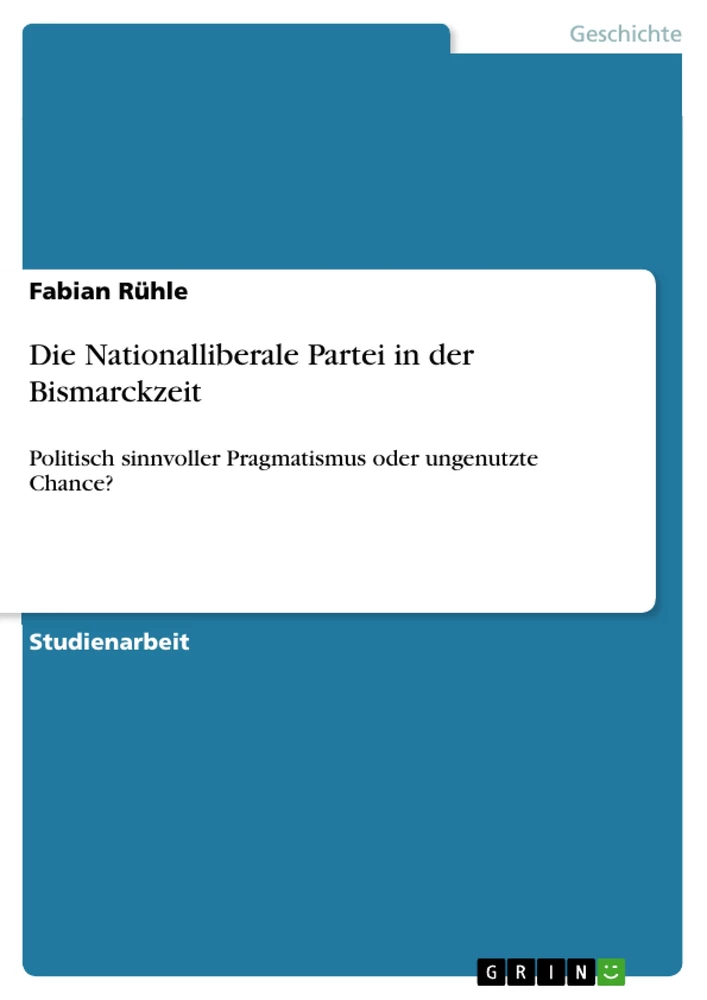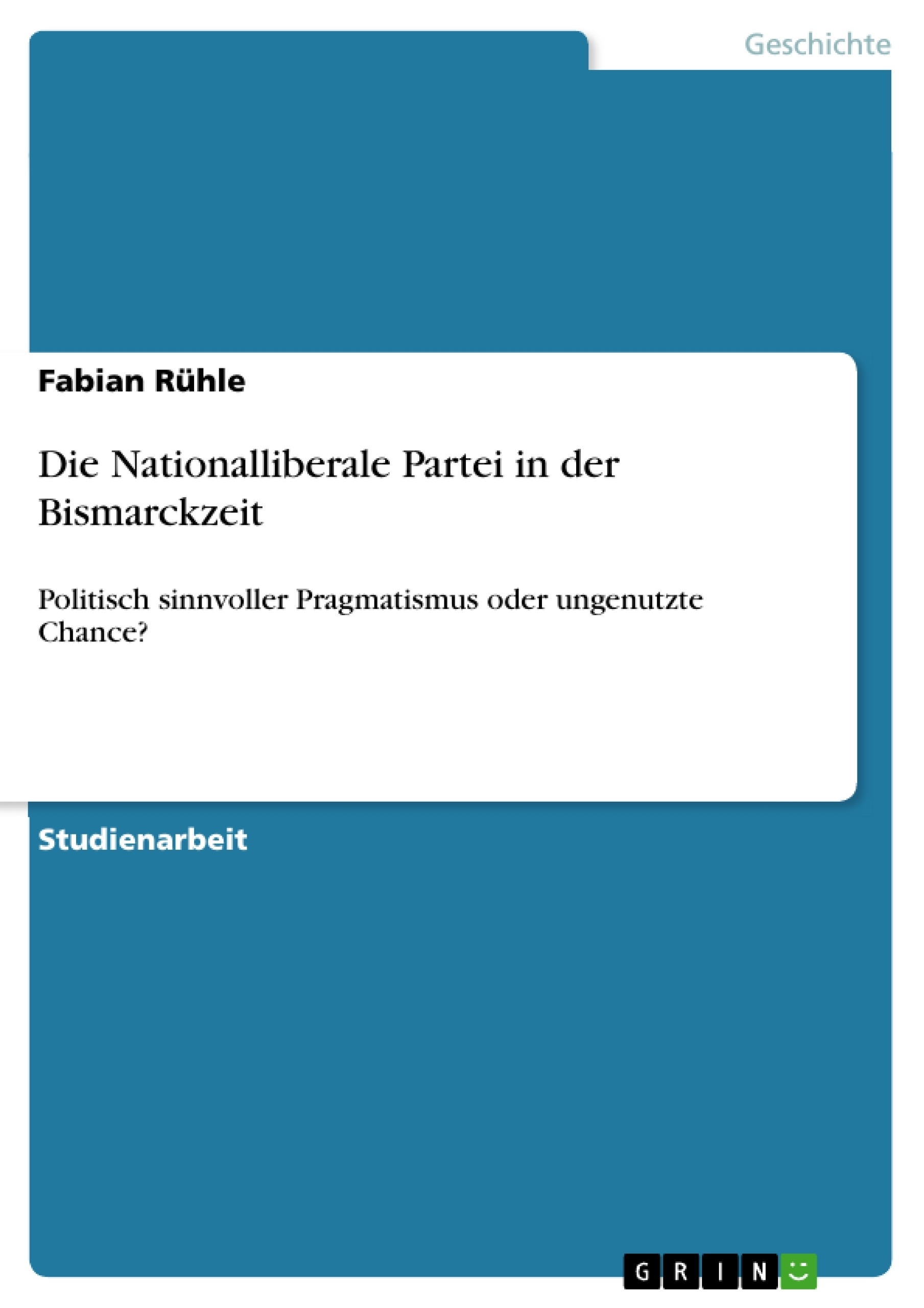Das Thema dieser Arbeit lautet „Die Nationalliberale Partei in der Bismarckzeit – Politisch sinnvoller Pragmatismus oder ungenutzte Chance?“ Der Untertitel deutet schon die Fragestellung, die die These aus meinem Referat im Seminar aufgreift, an. Gegenstand der Darstellung soll es sein, herauszuarbeiten ob die Teilhabe der Nationalliberalen Partei an der Regierung unter Bismarck sinnvoller Pragmatismus war, um die liberalen Ziele so gut es ging zu verwirklichen oder ob diese Kooperation mit Bismarck der Verrat an den liberalen Ideen war und „die Tragödie des deutschen Liberalismus“ begründet hat.
Die Forschung hat die Rolle der Nationalliberalen in der Bismarckzeit lange Zeit sehr negativ gesehen und sie zu reinen Handlangern Bismarcks degradiert. „Von Anfang an zeigte er den Liberalen den Herrn; reaktionäre Gepflogenheiten der Konfliktzeit wurden unbekümmert um den Friedensschluss fortgesetzt.“ So leitet SELL das Kapitel „Zusammenarbeit“ ein und gibt damit deutlich zu erkennen, wie gering er die aktive Teilhabe der Nationalliberalen am politischen Geschehen einschätzt, da er sie zu reinen Mehrheitsbeschaffern für Bismarck herabstuft.
Die Arbeit teilt sich in drei Hauptabschnitte: 1.Die Zeit des Norddeutschen Bundes 2.Die Zeit von der Reichsgründung bis zur großen Wende 3.Die Auswirkungen der großen Wende und die darauf folgende Neuorientierung der Partei.
Im ersten Abschnitt stehen somit die Gründung der Nationalliberalen Fraktion und Partei und ihre Arbeit im Norddeutschen Bund im Mittelpunkt. Genauso wie in den anderen Abschnitten konzentriere ich mich hierbei auf den Reichstag und in einigen Fällen auf den preußischen Landtag, da zum einen der Schwerpunkt des Seminars auf Preußen und der Bundesebene lag und zum anderen der Umfang der Arbeit im geforderten Maß bleiben soll.
Der zweite Abschnitt behandelt den Höhepunkt der Nationalliberalen Beteiligung an der Regierung und die Frage welche liberalen Reformen verabschiedet werden konnten und was gegen Bismarck nicht durchsetzbar war. Auch die starke Beteiligung am Kulturkampf, muss unbedingt bei der Betrachtung dieses Zeitraums ins Auge genommen werden.
Der dritte Abschnitt behandelt schließlich die Abkehr Bismarcks von den Nationalliberalen und die Reaktion der Fraktion und Partei hierauf.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Die Zeit des Norddeutschen Bundes
1. Die Gründung der Nationalliberalen Fraktion und Partei
2. Die Mitarbeit an der Verfassung des Norddeutschen Bundes
3. Gesetzliche Initiativen in der Zeit des Norddeutschen Bundes und Versuche der Nationalliberalen die Verfassung zu erweitern
II. Die Zeit von der Reichsgründung 1871 bis zur großen Wende 1878
1. Die Nationalliberalen als Regierungspartei?
2. Der Kulturkampf als Bindemittel zwischen Bismarck und den Nationalliberalen
3. Die Abwendung Bismarcks von den Nationalliberalen
III. Die Auswirkungen der großen Wende und die darauf folgende Neuorientierung der Nationalliberalen Partei
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Das Thema dieser Arbeit lautet „Die Nationalliberale Partei in der Bismarckzeit – Politisch sinnvoller Pragmatismus oder ungenutzte Chance?“ Der Untertitel deutet schon die Fragestellung, die die These aus meinem Referat im Seminar aufgreift, an. Gegenstand der Darstellung soll es sein, herauszuarbeiten ob die Teilhabe der Nationalliberalen Partei an der Regierung unter Bismarck sinnvoller Pragmatismus war, um die liberalen Ziele so gut es ging zu verwirklichen oder ob diese Kooperation mit Bismarck der Verrat an den liberalen Ideen war und „die Tragödie des deutschen Liberalismus“ begründet hat.
Die Forschung hat die Rolle der Nationalliberalen in der Bismarckzeit lange Zeit sehr negativ gesehen und sie zu reinen Handlangern Bismarcks degradiert. „Von Anfang an zeigte er den Liberalen den Herrn; reaktionäre Gepflogenheiten der Konfliktzeit wurden unbekümmert um den Friedensschluss fortgesetzt.“[1] So leitet Sell das Kapitel „Zusammenarbeit“ ein und gibt damit deutlich zu erkennen, wie gering er die aktive Teilhabe der Nationalliberalen am politischen Geschehen einschätzt, da er sie zu reinen Mehrheitsbeschaffern für Bismarck herabstuft.
Die neuere Forschung zeichnet ein deutlich positiveres Bild von der nationalliberalen Partei und ihrer Kooperation mit Bismarck. Es wird nicht mehr vom Ergebnis her geurteilt, d.h. vom Scheitern der Nationalliberalen in der großen Wende von 1878, sondern es wird hervorgehoben, dass die Teilhabe an der Regierung viele sinnvolle Reformen möglich gemacht hat.[2] Neben Nipperdey urteilt auch Wehler ebenso positiv, indem er die Regierungsbeteiligung damit rechtfertigt, dass die Nationalliberalen nur auf den günstigen Moment warteten, um das Herrschaftssystem endgültig zu liberalisieren.[3]
Langewiesche unterstützt diese Thesen und spitzt sie noch zu, indem er schreibt: „Keine Liberalisierung des neuen Reiches ohne Bismarck, mit ihm nur eine begrenzte. Das wussten die Nationalliberalen und danach handelten sie.“[4] Für ihn gab es somit für die Nationalliberalen gar keine Alternative zur Kooperation mit Bismarck.
Die Quellenlage ist, wie für die Geschichte der neueren Zeit typisch, als sehr gut und umfangreich zu bezeichnen. Die Protokolle der Sitzungen der Reichstage des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reichs geben einen guten Einblick in die politischen Debatten der Zeit. Eher schlecht überliefert sind hingegen die Fraktionssitzungen, die erst ab den 1880er Jahren protokolliert wurden, so dass man für den innerparteilichen Diskurs vor allem auf Briefe oder veröffentlichte Memoiren zurückgreifen muss.[5] Eine wichtige Quelle stellen zudem die Tageszeitungen dar, wie z.B. die „Nationalzeitung“ die den Nationalliberalen sehr nahe stand und quasi eine Parteizeitung war.
Die Arbeit teilt sich in drei Hauptabschnitte: 1.Die Zeit des Norddeutschen Bundes 2.Die Zeit von der Reichsgründung bis zur großen Wende 3.Die Auswirkungen der großen Wende und die darauf folgende Neuorientierung der Partei.
Im ersten Abschnitt stehen somit die Gründung der Nationalliberalen Fraktion und Partei und ihre Arbeit im Norddeutschen Bund im Mittelpunkt. Genauso wie in den anderen Abschnitten konzentriere ich mich hierbei auf den Reichstag und in einigen Fällen auf den preußischen Landtag, da zum einen der Schwerpunkt des Seminars auf Preußen und der Bundesebene lag und zum anderen der Umfang der Arbeit im geforderten Maß bleiben soll.
Der zweite Abschnitt behandelt den Höhepunkt der Nationalliberalen Beteiligung an der Regierung und die Frage welche liberalen Reformen verabschiedet werden konnten und was gegen Bismarck nicht durchsetzbar war. Auch die starke Beteiligung am Kulturkampf, muss unbedingt bei der Betrachtung dieses Zeitraums ins Auge genommen werden.
Der dritte Abschnitt behandelt schließlich die Abkehr Bismarcks von den Nationalliberalen und die Reaktion der Fraktion und Partei hierauf.
Im Verlauf dieser drei Abschnitte werde ich versuchen die Beweggründe darzustellen, die die Nationalliberalen zu ihrer Zusammenarbeit mit Bismarck gebracht haben und auch die stets wach bleibende Hoffnung auf einen „stillen Verfassungswandel“[6] versuchen zu erklären.
I. Die Zeit des Norddeutschen Bundes
1. Die Gründung der Nationalliberalen Fraktion und Partei
Der Auslöser für die Gründung der Nationalliberalen Fraktion und Partei war Bismarck. Diese Aussage bedarf einiger Erklärung, die ich im folgenden Abschnitt zu geben versuche werde.
Nach dem preußischen Sieg von Königgrätz löste sich der Deutsche Bund auf und die kleindeutsche Lösung ohne Österreich war geboren. Am 15. August 1866 kam es zur Gründung des Norddeutschen Bundes, der, neben Preußen und seinen neu annektierten Gebieten wie z.B. Hannover, alle Länder nördlich des Mains umfasste. Die süddeutschen Länder verblieben zunächst außerhalb des Bundes.
Schon am 5. August 1866 veröffentlichte Bismarck, anlässlich der Eröffnung des preußischen Landtages, die so genannte Indemnitätsvorlage, mit der er im Nachhinein für die letzten Jahre die Regierung entlasten und den Verfassungskonflikt beenden wollte. Der Verfassungskonflikt war auf Grund der Weigerung des preußischen Landtages, der unter Führung der Fortschrittspartei stand, das Militärbudget zu genehmigen entstanden. Bismarck formulierte daraufhin die so genannte Lückentheorie, in der er seine militärischen Ausgaben damit begründete, dass der Staat im Falle eines Boykotts durch das Parlament nicht handlungsunfähig werden dürfte. Angesichts des erreichten militärischen Erfolgs sah Bismarck nun die Gelegenheit gekommen, diesen Streit zu beenden und sein begangenes Unrecht teilweise einzugestehen.[7] An der Lückentheorie hielt Bismarck jedoch trotzdem fest, d.h. er hielt sich frei in einem ähnlichen Notfall erneut so zu agieren wie er es zuvor getan hatte. Hieraus wird auch deutlich, dass die Verfassung für Bismarck „herrschaftsmodifizierend, aber nicht -konstituierend“[8] war, d.h. für ihn war die Verfassung nur ein Teil der staatsrechtlichen Ordnung, so dass er die Lösung des Konflikts um das Militärbudget „bewusst der politischen Auseinandersetzung und Entscheidung“[9] überantwortete.[10]
Durch die Abstimmung über die Indemnitätsvorlage kam es schließlich zur Spaltung der liberalen Fortschrittspartei. Für die alten Demokraten und Idealisten auf der linkeren Seite des Liberalismus war die Vorlage Bismarcks nicht annehmbar, sie sahen darin „eine Ausgeburt des schlimmsten Machiavellismus.“[11] Sie wollten sich nicht von Bismarck kaufen lassen und ihre Ideen, für die sie in der Vergangenheit gekämpft hatten und für die sie noch immer standen, aufgeben.
Auf der anderen Seite standen die eher gemäßigten realpolitischen Liberalen, die die Vorlage als Chance sahen aus der ewigen Oppositionsrolle herauszukommen, deren Fortsetzung bei einer Ablehnung der Vorlage sicher gewesen wäre, und so unter Inkaufnahme einiger Zugeständnisse an Bismarck letztlich doch liberale Ideen verwirklichen zu können. „Besser in der Regierung ein Geringes tun [, als in der] Opposition ein Unbegrenztes fordern,“[12] so formulierte es Hermann Baumgarten in seiner Schrift „Der deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritik“ im November 1866. Auch sahen die eher pragmatisch eingestellten Politiker der späteren Nationalliberalen Partei ein, dass Bismarck auf Grund seines Erfolges bereits faktisch die Indemnität erlangt hatte und man kaum gegen einen solch populären Sieger in der Oppositionsrolle etwas erreichen konnte. Sie bauten zudem auf die Hoffnung, dass sie durch zukünftige Thron- oder Kanzlerwechsel in eine stärkere Position gelangen könnten und dass mit der Zeit die einzig richtige Politik, das konnte für sie natürlich nur der Liberalismus sein, sich durchsetzen würde. Schon am 12 August 1866 verließ mit v. Unruh der erste Abgeordnete die Fraktion der Fortschrittspartei im preußischen Landtag. Ihm folgten am 18. August neben drei weiteren Abgeordneten u.a. Twesten und zwei Tage später verließ auch Lasker die Fraktion. Bis zur Abstimmung über das Indemnitätsgesetz verließen dann noch weitere 7 Mitglieder die Fraktion, so dass die Spaltung der Liberalen nun deutlich sichtbar wurde.[13] Das Indemnitätsgesetz wurde schlussendlich am 3. September 1866 mit 230 zu 75 Stimmen im preußischen Abgeordnetenhaus angenommen.
Der Riss innerhalb der Fortschrittspartei, der auf Grund dieses Gesetzes für jeden sichtbar wurde, bestand nicht erst seit 1866, sondern schon mindestens seit 1863. Der Auslöser hierfür war die Frage wie und auf welchem Wege die nationale Einheit geschaffen werden sollte. Die Gruppe der späteren Nationalliberalen vertrat hier bereits den Standpunkt, dass man Preußen bei der Bildung des Nationalstaates unterstützen sollte, um dann nach erfolgter Einigung auf die liberalen Ziele hinzuarbeiten.[14] Der linke Flügel der Partei sah hingegen die erste Priorität in der Verwirklichung der liberalen Ideen und lehnte es daher ab, mit dem anti-liberalen Preußen zu kooperieren. Es war zusammengefasst der Streit darum, ob man der Einheit vor der Freiheit oder der Freiheit vor der Einheit den Vorzug geben sollte.[15]
Um meine These zu Beginn dieses Abschnitts wieder aufzunehmen, dass Bismarck der Auslöser für die Gründung der Nationalliberalen Partei und Fraktion war, kann man diese u. U. noch erweitern, indem man sagt, dass Bismarck diese Spaltung der Liberalen durchaus einkalkuliert hatte und die Gründung der neuen liberalen Rechten ihm durchaus gelegen kam. Diese Politik der Spaltung von politischen Gegnern ist nicht untypisch für Bismarck, der hauptsächlich daran interessiert war, Mehrheiten für seine Politik zu haben und dafür durchaus bereit war, ehemalige Feinde zu neuen Partnern zu machen.
Im November 1866 kam es schließlich zur Gründung der „neuen Fraktion der nationalen Partei“, aus der später 1867 die Nationalliberale Partei entstand.
2. Die Mitarbeit an der Verfassung des Norddeutschen Bundes
Zwar war der Norddeutsche Bund bereits am 15. August 1866 gegründet worden, aber erst am 12. Februar 1871 fand die Wahl zum konstituierenden Reichstag statt. Das Ergebnis fiel für die Liberalen, wie auch schon die Wahl zum preußischen Landtag 1866, eher schlecht aus. Rechnet man alle liberalen Gruppierungen zusammen kommt man auf 47,1% der Mandate.[16] Diese Gruppe war jedoch, wie bereits dargestellt, sehr heterogen in ihrer politischen Einstellung, so dass die einzelnen Gruppen Kompromisse schließen und auch in den anderen politischen Lagern nach möglichen Partnern suchen mussten. Am 27./28. Februar 1867 gründete sich die Fraktion der „Nationalliberalen Partei“ im Reichstag, der zunächst 53 und später 80 Mitglieder angehörten. Den Vorsitz übernahm Rudolf von Bennigsen, der Mitbegründer und Vorsitzender des Deutschen Nationalvereins von 1859 gewesen war und für die zukünftige Politik der Nationalliberalen noch eine entscheidende Rolle spielen sollte.
Die Regierungen der Mitglieder des Norddeutschen Bundes hatten sich bei seiner Gründung auf einen Verfassungsentwurf geeinigt, der nun vom Reichstag an einigen Stellen noch korrigiert werden konnte, insgesamt jedoch weitestgehend stabil blieb. Erfolgreich konnte u. a. die Bundeskompetenz und auch das Budgetrecht des Reichstages erweitert werden. Die wichtige Frage des Militärbudgets blieb jedoch weiterhin ungeklärt und wurde durch das Festlegen einer Pauschalsumme bis 1871 weiter verschoben.
Eine Schlappe mussten die Liberalen bei ihrem Versuch, verantwortliche Bundesminister zu schaffen, hinnehmen. Lediglich der Bundeskanzler übernahm die Verantwortlichkeit für „Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidiums“,[17] neben ihm gab es keine weiteren Bundesminister.
Bei der Arbeit an der Verfassung kam es durchaus zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen liberalen Gruppen. Be der Verabschiedung der Verfassung am 16. April 1867 lehnten dann jedoch 15 von 19 Mitgliedern der liberalen Linken die Verfassung ab und machten damit deutlich, dass ihrer Meinung nach die verantwortlichen Ministerien ein unabdingbarer Bestandteil der Verfassung sein sollten.[18]
Die nationalliberalen Abgeordneten stimmten der Verfassung einstimmig zu, da sie einsahen, dass Bismarck weitergehende Eingeständnisse an die Liberalen ablehnte. Es wurde von Seiten Bismarcks sogar mit der Auflösung des Reichstags gedroht, wenn dieser nicht mit ihm kooperieren würde.[19] Man plante vielmehr für die Folgezeit stetig am Ausbau der Verfassung mitzuarbeiten und so mit kleinen Schritten dem Ziel eines liberalen Staates näher zu kommen. Der Abgeordnete Twesten machte diese Einstellung in einer Sitzung des Reichstages vom 09.03.1867 deutlich, indem er hervorhob, dass der jetzige Verfassungsentwurf nur dazu diene „ein Gerüst herzustellen, dessen Ausbau der Folgezeit überlassen bleiben mag.“[20]
Am 16. April nahm der Reichstag schließlich die Verfassung mit 230 zu 53 Stimmen an und verfestigte somit den neugeschaffenen kleindeutschen Staat.
[...]
[1] F. C. Sell, Die Tragödie des deutschen Liberalismus, S. 227.
[2] Vgl. T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 Bd. 2, S. 318.
[3] Vgl. H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte Bd. 3, S. 867.
[4] D. Langewiesche, Bismarck und die Nationalliberalen, S. 74.
[5] Vgl. A. Lauterbach, Im Vorhof der Macht, S. 18.
[6] D. Langewiesche, Bismarck und die Nationalliberalen, S. 79.
[7] Vgl. T. Nipperdey, Dt. Geschichte 1866-1918 Bd. 2, S. 35.
[8] A. Lauterbach, Im Vorhof der Macht, S. 44.
[9] A. Lauterbach, Im Vorhof der Macht, S. 44.
[10] Vgl. A. Lauterbach, Im Vorhof der Macht, S. 44.
[11] T. Nipperdey, Dt. Geschichte 1866-1918 Bd. 2, S. 37.
[12] H. Baumgarten, Der deutsche Liberalismus, S. 149.
[13] Vgl. A. Lauterbach, Im Vorhof der Macht, S. 45.
[14] Vgl. D. Langewiesche, Liberalismus in Deutschland, S. 102.
[15] Vgl. T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 Bd. 2, S. 37.
[16] Vgl. D. Langewiesche, Liberalismus in Deutschland, S. 107.
[17] Vgl. Verfassung des Norddeutschen Bundes, Art 17.
[18] Vgl. D. Langewiesche, Deutscher Liberalismus, S. 108.
[19] Vgl. A. Lauterbach, Im Vorhof der Macht, S. 89 mit Anm. 326.
[20] Sten. Ber. Konst. RT 1867, Bd. 1, S. 102.
- Quote paper
- Fabian Rühle (Author), 2007, Die Nationalliberale Partei in der Bismarckzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135935