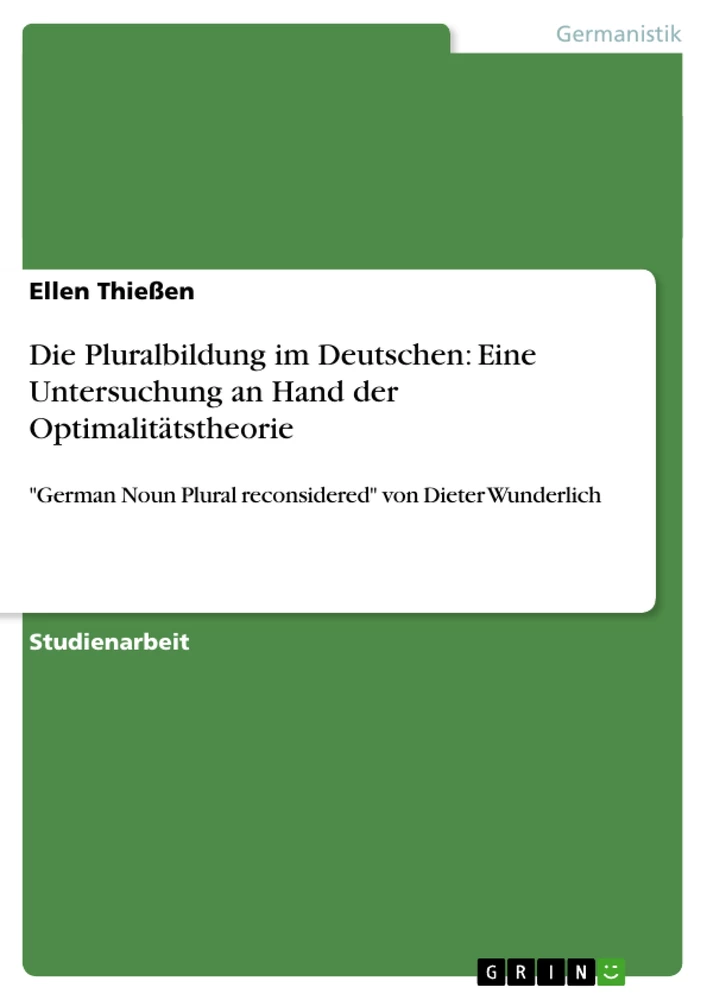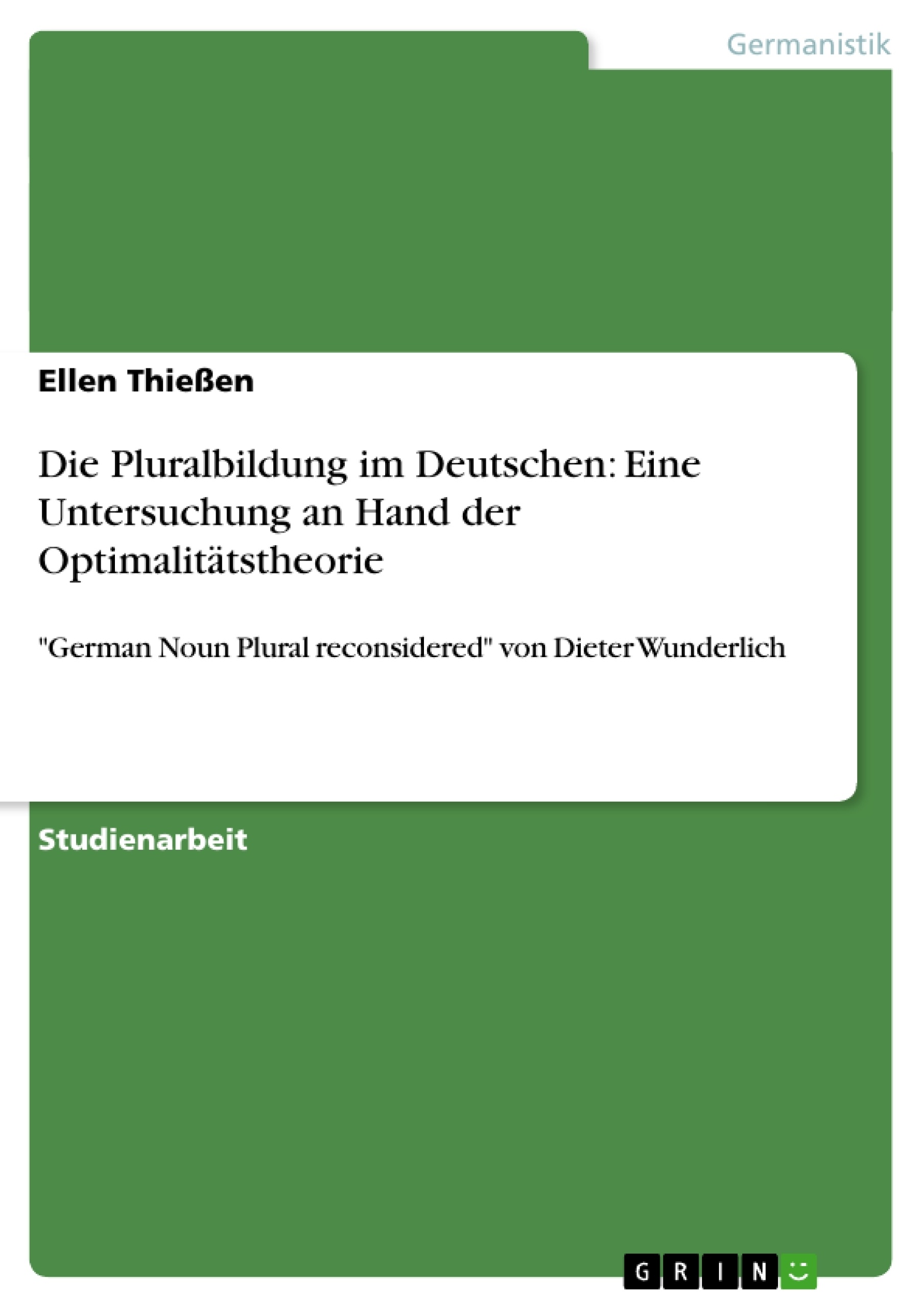„Die Pluralbildung im Deutschen ist nicht chaotisch, aber komplex.
Unabhängig davon, ob man für die Pluralbildung Regeln, Schemata oder die Wortstruktur als Erklärungsmodell benutzt, bleibt die Tatsache einer beachtlichen Zahl miteinander konkurrierender Formen zu erklären.“ (WEGENER 1999: 1)
Das deutsche Pluralsystem ist nach morphologischen und silbenphonologischen Beschränkungen aufgebaut. Somit lässt es sich an Hand eines Systems beschreiben, das Optimalitätstheorie genannt wird. Die Optimalitätstheorie nimmt an, dass Wortformen universalen Beschränkungen unterliegen, welche prinzipiell verletzbar und untereinander hierarchisiert sind. Ziel dieser Arbeit soll es sein, diese Beschränkungen zu erläutern und auf eventuelle Erklärungslücken der Optimalitätstheorie hinsichtlich der deutschen Pluralformen hinzuweisen. So kann man mit dieser Theorie zwar beispielsweise zwischen n-Plural und Umlaut problemlos unterscheiden, allerdings ergeben sich Schwierigkeiten bei der Wahl des für die deutsche Sprache relativ jungen s-Plurals, worauf ich ab Kapitel 3.3 näher eingehen werde.
Zunächst erläutere ich jedoch allgemeintheoretisch die Pluralbildung des Deutschen. Im Anschluss daran definiere ich im dritten Kapitel die Optimalitätstheorie sowie die für die Pluralbildung relevanten Beschränkungen, um mit diesem Wissen das Zusammenwirken an einigen Beispielen zeigen zu können. Als Grundlage dazu dient das 1999 veröffentlichte Manuskript "German Noun Plural Reconsidered" von DIETER WUNDERLICH. Schließlich versuche ich, vorhandene Zweideutigkeiten bei der Pluralwahl mit Hilfe einer neuen Hierarchisierung der Beschränkungen einzudämmen. Eine kritische Bewertung dieser Theorie wird den Abschluss der Arbeit bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Plural im Deutschen
- 2.1 Bildung Allgemein
- 2.2 Systematisierung nach WEGENER
- 2.3 Zwischenfazit
- 3. Die Optimalitätstheorie
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.2 Ein nicht-linguistisches Beispiel
- 3.3 A constraint-based analysis von DIETER WUNDERLICH
- 3.3.1 Die einzelnen Beschränkungen
- 3.3.2 Hierarchie für die deutsche Pluralbildung
- 3.3.3 Anwendung der Optimalitätstheorie von WUNDERLICH
- 3.3.4 Versuch, durch neues Ranking Probleme zu lösen
- 3.4 Zwischenfazit: Kritik an WUNDERLICHS constraint-based analysis
- 4. Fazit
- 5. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Pluralbildung unter Anwendung der Optimalitätstheorie. Ziel ist es, die relevanten Beschränkungen der Theorie zu erläutern und mögliche Erklärungslücken hinsichtlich der deutschen Pluralformen aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Problematik des s-Plurals.
- Erläuterung der Pluralbildung im Deutschen
- Definition und Anwendung der Optimalitätstheorie
- Analyse der Beschränkungen der Optimalitätstheorie im Kontext der deutschen Pluralbildung
- Untersuchung der Problematik des s-Plurals
- Bewertung der Optimalitätstheorie zur Erklärung der deutschen Pluralbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Pluralbildung ein und hebt deren Komplexität hervor. Sie benennt die morphologischen und silbenphonologischen Beschränkungen des Systems und kündigt die Anwendung der Optimalitätstheorie als Erklärungsmodell an. Die Arbeit zielt darauf ab, die Beschränkungen der Theorie zu erläutern und auf mögliche Erklärungslücken hinzuweisen, insbesondere im Hinblick auf den s-Plural, der im weiteren Verlauf detaillierter untersucht wird. Die methodische Vorgehensweise – zunächst eine allgemeine Darstellung der deutschen Pluralbildung, gefolgt von der Definition der Optimalitätstheorie und deren Anwendung an Beispielen – wird skizziert.
2. Der Plural im Deutschen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der deutschen Pluralbildung. Es beginnt mit einer allgemeinen Beschreibung der Pluralbildungsformen (-e, -s, -(e)n, -er, Umlaut) und deren Abhängigkeit vom Genus des Substantivs, wobei die Unmöglichkeit, eine allgemeingültige Regel vom Singular zum Plural zu formulieren, hervorgehoben wird. Anschließend werden die Regeln für die Endungen und Umlaute nach Duden (Gallmann 2007) detailliert dargestellt, inklusive Grund- und Zusatzregeln sowie Sonderfälle. Der Fokus liegt besonders auf der Erläuterung der verschiedenen Pluralbildungstypen und deren morphologischen Bedingungen. Besondere Aufmerksamkeit erhält der s-Plural, der als relativ junge und „Behelfspluralform“ für nicht-lexikalisierte Elemente charakterisiert wird.
3. Die Optimalitätstheorie: Dieses Kapitel definiert die Optimalitätstheorie und erläutert ihre Anwendung auf die deutsche Pluralbildung. Es beginnt mit einer allgemeinen Begriffsdefinition der Optimalitätstheorie, die auf universalen, hierarchisierten und prinzipiell verletzbaren Beschränkungen basiert. Ein nicht-linguistisches Beispiel verdeutlicht die Grundprinzipien. Der Hauptteil des Kapitels befasst sich mit der constraint-based analysis von Dieter Wunderlich, wobei die einzelnen Beschränkungen, deren Hierarchie und die Anwendung auf die deutsche Pluralbildung detailliert dargestellt werden. Schließlich wird ein Versuch unternommen, vorhandene Zweideutigkeiten bei der Pluralwahl durch ein neues Ranking der Beschränkungen zu lösen. Die Kritik an Wunderlichs Ansatz bildet den Abschluss des Kapitels.
Schlüsselwörter
Pluralbildung, Deutsch, Optimalitätstheorie, morphologische Beschränkungen, silbenphonologische Beschränkungen, s-Plural, n-Plural, Umlaut, constraint-based analysis, Wunderlich, Wegener.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Deutsche Pluralbildung im Lichte der Optimalitätstheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die deutsche Pluralbildung unter Anwendung der Optimalitätstheorie. Der Fokus liegt insbesondere auf der Erklärung der verschiedenen Pluralformen, mit besonderem Augenmerk auf den s-Plural und den Herausforderungen, die seine Erklärung mit sich bringt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Darstellung der deutschen Pluralbildung, einschließlich der verschiedenen Bildungsweisen (-e, -s, -(e)n, -er, Umlaut). Sie erklärt die Optimalitätstheorie und wendet sie auf die deutsche Pluralbildung an, wobei die constraint-based analysis von Dieter Wunderlich im Detail untersucht wird. Die Arbeit bewertet die Leistungsfähigkeit der Optimalitätstheorie bei der Erklärung der deutschen Pluralformen und zeigt mögliche Schwächen auf.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit kombiniert deskriptive Linguistik mit der Anwendung eines formalen Modells (Optimalitätstheorie). Zuerst wird die deutsche Pluralbildung systematisch beschrieben, dann wird die Optimalitätstheorie eingeführt und anhand der deutschen Pluralbildung angewendet und kritisch evaluiert.
Welche Rolle spielt die Optimalitätstheorie?
Die Optimalitätstheorie dient als Erklärungsmodell für die komplexen Regeln der deutschen Pluralbildung. Die Arbeit untersucht, inwieweit die Theorie die verschiedenen Pluralformen und insbesondere den s-Plural adäquat erklären kann. Dabei werden die einzelnen Beschränkungen der Theorie analysiert und deren Hierarchie diskutiert.
Welche Probleme werden im Zusammenhang mit dem s-Plural diskutiert?
Der s-Plural wird als relativ junge und „Behelfspluralform“ für nicht-lexikalisierte Elemente charakterisiert. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die seine Erklärung im Rahmen der Optimalitätstheorie mit sich bringt, und untersucht mögliche Verbesserungen an bestehenden Modellen.
Wer ist Dieter Wunderlich und welche Bedeutung hat seine Arbeit?
Dieter Wunderlich ist ein Linguist, dessen constraint-based analysis der Optimalitätstheorie im Kontext der deutschen Pluralbildung im Detail in der Arbeit analysiert wird. Seine Arbeit dient als Grundlage für die Anwendung und kritische Bewertung der Theorie in dieser Arbeit.
Welche weiteren Autoren werden zitiert?
Neben Dieter Wunderlich wird auch Wegener zitiert, dessen Systematisierung der deutschen Pluralbildung im Kontext der Arbeit beschrieben wird. Darüber hinaus wird der Duden (Gallmann 2007) als Quelle für die Beschreibung der Regeln der Pluralbildung im Deutschen herangezogen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse ihrer Analyse der deutschen Pluralbildung im Lichte der Optimalitätstheorie zusammen und bewertet die Stärken und Schwächen des gewählten Erklärungsmodells. Sie zeigt auf, wo die Optimalitätstheorie gut funktioniert und wo sie an ihre Grenzen stößt, insbesondere bei der Erklärung des s-Plurals. Das Fazit gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und mögliche zukünftige Forschungsansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Pluralbildung, Deutsch, Optimalitätstheorie, morphologische Beschränkungen, silbenphonologische Beschränkungen, s-Plural, n-Plural, Umlaut, constraint-based analysis, Wunderlich, Wegener.
- Quote paper
- Ellen Thießen (Author), 2008, Die Pluralbildung im Deutschen: Eine Untersuchung an Hand der Optimalitätstheorie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135874