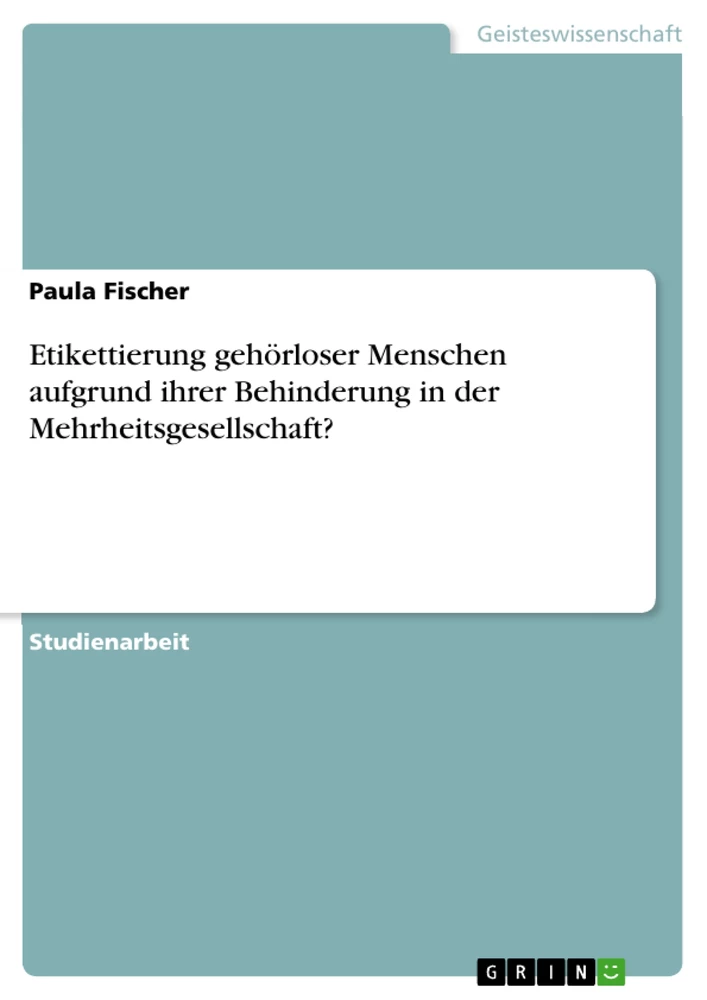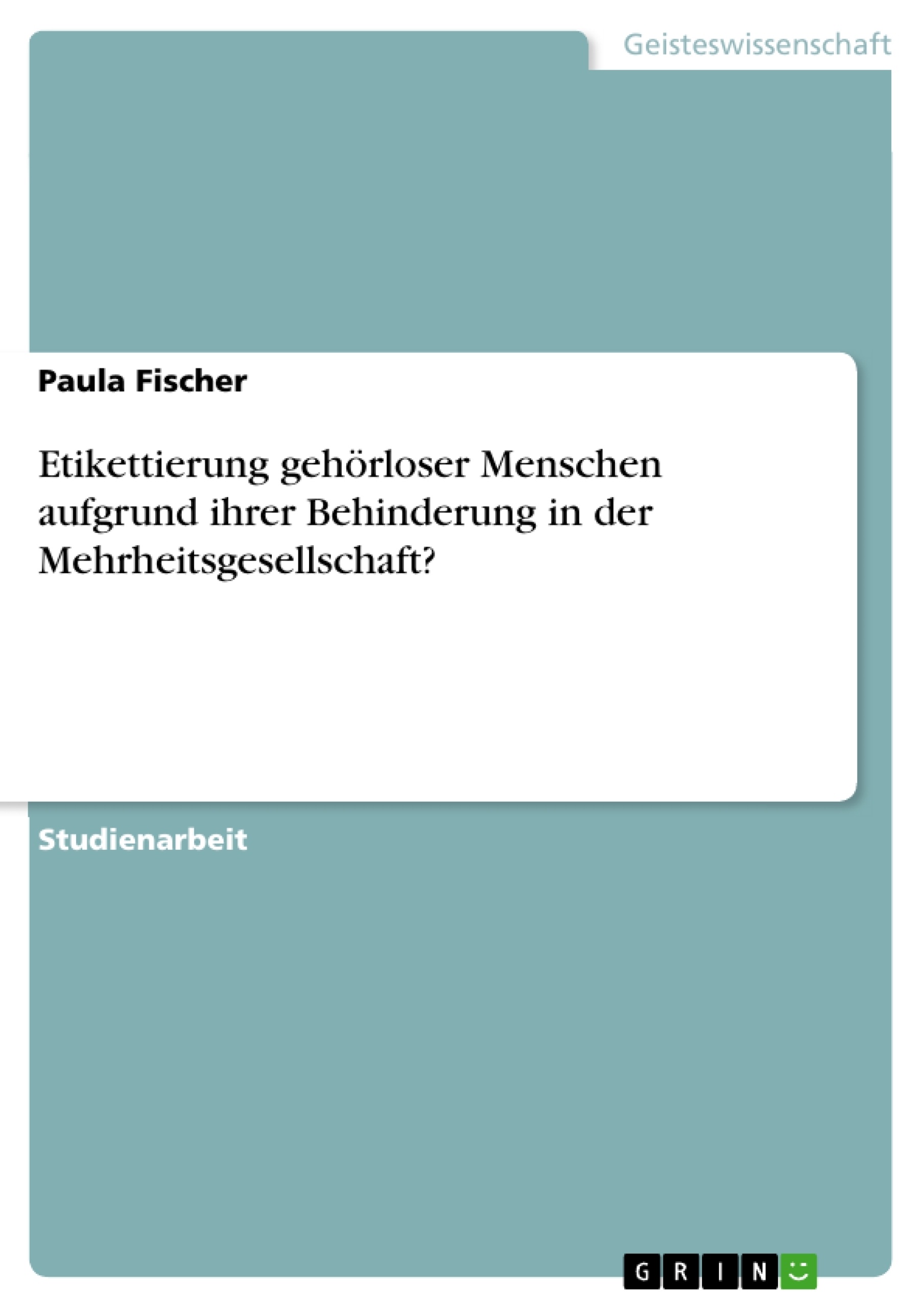Fokussieren möchte ich mich in meiner Hausarbeit auf die Zuordnung und Etikettierung von Behinderung. Wie kommt es eigentlich zu den vorherrschenden Bildern in unserer Gesellschaft? Nähern möchte ich mich diesem Thema auseinandersetzen, indem ich das Normalitätsprinzip vorstelle. Auch die damit einhergehende Diskriminierung und gewisse Erwartungshaltungen an Menschen mit Behinderung möchte ich benennen. Mit Beispielen aus Sarah Neefs Biografie werde ich meine Arbeit unterstützen. Abschließend möchte ich für die Dekategorisierung und Nichtettiketierung plädieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Normalität und Norm
- Zuordnung von Behinderung
- Kategorisierung und Etikettierung
- Umgang mit Andersartigkeit
- Erwartungshaltungen
- Vorurteile
- Diskriminierung
- Dekategorisierung und Nichtettiketierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Etikettierung von Gehörlosen in der Mehrheitsgesellschaft und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen. Im Zentrum steht die Frage, wie gesellschaftliche Normen und Normalitätsvorstellungen zur Zuschreibung von Behinderung führen und welche Folgen dies für die Lebensrealität von Menschen mit Hörbehinderung hat.
- Das Konzept der Norm und Normalität als Grundlage für die Differenzierung und Kategorisierung von Menschen
- Die Zuordnung von Behinderung und die damit verbundene Stigmatisierung sowie Diskriminierung
- Die Folgen von Kategorisierung und Etikettierung für die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderung
- Der Umgang mit Andersartigkeit und die Herausforderungen, die sich aus der Abgrenzung zwischen "Behinderung" und "Nichtbehinderung" ergeben
- Die Dekategorisierung und Nichtettiketierung als wichtige Schritte für die Inklusion und die Anerkennung von Menschen mit Behinderung als Individuen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit dem Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft und beleuchtet die Diskriminierung und Stigmatisierung, denen Gehörlose häufig ausgesetzt sind. Die Inspiration für die Arbeit liefert die Biografie von Sarah Neef, die die Herausforderungen beschreibt, die sich aus der gesellschaftlichen Etikettierung von Gehörlosen ergeben.
- Normalität und Norm: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung von Normen und Normalitätsvorstellungen in der Gesellschaft und deren Einfluss auf die Kategorisierung von Menschen. Die Norm wird als ein Orientierungspunkt für die Differenzierung und Abgrenzung von Menschen mit Behinderung dargestellt.
- Zuordnung von Behinderung: Hier wird die Zuordnung von Behinderung anhand des Beispiels der Gehörlosigkeit beleuchtet. Die Arbeit zeigt, wie die gesellschaftliche Konstruktion von Behinderung zu Diskriminierung und Vorenthaltung von Anerkennung führt.
- Kategorisierung und Etikettierung: Dieses Kapitel erläutert den Prozess der Etikettierung und die Auswirkungen von Kategorisierung auf Menschen mit Behinderung. Die Arbeit betont die negativen Folgen von Etikettierung für die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl von Betroffenen.
- Umgang mit Andersartigkeit: Hier wird der Umgang mit Andersartigkeit im Kontext von Behinderung diskutiert. Die Arbeit zeigt auf, wie Behinderung häufig als Negativabweichung von der Norm betrachtet wird und welche Herausforderungen sich aus der Abgrenzung zwischen "Behinderten" und "Nichtbehinderten" ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Norm, Normalität, Behinderung, Kategorisierung, Etikettierung, Andersartigkeit, Diskriminierung, Inklusion, Dekategorisierung und Nichtettiketierung. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft aufgrund von gesellschaftlichen Normen und Normalitätsvorstellungen gegenüberstehen.
- Quote paper
- Paula Fischer (Author), 2021, Etikettierung gehörloser Menschen aufgrund ihrer Behinderung in der Mehrheitsgesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1358236