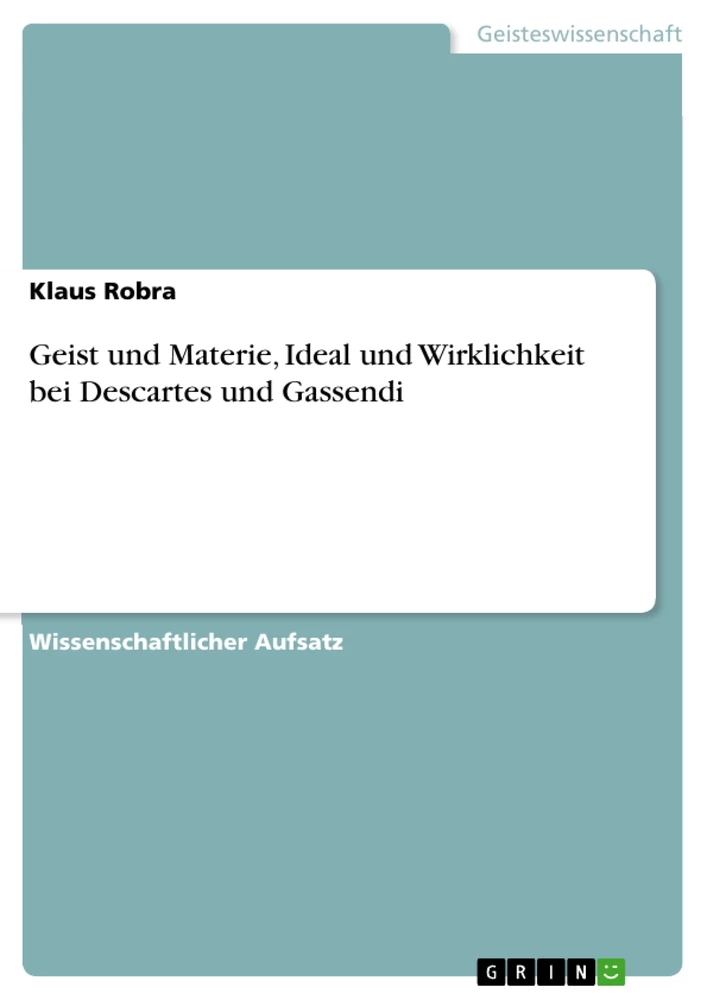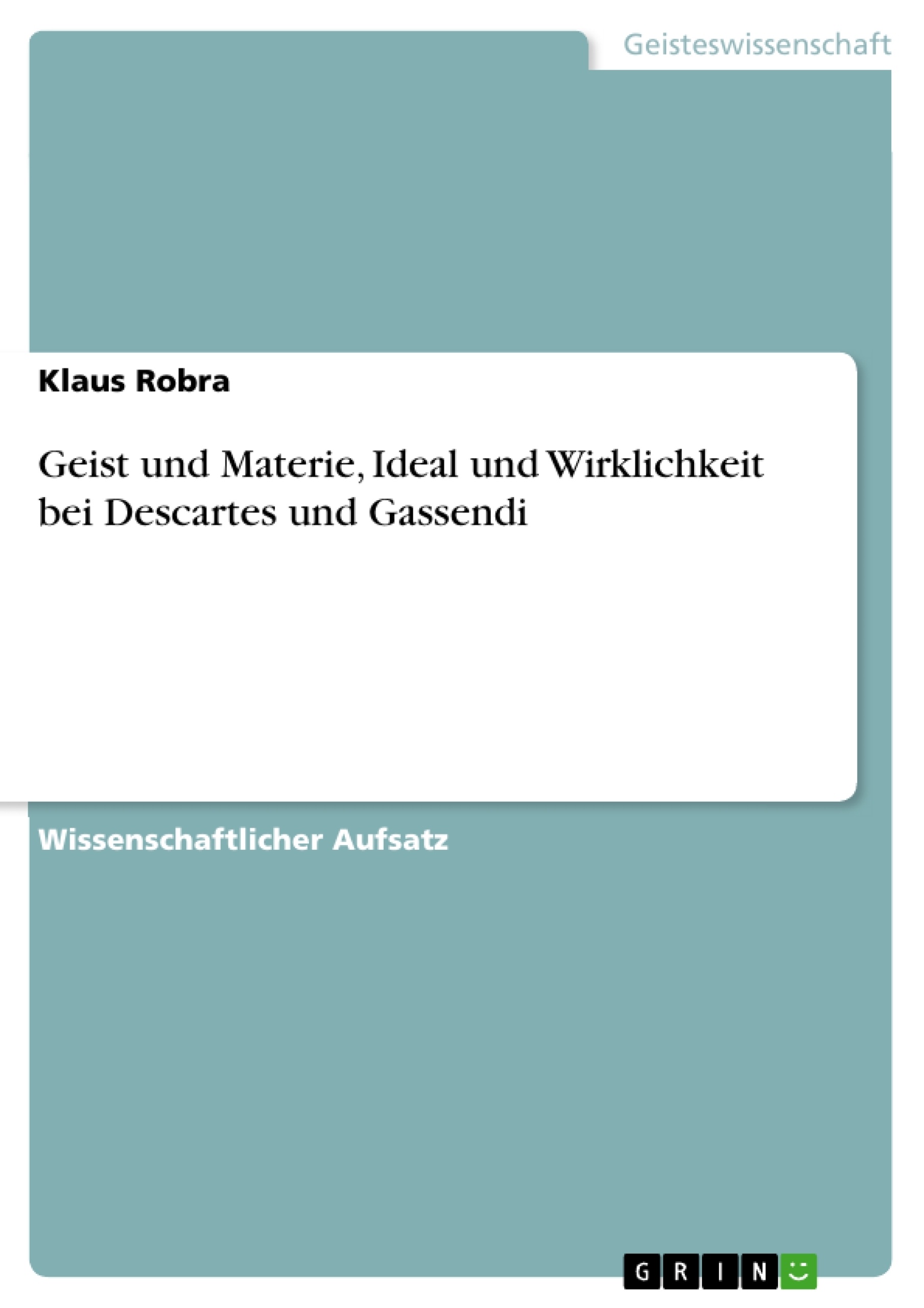Dialektisch-materialistische Bestimmungen von Geist und Materie sind erst möglich, seitdem es ausgearbeitete Formen des Dialektischen Materialismus gibt, wozu bekanntlich Marx und Engels Pionierarbeit geleistet und dabei neue Synthesen von Materialismus und Idealismus entwickelt haben; Marx vor allem durch seine Kritik am idealistischen Geist-Begriff Hegels, der ja sogar eine Verknüpfung mit dem „Absoluten Wissen“ des Philosophen Hegel enthält.
Demgegenüber wirkt die frühneuzeitliche Kontroverse zwischen Descartes und Gassendi eher wie eine Art Vorgeplänkel, wenn auch nicht ohne Tiefgang. Auffällig und aufschlussreich ist aber die Tatsache, dass diese Kontroverse erst durch Descartes‘ vielfältige neue Überlegungen möglich geworden ist. Darüber hinaus steht nicht nur das Cogito, sondern auch Gassendis materialistische Reaktion darauf am Beginn der neuzeitlichen Philosophie. Insofern haben auch diese beiden Kontrahenten Pionierarbeit geleistet und entscheidende Weichenstellungen für die Entwicklung der modernen Geistesgeschichte bewirkt. Folglich liegt es nahe, zunächst an die Grundlagen und Grundzüge der Theorien von Descartes und Gassendi zu erinnern.
Klaus Robra
Geist und Materie, Ideal und Wirklichkeit: Descartes und Gassendi Eine Kontroverse am Beginn der neuzeitlichen Philosophie
Einleitung
Geist und Materie scheinen auf den ersten Blick völlig gegensätzliche, nicht miteinander vereinbare Begriffe zu sein. Erst recht, wenn man den Geist als „immateriell“ und die Materie als „Stoff“ versteht. Dennoch vermeidet der Dialektische Materialismus diesen Dualismus, und zwar folgendermaßen:
Als Vergleichsparameter, tertium comparationis, für Materie und Geist kann der
Mensch selbst angenommen werden, genauer gesagt: die Person, d.h. „der Gesamtumfang des Menschen“ (‚le volume total de l’homme‘, gemäß einer Definition von Emmanuel Mounier). Als Körper-Seele-Geist-Wesen kann die Person sowohl aus der Sicht auf die Materie als auch aus der Sicht auf Psyche und Geist verstanden werden, was aber keinen wie auch immer gearteten Dualismus von Körper und Seele bewirken muss. Ausgeschlossen scheint dies aus dem einfachen Grund, dass die ursprüngliche materielle Welt zweifellos die Grundlage der Existenz des Menschen ist. Auch die Faktizität des Menschen, einschließlich seines psychischen und geistigen Seins, beruht nachweislich auf der Materie, genauer: auf dem Sein-in-Möglichkeiten der Materie bzw. auf den ihr innewohnenden Informationen, Zielen und Zwecken. Das „Logikon der Materie“ (Ernst Bloch), d.h. die Telos-Strukturen der Materie, ihre latenten und offenkundigenMöglichkeiten von In-formation, Zweck, Ziel und Bedeutung, haben den menschlichen Geist hervorgebracht, nicht umgekehrt. Dies ist die Grundlage und zugleich ultima ratio des Materialismus.
Um den Geist näher zu erklären, bedient sich der dialektische Materialismus der Dialektik zwischen Subjekt und Objekt. Schelling ging so weit, Geist auch der Natur zuzuschreiben, und zwar als dialektische, „ objektive Subjekt-Objekt-Beziehung“, während der Geist des Menschen als eine subjektive Subjekt-Objekt-Beziehung dialektischer Art zu verstehen sei. Die erste Hypothese, die sich auf die Natur bezieht, beruht auf einer theologischen Spekulation, dem Pantheismus; wohingegen die zweite Hypothese wissenschaftlich belegt, also in den Rang einer begründeten These erhoben werden kann, zumal mentale Objekte neurowissenschaftliche Konzepte sind (Jean-Pierre Changeux 1983): Im Gehirn finden nachprüfbare Subjekt-Objekt-Beziehungen statt. Wir beziehen uns nachweislich auf unsere Gefühle, Wahrnehmungen, Vorstellungen und mentalen (gedanklichen) Operationen, die durch Sprache und/oder nichtsprachliche Mittel vermittelt werden. Nicht nur das körperliche Sein, sondern auch Gefühle, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Intellekt, Vernunft und Geist lassen sich somit als Realisierungen von Möglichkeiten der Materie erklären.1
Bestimmungen dieser Art sind erst möglich, seitdem es ausgearbeitete Formen des Dialektischen Materialismus gibt, wozu bekanntlich Marx und Engels Pionierarbeit geleistet und dabei neue Synthesen von Materialismus und Idealismus entwickelt haben; Marx vor allem durch seine Kritik am idealistischen Geist-Begriff Hegel s, der ja sogar eine Verknüpfung mit dem „Absoluten Wissen“ des Philosophen Hegel enthält.
Demgegenüber wirkt die frühneuzeitliche Kontroverse zwischen Descartes und Gassendi eher wie eine Art Vorgeplänkel, wenn auch nicht ohne Tiefgang. Auffällig und aufschlussreich ist aber die Tatsache, dass diese Kontroverse erst durch Descartes‘ vielfältige neue Überlegungen möglich geworden ist. Darüber hinaus steht nicht nur das Cogito, sondern auch Gassendis materialistische Reaktion darauf am Beginn der neuzeitlichen Philosophie. Insofern haben auch diese beiden Kontrahenten Pionierarbeit geleistet und entscheidende Weichenstellungen für die Entwicklung der modernen Geistesgeschichte bewirkt. (Was, soweit ich sehe, bisher nur selten mit der gebotenen Intensität gewürdigt worden ist.) – Folglich liegt es nahe, zunächst an die Grundlagen und Grundzüge der Theorien von Descartes und Gassendi zu erinnern.
a)Descartes (1596-1650): „Freiheit nicht in Gott, sondern Gott entgegen“
Was meint der Romanist Erich Auerbach, wenn er behauptet, René Descartes habe „die Sphäre der menschlichen Freiheit nicht in Gott, sondern Gott entgegen“[2 ] erkämpft? Es bedeutet zunächst, dass Descartes sein neuartiges System zwar durch Gottesbeweise stützt, damit aber unmittelbar weder die Freiheit noch die Subjektivität des Menschen verbindet. Im Unterschied zur Scholastik leitet er nämlich beide Grundwerte nicht aus Gott, sondern aus eigenen Überlegungen ab. Wobei er immer wieder betont, dass es sich um strikt Persönliches handele, das er anderen keinesfalls aufzwingen will, obwohl er andererseits, unter Hinweis auf den „gesunden Menschenverstand“ (‚bon sens‘), durchaus allen Menschen zutraut, seine Gedanken nachzuvollziehen.
Dem Zeitgeist entsprechend stellt er anfangs alles in Frage, d.h. er nimmt sich die Freiheit, alles und jedes zu bezweifeln, wenn auch mit dem Ziel, einen sicheren Standpunkt zu gewinnen, einen Ausgangspunkt, um „alles Erkannte aus einfachsten Prinzipien“ ableiten zu können. Sicher aber erscheint ihm zunächst gar nichts. Nicht die eigenen Bildung, nicht die Lehren, die er aus dem Zusammenleben mit anderen Menschen gezogen hat, nicht die eigene Umgebung, ja, nicht einmal die eigene Existenz. Er misstraut nicht nur den Sinnen (weil sie täuschen können), sondern sogar der Wissenschaft (der Mathematik), weil sogar der Verstand den Menschen „in die Irre“ führen könne.
Und doch kommt dieser Zweifelstaumel schließlich zum Halt, denn plötzlich heißt es:
„Beginne ich nun also das Philosophieren damit, daß ich schlechthin alles in Frage stelle, so gibt es doch etwas, das ich nicht nur nicht bezweifeln kann, das mir vielmehr, gerade indem und je mehr ich zweifele, immer gewisser werden muß: nämlich die einfache Tatsache, daß ich jetzt, in diesem Moment, zweifle, das heißt denke. Alles, was ich von außen wahrnehme, könnte Täuschung sein, alles, was ich denken mag, könnte falsch sein – aber im Zweifel werde ich jedenfalls meiner selbst als eines denkenden Wesens gewiss.“
Und das bedeutet: „Cogito ergo sum“ (‚je pense donc je suis‘ – ich denke, also bin ich, vgl. Störig 1961, S. 360 f.)
Das ist der Anfang einer neuen Philosophie, ja, einer neuen Epoche der Philo-sophie. Descartes vergewissert sich seiner eigenen Existenz im Denken, was allerdings nicht missverstanden werden darf: Descartes leitet nicht alles Sein aus dem Denken ab, sondern findet in dem unbezweifelbaren Faktum der eigenen Existenz ein „unerschütterliches Fundament“ (‚fondement inébranlable‘) des Denkens.
Wozu Descartes im 4. Teil des Discours de la méthode selbst bemerkt, er habe, im Anschluss an die Selbstvergewisserung durch das Cogito ergo sum, nach der Leistungsfähigkeit eben dieses Cogito und nach Kriterien für die Wahrheit einer Aussage gefragt, nach „ce qui est requis à une proposition pour être vraie et certaine“.[3 ] Er fand Gewissheit im Cogito und will nun wissen, worin diese Gewissheit Bestand haben kann:
„Et ayant remarqué qu‘il n’y a rien du tout en ceci: je pense, donc je suis, qui m’assure que je dis la vérité, sinon que je vois clairement que, pour penser, il faut être, je jugeai que je pouvais prendre pour règle générale, que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu’il y a seulement quelque difficulté à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement.“ (ebd.)
Auf Deutsch:
„Und nachdem ich bemerkt hatte, dass es in dem Satz: ich denke, also bin ich nichts gibt, was mir die Gewissheit gibt, dass ich die Wahrheit sage, wohl aber, dass ich klar sehe, dass man sein muss, um zu denken, befand ich, dass ich mich an die allgemeine Regel halten konnte, dass alle Dinge (bzw. Zusammenhänge) wahr sind, die wir sehr klar und sehr deutlich (d.h. unterscheidbar) begreifen, und dass es jedoch einige Schwierigkeiten bereitet, genau festzustellen, welche diejenigen Zusammenhänge sind, die wir deutlich unterscheidbar begreifen.“ (Hervorhebungen und Klammern durch mich.)
„Je suis une chose qui pense – ich bin ein Wesen, das denkt“
Wer sich seiner selbst als eines denkenden Wesens vergewissert, erkennt sich selbst anscheinend als res cogitans (als ‚denkende Sache‘): „Je suis une chose qui pense“ – ich bin ein Wesen, das denkt, erklärt Descartes. Welche Werte-Ordnung er damit neu einführt, erhellt aus der französischen Fassung besser als aus dem lateinischen ‚sum res cogitans‘ (‚ich bin eine denkende Sache‘). Wer nämlich sagt, „je suis une chose qui pense“, ordnet der Gewissheit des eigenen Seins (‚je suis‘ – ich bin) die Gewissheit der chose unter, und dieser wiederum die Gewiss-heit des eigenen Denkens (‚je pense‘). Chose hier nicht mit ‚Ding‘ oder ‚Sache‘, sondern mit ‚Wesen‘ zu übersetzen, rechtfertigt sich sowohl aus Descartes‘ Sprachgebrauch als auch aus der Herkunft des Wortes ‚chose‘: dem lateinischen ‚causa‘.[4 ]
Descartes fundiert das Denken im eigenen Ich, weiß aber sehr wohl, dass er die Existenz dieses Ichs nicht sich selbst verdankt. Anders als ‚res‘ verweist ‚chose‘ auf lateinisch ‚causa‘, den Grund, die Ursache. Und die letzte Ursache kann für Descartes nichts anderes sein als Gott selbst, wie er auch in zwei unter-schiedlichen Gottesbeweisen nachzuweisen versucht.
Diese Gewissheiten logisch einwandfrei unter einen Hut, auf einen Nenner, zu bringen, gelingt Descartes nicht immer. Gemäß christlicher Überlieferung ist der Mensch durch die Unsterblichkeit der Seele mit Gott verbunden. Hierauf kann und will Descartes auf keinen Fall verzichten, und zwar wohl nicht nur aus Vor-sicht vor der Inquisition, sondern aus einer tiefen Glaubensüberzeugung, in der sowohl Gott als auch der Mensch eine Sonderstellung einnehmen. Dieser will Descartes durch seine Lehre von den drei „Substanzen“ (drei eigenständigen Wesenheiten) gerecht werden. Es sind dies 1.) Gott als erste Ursache allen Seins, 2.) der Mensch als chose qui pense und 3.) die im Raum ausgedehnte Materie, die chose étendue (‚res extensa‘).
Wenn aber 2) und 3) eigenständige Wesenheiten („Substanzen“) sind, treten Geist und Körper, Leib und Seele scheinbar auseinander – ein Widersinn, zumal Descartes selbst später sogar eine Wechselwirkung von Leib und Seele annimmt. Diesen Widerspruch aufzulösen, hat der Autor nie versucht. In seinen zahlreichen Werken finden sich aber genügend Hinweise darauf, dass er die menschliche Person sehr wohl als Einheit begriffen hat.[5 ] In Nr. 63 seiner „Prinzipien der Philosophie“ betrachtet er sogar Denken und Ausdehnung als „les choses princi-pales qui constituent la nature de la substance intelligente et corporelle“[6 ] (‚die Haupt-Sachen, welche die Natur der intelligenten und körperlichen Substanz ausmachen‘) – mithin startet er einen Versuch, sogar eine umgreifende „Sub-stanz“ aus Körper und Geist als Einheit darzustellen. Womit er sich allerdings teilweise selbst widerspricht, denn an anderer Stelle betont er, dass Gott – als oberste Substanz – derjenige ist, der die voneinander abgegrenzten Substanzen Denken und Ausdehnung durch seine Allmacht zusammenhält (vgl. K. Robra a.a.O. 1988, S. 71).
Angemessen erscheinen jedenfalls die Schlussfolgerungen von Dominik Perler, wonach Descartes nicht nur eine „funktionelle“, sondern sogar eine „essentielle“ Einheit von Leib und Seele angenommen hat (auch wenn die Bedeutungssphären von ‚Substanz‘ und ‚Essenz‘ sich in dem Begriff ‚Wesen‘ teilweise überschneiden). – Einheitliches Subjekt ist das denkende Ich.7
Freiheit, Wille und Erkenntnis
Was wäre das Subjekt ohne Freiheit? Es wäre nur noch ein ‚subiectum‘, wörtlich „ein Darunter-Geworfenes“, ein allem Möglichen und Wirklichen Unterworfenes, mithin nicht selbstbestimmt, nicht eigenen Zwecken folgend, sondern vollkommen fremdbestimmt. Ein solches Wesen wäre total situationsbedingt und damit wahrscheinlich übler gestellt als jedes andere Lebewesen. Tatsache ist aber, dass ein menschliches Subjekt seine eigene Lage beurteilen kann und daher niemals total situationsbedingt ist.[8 ]
Dieser Fähigkeit will Descartes gerecht werden, indem er dem Menschen Willens- und Entscheidungsfreiheit zubilligt. Dazu benutzt er die Begriffe ‚ libre arbitre ‘ (wörtlich: „freier Schiedsrichter“), ‚ liberté de ma volonté ‘ und ‚ liberté de notre volonté‘ (also Freiheit meines und unseres Willens!). Freiheit und Wille gehören demnach natur- und erfahrungsgemäß zusammen, nicht als bloße Verstandeskategorien (wie es der ‚libre arbitre‘ vermuten lassen könnte). Letztlich zählt Descartes die Willensfreiheit zu drei großen, von Gott gestifteten „Wundern“ (neben der Schöpfung aus dem Nichts und der Menschwerdung Gottes).[9 ]
Die Willensfreiheit bedarf keines Beweises, wie Descartes in Nr. 39 seiner Prinzipien der Philosophie (von 1644) betont. Erkennbar ist sie vielmehr daran, dass sie Wahlfreiheit, nämlich Zustimmung oder Ablehnung, ermöglicht (ebd.). Was wir nicht genau kennen, brauchen wir nicht zu akzeptieren. Darüber hinaus haben wir nicht nur die Freiheit, alles zu bezweifeln, sondern auch, jeglichen Zweifel zu beenden, wenn gute Gründe – wie die des Cogito ergo sum – dieses klar und deutlich nahe legen. Willensfreiheit bedeutet Handlungsfreiheit, weil wir zwischen Richtig und Falsch unterscheiden und daher unserem selbstbestimmten Willen vertrauen können (37. Prinzip).
Das Cogito wird zur Grundlage einer neuen Anthropologie, in der Descartes den Menschen als denkendes, geistbestimmtes, mit Willensfreiheit begabtes Wesen auffasst. Den Gedanken der Willensfreiheit verknüpft er immer wieder mit erkenntnistheoretischen Überlegungen, so z.B. im Folgenden:
„Der freie Wille ermöglicht es dem Menschen, diese Vorstellungen zu bejahen, jene zu verwerfen. Nur in dieser Tätigkeit des Willens, nicht in den Vorstellungen selbst, liegt die Quelle allen Irrtums. Wir haben es selbst in der Hand, richtig oder falsch zu denken und zu erkennen. Wenn wir uns nur an den Maßstab halten, der uns mit der unvergleichlichen Gewißheit und Deutlichkeit jener ersten Grunderkenntnisse an die Hand gegeben ist, wenn wir nur das als wahr annehmen, was mit gleicher Gewißheit erkannt ist, allem anderen gegenüber uns skeptisch verhalten, so können wir nicht irren, sondern gewinnen denkend ein richtiges Bild der Welt.“ (zitiert von Störig a.a.O. S. 362).
Dabei entwickelt Descartes keine Wahrheitstheorie, setzt vielmehr das Unterscheidungsvermögen auf Grund des bon sens, des gesunden Menschen-verstandes, als bei allen Menschen vorhanden voraus und fragt sich, wie das Ich-Subjekt die Objekte der Innen- und Außenwelt richtig erkennen und analysieren kann.
Zukunftsträchtig: Neue Ideentheorie, Neubestimmung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt, des Urteilsvermögens und der Methode
Warum aber täuscht sich der Mensch nicht selten, obwohl er zwischen Richtigem und Falschem zu unterscheiden vermag? Warum wählt er zuweilen sogar wider besseres Wissen das Falsche? An Gott kann es nicht liegen, sagt Descartes, denn Gott repräsentiert für ihn Vollkommenheit, vollkommene Güte, reines Sein. Ein solches höchstes Wesen könne nicht täuschen. Vielmehr entstehe die Möglichkeit des Irrtums aus der eigentümlichen Zwischenstellung des Menschen zwischen dem Sein und dem Nichts. Ähnlich wie Campanella sieht Descartes den Menschen als ein durch die Negation des Seins (Tod, Vernichtung) bedrohtes Wesen an.
Umso wichtiger wird es, sich zunächst Klarheit darüber zu verschaffen, wie die Denk- und Erkenntnisakte sich tatsächlich vollziehen. Am Beispiel der Betrach-tung eines Stückchens Wachs erklärt Descartes, worauf es ankommt: Nicht „unvollkommen und konfus“, sondern „ klar und deutlich “ das zu sehen und zu erkennen, woraus der Gegenstand objektiv und nachweislich besteht. Aussage und Sachverhalt, subjektive und objektive Information, müssen übereinstimmen. Jede Information ruft aber im Bewusstsein eine Vielzahl von Ideen hervor. Diese können den Bereichen der Wahrnehmung, der Vorstellung und des begrifflichen Denkens entstammen. Nur wenn die wesentlichen Merkmale und Eigenschaften des Gegenstands klar und deutlich – und zwar durch klare und deutliche Begriffe (!) – erfasst und bezeichnet werden, kann der Denkakt gelingen. Ideen fasst Descartes also als dynamische, operative Denkvorgänge auf (und nicht etwa im Sinne der Platonischen Ideenlehre).
Was aber heißt „klar und deutlich“? Und wodurch werden Klarheit und Deutlichkeit zu entscheidenden Kriterien wahrer Erkenntnis? Den deutschen Adjektiven und Adverbien ‚klar‘ und ‚deutlich‘ entsprechen im Lateinischen als Adverbien ‚clare‘ und ‚distincte‘, im Französischen ‚clairement‘ und ‚distinctement‘. Klarheit erreicht der Verstand durch das „natürliche Licht“ (‚lumière naturelle‘) der (angeborenen) Ideen bzw. Allgemeinbegriffe, „Distinktion“ (eigentlich: ‚Unterschieden-Sein‘) dadurch, dass diejenigen Merkmale und Eigenschaften eines Gegenstands, die ihn deutlich von allen anderen unterscheiden, durch korrekte, angemessene Begriffe dargestellt werden.
Erstaunlich ist nun, dass Descartes diese intellektuellen Tätigkeiten keineswegs als bloße Leistungen des Verstandes auffasst, sondern die gleichzeitige Aktivierung des Willens für ausschlaggebend hält. (Womit er überraschender Weise Erkenntnisse der modernen Psychologie und Hirnforschung vorwegnimmt, wonach jeder Denkakt von Unterbewusstem mitgetragen und mitgesteuert wird!)
Descartes hält nämlich den Intellekt und den Willen für die Grundvermögen des Geistes, auf denen auch das Urteilsvermögen beruhe. Dadurch setzt er sich von der scholastischen Tradition ab, die das Urteilsvermögen einzig und allein dem Verstand, dem Intellekt, zuordnete. Dominik Perler bemerkt hierzu (a.a.O. S. 162): „Der Intellekt liefert die Idee, und der Wille liefert den Akt des Zustimmens oder Ablehnens. Liefert der Wille einen zustimmenden Akt für eine klare und deutliche Idee, kommt ein wahres Urteil zustande.“ Ist dies nicht der Fall, entstehen Verwirrung und Falschheit, wofür dann letztlich der Wille verantwortlich sei. Auf jeden Fall müsse daher verhindert werden, dass, so Descartes „der Wille sich weiter erstreckt als der Intellekt“ (ebd.). – Erst durch den Willen werden Klarheit und Deutlichkeit zu entscheidenden Kriterien.
Wie aber können solche Grundsätze für die Wissenschaft, d.h. für das konkrete wissenschaftliche Arbeiten, fruchtbar werden?
Descartes hat auch hierfür ein klares Programm in Form einer Methodologie entworfen, die ich hier leider nicht ausführlich würdigen kann, so dass ich mich mit den folgenden Hinweisen begnügen muss:
„Im zweiten Teil des Discours … formuliert Descartes vier Grundprinzipien: (1) Man darf in einer Untersuchung nur von dem ausgehen, was wahr ist und mit Evidenz gewußt wird. Alles, was nur vermutet wird und bezweifelt werden kann, muß vermieden werden. (2) Man muß alle Problemstellungen in einer Untersuchung derart in kleinere Einheiten unterteilen, daß man zunächst bei jenen Problemen ansetzt, die sich lösen lassen. (3) Man muß bei den einfachen und leicht zu erkennenden Dingen ansetzen und dann in einem geordneten Verfahren schrittweise zu den schwierigeren Dingen vordringen. (4) Man muß die Probleme stets möglichst vollständig aufzählen und darauf achten, daß man nichts ausgelassen hat.“ (Perler a.a.O. S. 51)
Reduktion – als Rückgang auf das Einfache – und Konstruktion – als allmäh-liches Fortschreiten zu immer komplexeren Erkenntnissen und Ergebnissen – werden hier miteinander verbunden. Darüber hinaus hoffte Descartes, Regeln für eine Allgemeinwissenschaft auf mathematischer Grundlage („mathesis uni-versalis“) erarbeiten zu können.
b)Gassendi
Über ihn findet sich bei Wikipedia der folgende Eintrag:
Pierre Gassendi (auch Pierre Gassend, lateinisch Petrus Gassendi; * 22. Januar 1592 in Champtercier, Provence; † 24. Oktober 1655 in Paris) war ein französischer Theologe, Naturwissenschaftler und Philosoph. Er forschte u. a. als Astronom und stand als solcher mit Galileo Galilei und Christoph Scheiner in häufigem Kontakt.
Biografie
Seine Eltern waren Françoise Fabry und Antoine Gassend. Erst später wurde der Vokal „i“ zum Namen hinzugefügt…. Er entstammte einer bäuerlichen Umgebung. Durch seinen Onkel mütterlicherseits, den katholischen Priester Thomas Fabry, erhielt Pierre seine ersten schulischen Unterweisungen.
Bereits mit 16 Jahren wurde Gassendi als Lehrer der Rhetorik in Digne angestellt, wo er sein Studium begonnen hatte. Später studierte er in Aix-en-Provence und Avignon Theologie und wurde zum Priester geweiht. Nach der Promotion 1614 in Avignon wurde er 1616 Professor der Philosophie in Aix. Nachdem die Jesuiten die Leitung der Universität übernommen hatten, entschloss er sich, seine Professur aufzugeben und begann mit der Ausarbeitung eines umfangreichen Werkes Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos, in dem er sich mit der herrschenden aristotelischen Philosophie kritisch auseinandersetzte. Das erste Buch dieses Werkes erschien anonym 1624 in Grenoble, mit Namensnennung 1649 in Amsterdam. Den ursprünglichen Plan, die gesamte peripatetische Philosophie abzuhandeln, gab er auf; das 2. Buch über die Dialektik erschien erst in den Opera omnia (Lyon 1658).
Gassendi stand in Kontakt zu vielen Gelehrten und Wissenschaftlern seiner Zeit; seine engsten Vertrauten wurden der Astronom und Gelehrte Nicolas-Claude Fabri de Peiresc und der Mathematiker und Theologe Marin Mersenne, die ihn wiederum mit Gabriel Naudé, François de La Mothe le Vayer, Joseph Gaultier (1564–1647) u.a. bekannt machten. Zu seinen Korrespondenzpartnern gehörten Christoph Scheiner, Galileo Galilei, Eerryk van de Putte (1574–1646), Gerhard Johannes Vossius.
Seit 1625 beschäftigte sich Gassendi intensiv mit der Philosophie Epikurs, die er aus den antiken Quellen adäquat zu rekonstruieren versuchte. 1647 erschien seine Biographie Epikurs mit der Widerlegung der seit der Antike üblichen Diffamierungen seiner Person: De vita et moribus Epicuri, zwei Jahre später die kommentierte Übersetzung der Hauptquelle der Philosophie Epikurs, das 10. Buch von De vita et moribus philosophorum des Diogenes Laertios sowie eine systematische Rekonstruktion der gesamten epikureischen Philosophie unter dem Titel Philosophiae Epicuri Syntagma, basierend auf Diogenes Laertius, Lukrez und anderen antiken Quellen, insbesondere Cicero und Seneca. Diese Darstellung ist bis ins 19. Jahrhundert hinein maßgeblich gewesen.
Mit großem Interesse verfolgte Gassendi die naturwissenschaftlichen Forschungen seiner Zeit, beispielsweise diejenigen Galileis, und beteiligte sich an ihnen. So gelang ihm am 7. November 1631 die erste Beobachtung eines Merkurtransits, der von Johannes Kepler vorausberechnet worden war. Problemen der Dynamik sind seine Studien De proportione qua gravia decidentia accelerantur und De motu impresso a motore translato gewidmet, die zwischen 1642 und 1645 erschienen.
Gassendi wurde 1634 zum Propst der Kathedralkirche zu Digne ernannt. 1645 erneut zum Professor berufen, kam er – wahrscheinlich auf Veranlassung von Richelieu – an das Collège de France in Paris, wo er Mathematik bzw. Astronomie lehrte. Allerdings konnte er seiner schwachen Gesundheit wegen die Lehrtätigkeit nur kurze Zeit ausüben.
Nach längerer Krankheit starb Gassendi im Alter von 63 Jahren im Hause eines Gönners, des Edelmannes Habert de Montmor.
Theologisch-philosophische Leistung
An die atomistische Lehre Epikurs anknüpfend, vertrat Gassendi – entgegen der dualistischen Weltauffassung Descartes' (Geist und Materie) – die „nur“ materialistische Weltanschauung. Damit setzte er sich nicht nur von Descartes, sondern letztlich auch von Platon und Aristoteles ab. Schon in Aix hatte er ein Werk Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos verfasst, von dem nur das erste (1624) und das zweite Buch (1659, postum) veröffentlicht wurden („ ...welche Faulheit, statt mit den eigenen Augen nur mit den Augen des Aristoteles zu sehen und statt die Natur selbst nur die Schriften des Aristoteles über die Natur zu studieren! “). Im Übrigen machte schon Gassendi Descartes zum Vorwurf, was später Immanuel Kant einwenden wird: Descartes habe in seinem Gottesbeweis die Existenz unter die Eigenschaften (Gottes) gezählt. Dabei sei Existenz etwas grundsätzlich anderes als bloß eine, zusätzliche Eigenschaft bzw. ein Sachgehalt (realitas) unter anderen; sie sei vielmehr das, was alle Sachgehalte überhaupt erst ins Sein bringe.
Im Syntagma philosophicum (1658) folgte er der Dreiteilung der Philosophie Epikurs. In der Logik wies er Descartes’ Ansicht von den naturgegebenen Begriffen zurück und hob Sinneseindrücke (und dementsprechend die Induktion) als primäre Quelle menschlicher Erkenntnis hervor. Gassendi war allerdings kein reiner Sensualist, denn er akzeptierte bei komplexen Vorstellungen sehr wohl das Prinzip der Abstraktion, und in der Mathematik erkannte er auch die Deduktion als sinnvoll einzusetzende Methode an. In der Physik vertrat er eine mechanistische Deutung der Natur und der Empfindungen; gleichwohl lässt die Welt sich für Gassendi nicht ohne göttlichen Ursprung erklären. Den Beweis für die Existenz Gottes sah er in der Harmonie der Natur. Sein Beweis für eine rational denkende und – im Gegensatz zu Aristoteles – unsterbliche Seele stützte sich auf die (für ihn offenkundige) Kraft reflexiven Denkens und das Wissen des Menschen um ethische Grundsätze. Im dritten Teil seiner Philosophie – der Ethik – stellte er den Seelenfrieden und die Schmerzfreiheit als Ziel menschlichen Strebens dar; diese seien jedoch in der Praxis kaum erreichbar. Hier zeigte er sich besonders deutlich als Anhänger Epikurs.
Ludwig Feuerbach erkannte, dass Gassendi mehr war als nur Kritiker von Aristoteles und Descartes. Sein Versuch, gemäßigten Skeptizismus, antiken Atomismus, christlichen Glauben und die mechanistische Physik seiner Zeit zu vereinigen, war eine herausragende Einzelleistung. Ähnlich wie Thomas von Aquin – soweit ihm dies möglich schien – aristotelische Lehren mit christlichen Glaubensgrundsätzen kombiniert hatte, unternahm Gassendi dieses mit der Lehre Epikurs. In diesem Sinne war er weniger Vorläufer der kommenden Aufklärung, sondern den Denkern der Renaissance näher. Wie diese begann er jede philosophische Argumentation mit ausführlichen Zitaten antiker und zeitgenössischer Autoren; sie bildeten für ihn den Rahmen „moderner“ Erkenntnistheorie. So war ihm kein Wahrheitskriterium hinreichend, wenn es nicht den Argumenten genügte, die bereits die antiken Skeptiker vorgetragen hatten.
Experimentell-naturwissenschaftliche Leistungen
In seinen naturwissenschaftlichen Schriften verteidigte Gassendi die heliozentrische Theorie, die Realität des leeren Raumes und lehnte die aristotelischen „Formen“ und Zwecke als Wirkungskräfte der Natur ab. Er lieferte eine gültige Formulierung des Trägheitsprinzips und eine frühe Interpretation der Luftdruckexperimente Pascals. Für seine Theorie des Sehens unterstellte er atomistische „Effluxionen“, die Bilder vom Objekt zum Betrachter transportieren. Zur Unterstützung seiner atomistischen Theorie unternahm er eine Reihe von chemischen Experimenten, die die Lösung bzw. Kristallisation von Salzen zum Gegenstand hatten.
Mittels einer Untersuchung der Kirchturmspitze von Aix nach einem Gewitter beschrieb Gassendi als erster, dass Eisen durch Blitzschlag magnetisiert werden kann.
Gassendis Formulierung des Trägheitsprinzips (erstmals in seiner heute gültigen Form) geht auf von ihm durchgeführte Experimente zurück. Mit mehr als 100 Beteiligten führte er auf einer Galeere vor Marseille ein zwar von Galilei ersonnenes, aber nicht durchgeführtes Fallexperiment durch. Entgegen aristotelischen Annahmen schlägt ein auf einem fahrenden Schiff vom Mast fallengelassener Stein nicht Richtung Heck verschoben, sondern unmittelbar am Mastfuß auf. Damit war die Impetustheorie widerlegt. Die Nutzung von Großgaleeren erfolgte, weil diese gleichzeitig über Masten verfügten und hohe Geschwindigkeiten erreichen konnten, ohne in bedeutsamem Maße Seegang und Krängung ausgesetzt zu sein. Durch das von Gassendi erfundene Fallrad (Durchmesser 4 m) kann die Impetus-Theorie, mit erheblich geringerem Aufwand, an allen Orten nachvollziehbar widerlegt werden. Mit seiner Annahme „In der Welt bleibt stets die gleiche Kraft“ formulierte er ebenfalls erstmals den Energieerhaltungssatz.
Gassendi unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz mit Marin Mersenne, Giovanni Domenico Cassini, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Johannes Hevelius, Christoph Scheiner, Descartes, Christina von Schweden, Thomas Hobbes und anderen.
Wissenschaftsgeschichte und Biografien
Gassendi veröffentlichte die erste vollständige Biographie über einen Wissenschaftler überhaupt, die erste und einzige Biographie über Tycho Brahe, die durch direkten Kontakt mit damals noch lebenden Zeitzeugen zustande kam…. Weitere Biografien von Gassendi galten Epikur, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Georg von Peuerbach, Regiomontanus und Nikolaus Kopernikus. Er gab auch einen Überblick über die Anhänger und Gegner der Lehre von Copernicus bis ca. 1615 (siehe De revolutionibus orbium coelestium).
Ehrung
Die IAU ehrte ihn mit der Benennung des Asteroiden (7179) Gassendi und eines – geologisch stark strukturierten – Mondkraters am Nordrand des Mare Humorum.
Die Kontroverse zwischen Gassendi und Descartes
Descartes gilt als Neubegründer der Philosophie, sein Kritiker Gassendi als Erneuerer des Materialismus, d.h. einer „ausgebildeten materialistischen Weltanschauung“, wie es Friedrich Albert Lange in seiner ‚Geschichte des Materialismus‘ (1866) ausdrückt. Gassendi verdankt diesen Ruf hauptsächlich seiner Wiederbelebung der Philosophie Epikurs, aber auch der Atomistik (Atomlehre). Es gelang ihm sogar, den Epikureismus mit dem Christentum in Einklang zu bringen und somit eine Alternative zu dem bis dahin vorherrschenden Aristotelismus und zur Scholastik anzubieten. Schon dies war eine Großtat, zumal Epikur im christlichen Abendland jahrhundertelang verkannt und verpönt gewe-sen war.
Den Aristotelismus und die Scholastik kritisiert Gassendi in Grund und Boden, weil er deren Schematismus und Begriffsspielereien für unwissenschaftlich hält. Denn Gassendi selbst ist als Physiker und Philosoph überzeugt, dass jegliche Erkenntnis sich auf die Erfahrung zu stützen habe. Er ist also Empiriker (Empirist).
Gründe für diese Auffassung findet er zunächst und vor allem in der Materie selbst. In der „Ersten Materie“ sieht er das „beharrliche Substrat“ aller Dinge. Diese Materie sei unerzeugt und unzerstörbar. Aus ihr gehen sämtliche Formen des Seins hervor. Sie besteht aus Atomen, die substanziell identisch, den Figuren bzw. Formen nach jedoch veränderlich sind. Die Dinge entstehen und vergehen gemäß der Art und Weise, in der Atome sich miteinander verbinden oder voneinander trennen. Die Kenntnis dieser Vorgänge bedingt jegliche weitere Erfahrung. – Im Übrigen orientiert Gassendi seine Atomlehre weitgehend an den entsprechenden Lehren Epikurs.
Mit Descartes‘ Metaphysik ist Gassendis Empirismus, sein Pochen auf Erfah-rung, nicht vereinbar. Dadurch erscheint schon das Cogito als fragwürdig. Um sich der eigenen Existenz zu vergewissern, könne man statt vom Denken auch von einer x-beliebigen anderen Handlung ausgehen. Im Übrigen sei es nicht sinnvoll zu fragen, ob man ist, sondern was man ist. Diese Frage habe Descartes nicht korrekt beantwortet. Abwegig sei es, einem denkenden Wesen körperliche Qualitäten wie Ausdehnung oder Beweglichkeit abzusprechen.[10 ]
Darüber hinaus kritisiert Gassendi Widersprüche, die durch das ungeklärte Nebeneinander von dualistischer Substanzlehre und monistischer funktionaler Einheit von Leib und Seele entstehen. Den Begriff ‚Substanz‘ hält er für verfänglich. Wer das Wesen eines Dings erkennen will, muss dessen Merkmale und Eigenschaften (z.B. Gestalt, Ausdehnung, Farbe usw.) untersuchen und stößt daher nicht auf die „Substanz“, sondern immer wieder nur auf „Akzidentien“ (die ja traditionell strikt von der Substanz unterschieden werden). Gott als Substanz zu erkennen, würde voraussetzen, dass man das Unendliche begriffen hätte, was ausgeschlossen sei (Gassendi a.a.O. S. 471). Wer außerdem Gott als Garanten der Wahrheit bemühe, dürfe nicht zuvor das Cogito und die Wahrheiten der Geometrie als „unerschütterliche Grundlagen“ der Wahrheit einführen (S. 473).
Wer das Denken von der Ausdehnung trennt, verlässt den Boden der Tatsachen, die nur durch das Zusammenspiel von Denken und Anschauung annähe-rungsweise zu erklären sind. Um hierbei nicht abzuirren, genüge es nicht, „klare und deutliche“ Ideen zu haben; vielmehr brauche man Kriterien dafür, das Rich-tige vom Falschen zu unterscheiden. Dass es „angeborene Ideen“ gäbe, sei ohne-hin nicht nachzuweisen (a.a.O. S. 471).
Descartes sei es nicht gelungen, die leib-seelische Grundbefindlichkeit des Menschen angemessen zu würdigen. Mit einer (überdies unhaltbaren) Substanz-lehre sei dies nicht möglich, zumal Descartes nicht nachweisen könne, dass das Denken die eigentliche Substanz des Menschen sei, so dass er nur aus Geist und nicht auch aus Körperlichem bestehe. Klar sei doch, dass kein Mensch ohne seinen Körper existiere oder existieren könne. Ein „unkörperlicher“ Mensch könne keinen Schmerz empfinden – eine Anspielung auf das Argument, das Descartes in der 6. „Meditation“ eher unvermittelt zu Gunsten der leib-seelischen Einheit des Menschen vorbringt. Für Descartes ist dies eine Einheit von Körperlichem und Nicht-Körperlichem (rein Geistigem). Das hält Gassendi für unlogisch, indem er feststellt:
„Wie soll, was körperlich ist, das, was unkörperlich, erfassen, um es in Verbindung mit sich zu halten, oder wie soll das Unkörperliche das Körperliche erfassen, um es wechselseitig an sich gefesselt zu halten, wenn ganz und gar nichts in ihm ist, wodurch es erfaßt werden oder erfassen kann?“[11 ]
Wenn Körper und Geist durch die Substanzlehre getrennt worden sind, können sie nicht durch ein paar Beteuerungen der funktionalen Einheit wieder zusam-mengebracht werden. Descartes erkenne nicht einmal, dass auch der Verstand in gewisser Weise über Ausdehnung verfüge.
Descartes‘ Antworten auf Gassendis Kritik
Erstaunlich ausführlich nimmt Descartes zu den Einwänden seines Kollegen (und Freundes?) Stellung. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 1. Descartes legt größten Wert darauf, zwischen Lebenspraxis und Wahrheits-suche („les actions de la vie et la recherche de la vérité“, Descartes a.a.O. S. 477) zu unterscheiden. Lebenspraktische Handlungen seien nicht ohne Zuhilfenahme der sinnlichen Wahrnehmung zu beurteilen; genau dies reiche aber nicht aus, sobald es um philosophische Wesensbestimmungen gehe. Daher lässt er Gassendis Einwände gegen die Ableitung des Cogito nicht gelten. Das „Ich denke, also …“ könne nicht einfach durch irgendetwas anderes, z.B. „Ich gehe spazieren, also …“ ersetzt werden. Denn auch Letzteres werde zum Gegenstand „innerer Kenntnis“, mithin also des Denkens. Und nur das Denken über die Handlung, nicht die Handlung selbst, könne Gewissheit schaffen. 2. Gassendis Grundfehler bestehe darin, den substanziellen Unterschied zwischen Körper und Geist nicht anzuerkennen (a.a.O. S. 498). 3. Was aber eine Substanz überhaupt sei, könne man sehr wohl erkennen, und zwar nicht zuletzt an Hand des methodischen Zweifels. Man dürfe nur nicht Substanz und Akzidenz verwechseln. Die Substanz sei stets das zu Grunde Liegende, die Akzidentien das aus ihr Ableitbare, Untergeordnete (S. 488). 4. Gott als unendliche Substanz zu erkennen, sei keineswegs unmöglich. Das Unendliche sei nicht die Negation des Endlichen; vielmehr zeige sich umgekehrt in jedem Vorgang des Begrenzens eine Negation des Unendlichen (S. 489). Daher reiche es zur Bestimmung des Unendlichen aus, sich ein Ding ohne jegliche Begrenzung vorzustellen (S. 491). 5. Zu den Grundkriterien der Klarheit und Deutlichkeit. Diese Ideen könne Gassendi nicht anerkennen, weil er keinen Begriff von dem habe, was eine Idee wirklich sei. Für Gassendi seien Ideen lediglich Phantasie-Bilder („images dépeintes en la fantaisie“) und nicht Bezugsbestimmungen des begrifflichen Denkens (S. 490). Klarheit und Deutlichkeit seien durchaus erreichbar, aber nur dann, wenn man a) sämtliche Vorurteile vermeidet, b) zuvor alle jeweils wesentlichen Ideen prüft und c) alles Obskure und Konfuse ausschaltet (S. 486). 6. Klar und deutlich sei zu erkennen, dass der menschliche Geist eine Substanz für sich und nichts Körperliches sei. Nichtsdestoweniger stehe der Körper durchaus in funktionaler Beziehung zum Geist (S. 481). In diesem Sinne seien die entsprechenden Äußerungen der Sechsten Meditation zu verstehen. Man könne faktisch mit dem Körper verbunden sein und dennoch feststellen, dass Geistig-Seelisches vom Körper substanziell verschieden sei. Um Körperliches zu analysieren und zu beurteilen, sei es nicht erforderlich, dass der Geist selbst aus Körperlichem bestehe. Wenn der Geist Teile des Körpers als räumliche erkennt, bedeutet dies nicht, dass der Geist selbst aus materiellen, räumlichen Teilen besteht (S. 508).
Aus all dem schließt Descartes, dass Gassendis Kritik unbegründet sei. Diesem Kritiker sei es keineswegs gelungen, stichhaltige Gegenargumente vorzubringen oder gar die cartesischen Folgerungen zu entkräften (S. 509). Wobei zu beachten ist, dass er auf eine wesentliche These seines Kritikers, nämlich diejenige hinsichtlich der angeblich „angeborenen“ Ideen (s.o.) gar nicht eingegangen ist.12
Resümee / Folgerungen
Wer hat nun Recht, Descartes oder Gassendi? Die Unterschiede zwischen den beiden Kontrahenten scheinen zunächst unüberwindlich zu sein. An diesem Befund vermag anscheinend auch die Berufung auf Autoritäten der umfangreichen Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der beiden Autoren nichts zu ändern. Kant und Hegel haben wahrscheinlich Descartes zugestimmt, Marx und Engels wohl eher Gassendi.
Weiter hilft aber vielleicht die folgende Überlegung: Möglicherweise gibt es zwischen den beiden Kontrahenten mehr Gemeinsamkeit, als sie sich gegenseitig zuzubilligen bereit waren. Descartes war vermutlich ebenso wenig „Dualist“ wie Gassendi. Denn das zentral wichtige Cogito dient ja nicht dazu, das Sein auf das Denken zurückzuführen. Im Gegenteil: Man muss sein, um denken zu können, erklärt Descartes ausdrücklich (s.o.). Erst das Faktum meiner Existenz ermöglicht mir das Denken, in dem der Zweifelstaumel beendet wird. Ich kann denken, weil ich bin, und weil ich denke, kann ich mein Sein nicht mehr bezweifeln. Und hierauf beruht auch Descartes‘ Überzeugung von der leib-seelischen Einheit des Menschen, wie u.a. aus er Sechsten Meditation klar hervorgeht.
Dies bestreitet auch Gassendi anscheinend nirgendwo. Seine Gemeinsamkeit mit Descartes‘ Auffassung der leib-seelischen Einheit umfasst nicht nur den empirischen Befund der sinnlich erfahrbaren Körperlichkeit des Menschen, sondern auch die besondere Rolle des menschlichen Geistes:
„Gassendi war allerdings kein reiner Sensualist, denn er akzeptierte bei komplexen Vorstellungen sehr wohl das Prinzip der Abstraktion, und in der Mathematik erkannte er auch die Deduktion als sinnvoll einzusetzende Methode an.“ (s.o. S. 12)
Wie Descartes weiß Gassendi, dass der menschliche Geist – und nicht nur sein dialektischer Bezug zu Leib und Seele – besonderer Aufmerksamkeit und analytischer Akribie bedarf. Es sind frappierende Gemeinsamkeiten, vor deren Hintergrund die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Kontrahenten in anderem, neuem Licht erscheinen. Diese Gemeinsamkeiten sind zweifellos bedeutsamer als die zuweilen pedantisch wirkenden Streitereien über die Substanzenlehre oder die „Gottesbeweise“. – Außerdem enthält das Cogito eine unüberhörbare Aufforderung, die Gassendi sicherlich mitgetragen hat, und zwar die Aufforderung zum Selber-Denken, die ja auch Kant bekräftigt hat.
Literaturhinweise
Alquié, Ferdinand 1950: La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris
Changeux, Jean-Pierre 1984: Der neuronale Mensch, Reinbek
Descartes, René 1953 (1644): Oeuvres et lettres (ed. par André Bridoux), Paris
Gassendi: http://www.philos-website.de/autoren/gassendi_g/htm
Perler, Dominik 1998: René Descartes, München
Robra, Klaus 1988: Est-ce la faute à Descartes? – Les dualités et la chose, in: Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. XV, 1988
Robra, Klaus 2015: Wege zum Sinn, Hamburg
Robra, Klaus 2023: Personalismus und dialektischer Materialismus. Wie kann die Person Geist und Materie in sich vereinen? München
Störig, Hans-Joachim 1961: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart ,, ,
Wikipedia: Pierre Gassendi. https://de.wikipedia/org/wiki/Pierre_Gassendi
[...]
1 Vgl. Robra 2023, darin auch Näheres und Weiteres zum Verhältnis von Person, Geist und Materie.
2 Erich Auerbach: Das französische Publikum des 17.Jahrhunderts, in: Münchner Romanistische Arbeiten, 3. Heft, 1933, S. 48
3 Descartes 1953, S. 148
4 Vgl. Klaus Robra: Est-ce la faute à Descartes? – Les dualités et la chose, in: Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. XV, 1988, S. 73 ff.
5 Vgl. Dominik Perler: René Descartes, München 1998, S. 213 bzw. K. Robra 1988, S. 76
6 Descartes: Les Principes de la Philosophie, in: Oeuvres et lettres (ed. par André Bridoux), Paris 1953, S. 601
7 Vgl. Robra 2015, S. 188-190
8 Vgl. Ferdinand Alquié: La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris 1950, S. 346
9 Vgl. ders. a.a.O. S. 299
10 Vgl. Gassendi, in: Descartes 1953, S. 470.
11 Pierre Gassendi. http://www.philos-website.de/autoren/gassendi_g.htm, S. 17
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in „Geist und Materie, Ideal und Wirklichkeit: Descartes und Gassendi“ von Klaus Robra?
Der Text analysiert die philosophische Kontroverse zwischen René Descartes und Pierre Gassendi über das Verhältnis von Geist und Materie, Ideal und Wirklichkeit im Kontext der beginnenden neuzeitlichen Philosophie. Es werden die unterschiedlichen Ansätze der beiden Denker beleuchtet und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Materialismus und Idealismus diskutiert.
Welche Rolle spielt der Mensch (die Person) in der dialektisch-materialistischen Sichtweise?
Der Mensch, verstanden als Person im Sinne von Emmanuel Mounier, dient als Vergleichsparameter (tertium comparationis) für Geist und Materie. Die Person wird als Körper-Seele-Geist-Wesen betrachtet, wobei die materielle Welt als Grundlage der menschlichen Existenz angesehen wird. Der dialektische Materialismus betont, dass der menschliche Geist aus den Telos-Strukturen der Materie entstanden ist.
Was bedeutet Descartes‘ Aussage „Freiheit nicht in Gott, sondern Gott entgegen“?
Diese Aussage, interpretiert von Erich Auerbach, bedeutet, dass Descartes‘ System zwar Gottesbeweise enthält, aber die Freiheit und Subjektivität des Menschen nicht direkt aus Gott ableitet. Stattdessen gewinnt Descartes diese Werte aus eigenen Überlegungen, wobei er die persönliche Natur seiner Reflexionen betont.
Was ist das „Cogito ergo sum“ und welche Bedeutung hat es im Werk von Descartes?
Das „Cogito ergo sum“ (‚Ich denke, also bin ich‘) ist Descartes‘ grundlegende Erkenntnis, die er durch radikalen Zweifel gewinnt. Es ist der unbezweifelbare Ausgangspunkt für seine Philosophie und ein „unerschütterliches Fundament“ des Denkens. Descartes vergewissert sich seiner eigenen Existenz im Akt des Denkens.
Was versteht Descartes unter „res cogitans“ und „chose étendue“?
„Res cogitans“ (‚denkende Sache‘) bezeichnet Descartes‘ Auffassung vom Menschen als einem denkenden Wesen. „Chose étendue“ (‚ausgedehnte Sache‘ oder ‚res extensa‘) bezieht sich auf die Materie, die im Raum ausgedehnt ist. Descartes sieht Gott als erste Substanz und hält Geist und Materie für getrennte Substanzen, was zu Problemen der Wechselwirkung führt.
Wie definiert Descartes Freiheit und Willensfreiheit?
Descartes billigt dem Menschen Willens- und Entscheidungsfreiheit zu, die er als ‚libre arbitre ‘ (freier Schiedsrichter) und ‚liberté de ma volonté‘ (Freiheit meines Willens) bezeichnet. Er betrachtet die Willensfreiheit als ein von Gott gestiftetes „Wunder“ und betont, dass sie Wahlfreiheit (Zustimmung oder Ablehnung) ermöglicht. Willensfreiheit bedeutet für ihn Handlungsfreiheit, da wir zwischen Richtig und Falsch unterscheiden können.
Wie erklärt Descartes die Möglichkeit von Irrtümern trotz menschlicher Unterscheidungsfähigkeit?
Descartes argumentiert, dass Irrtümer nicht von Gott verursacht werden, sondern aus der Zwischenstellung des Menschen zwischen Sein und Nichts entstehen. Er betont die Bedeutung klarer und deutlicher Erkenntnisse und die Rolle des Willens bei der Urteilsbildung.
Welche Kritik übt Gassendi an Descartes‘ Philosophie?
Gassendi kritisiert Descartes‘ Dualismus von Geist und Materie und vertritt eine materialistische Weltanschauung, die auf der Atomlehre Epikurs basiert. Er lehnt Descartes‘ Vorstellung von angeborenen Ideen ab und betont die Bedeutung der Erfahrung für Erkenntnis. Gassendi bemängelt Widersprüche in Descartes‘ Substanzlehre und kritisiert die Trennung von Denken und Ausdehnung.
Wie antwortet Descartes auf Gassendis Kritik?
Descartes verteidigt seine Unterscheidung zwischen Lebenspraxis und Wahrheitssuche und betont den substanziellen Unterschied zwischen Körper und Geist. Er erklärt, wie man eine Substanz erkennen kann, und verteidigt seine Kriterien der Klarheit und Deutlichkeit für Erkenntnis. Descartes hält Gassendis Kritik für unbegründet und betont, dass Gassendi das Wesen von Ideen nicht verstanden habe.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen Descartes und Gassendi?
Obwohl sie unterschiedliche philosophische Ansätze verfolgten, gab es Gemeinsamkeiten zwischen Descartes und Gassendi. Beide waren sich der Bedeutung des menschlichen Geistes bewusst, und beide anerkannten die leib-seelische Einheit des Menschen. Ein wichtiger Unterschied lag jedoch in ihrer Betonung von Erfahrung (Gassendi) bzw. Vernunft (Descartes) als Grundlage der Erkenntnis.
- Citar trabajo
- Dr. Klaus Robra (Autor), Geist und Materie, Ideal und Wirklichkeit bei Descartes und Gassendi, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1358192