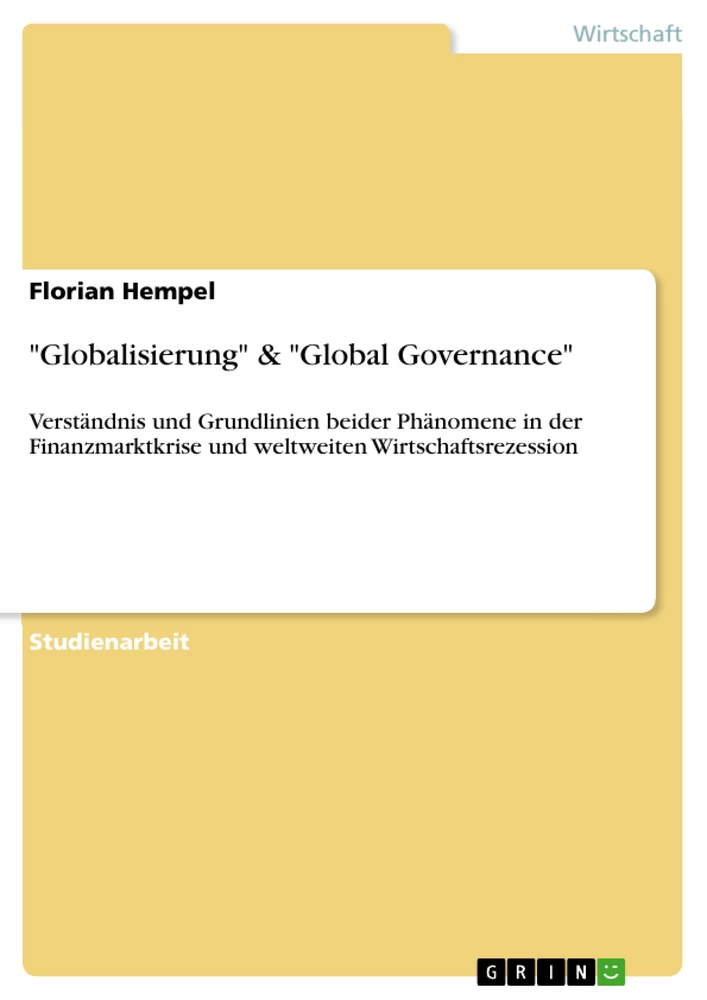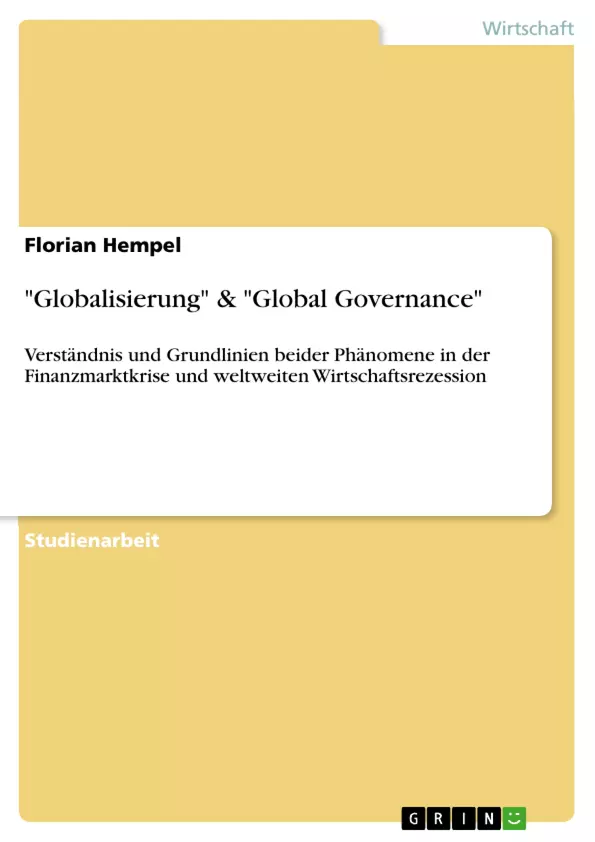„Heutzutage ist es fast unmöglich, eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein Magazin aufzuschlagen, ohne von einem Artikel traktiert zu werden, der auf die eine oder andere Art von der Globalisierung der Wirtschaft handelt: dem Kampf ums große Geld auf den internationalisierten und liberalisierten Kapitalmärkten; der wachsenden internationalen Arbeitsteilung in multinationalen Unternehmen; der zunehmenden weltweiten Konkurrenz um Märkte und Nischen; den Strategien, Akquisitionen und ständigen Umstrukturierungen der global players.“ (Went, Ein Gespenst geht um… Globalisierung!, S.9)
Dies gilt umso mehr, seit die zwischenzeitlich im Tagesrhythmus verlautenden Pressemeldungen über die internationale Finanzmarktkrise und ihre eingetretenen oder noch möglichen Folgen auch für ein wachsendes Interesse aller Bevölkerungsschichten an diesem Thema gesorgt haben, sei es auch nur insoweit, dass nunmehr das Schlagwort „Weltwirtschaftskrise“ in aller Munde ist.
Die Wenigsten wissen jedoch auch tatsächlich, was es damit auf sich hat, weil es bislang an einer strukturierten Darstellung der Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen in der Presse fehlt.
Diese Arbeit befasst deshalb mit der Fragestellung, was überhaupt unter den zentralen Begriffen der "Globalisierung" sowie des sogenannten "Global Governance" zu verstehen ist, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und in welchem Kontext die Finanzmarktkrise hierbei zu sehen ist.
Gliederung
A) Einleitung
B) Zur grundlegenden Problematik der Globalisierung
I) Begriff und Bedeutungen
1.) Globalisierung aus politisch-ökonomischer Sicht
a) Allgemeines
b) Indikatoren der wirtschaftlichen Globalisierung
aa) Makroökonomische Indikatoren
aaa) Das Bruttosozialprodukt
bbb) Der Anteil der weltweiten Exporte am Weltbruttoinlandsprodukt
bb) Die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen
cc) Finanzmärkte und spekulative Geldströme
aaa) Internationale Umschuldungsprogramme
bbb) Veränderung der Richtung der Geldströme
ccc) Der Derivatehandel
ddd) Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften
eee) Zwischenergebnis
c) Fazit
2.) Die technologische Globalisierung
a) Die Verbreiterung der Kommunikationsmöglichkeiten
b) Weitere „Massentechnologien“
c) Einschränkungen
d) Zusammenfassung
2.) Die sozialwissenschaftliche Bedeutung der Globalisierung
a) Auswirkungen auf die Sozialstruktur der Bevölkerung
b) Die internationale Migration
c) Fazit
3.) Zusammenfassung - Die Dimensionen der Globalisierung
II) Globalisierung als Prozess
1.) Die theoretischen Ansätze zur historischen Entwicklung der Globalisierung
a) Globalisierung zeitgleich mit der Verwendung des Begriffes?
b) Globalisierung bereits ab Mitte der 80er Jahre?
c) Globalisierung ab Mitte der 70er Jahre?
d) 1945 als maßgeblicher Zeitpunkt?
e) Das Ende des 19.Jahrhunderts
f) Die Industrielle Revolution
g) Die europäische Welteroberung am Ende des 15. Jahrhunderts
h) Globalisierung bereits seit dem 13. Jahrhundert?
i) Tatsächlich: zu allen Zeiten Weltwirtschaft
aa) Fundstellen in der Bibel
bb) Das Europa des 9. Jahrhunderts
cc) Europa im 11. und 12. Jahrhundert
j) Fazit
2.) Ursachen der „neuen“ Globalisierungswelle
a) Multinationale Unternehmen
b) Die Liberalisierung des Handels und der Finanzmärkte
aa) Außenhandelsliberalisierung
bb) Liberalisierung der Finanzmärkte
cc) Zwischenergebnis
c) Die Transformation der Ostblockstaaten
d) Die Marktöffnung der Entwicklungsländer
e) Internationale Handelsblöcke
f) Fazit
4.) Zwischenergebnis
III) Globalisierungskritische Bewegungen
1.) Kritik an der „neoliberalen“ Ausprägung der Globalisierung und ihren Folgen
2.) Grundsätzliche Gegner der Globalisierung als solche
3.) Fazit
C) Globalisierung als Herausforderung für die Politik
I) Problemfelder
1.) Problemfeld Wirtschaft
a) „Standortwettbewerb“ und „Sozialdumping“
b) „Unkontrollierbare Multis“
c) Krise der öffentlichen Haushalte und Absenken von Standards
d) Zwischenergebnis
2.) Problemfeld Umwelt
3.) Problemfeld Sicherheitspolitik
4.) Zwischenergebnis
II) Lösungsmöglichkeiten
1.) Eindämmung der bzw. nationale Abschottung von der Globalisierung
2.) Regionalisierung versus Globalisierung
a) Begriffsbestimmung
b) Triadisierung als Beispiel des Zusammenwirkens von Globalisierung und Regionalisierung
c) Fazit
3.) Installation globalpolitischer Strukturen und Regelwerke
a) Unilateralismus contra Multilateralismus
aa) Die USA als Beispiel unilateraler Politik
bb) Beispiele für Multilateralität
cc) Argumente für Multilateralität
b) Das Global-Governance-Konzept - Multilateralismus zwischen partikularen Interessen und universellen Anforderungen
aa) Begriffsbestimmung
aaa) Verständnis
bbb) Definition von Global Governance
ccc) Abgrenzung zu anderen Begriffen
ddd) Fazit
bb) Geschichte
aaa) Begriffsgeschichte
bbb) Historische Vorläufer
ccc) Fazit
cc) Die Notwendigkeit von Global Governance und seine praktische Umsetzung
dd) Kritik am Global Governance
aaa) Falsches Verständnis von der Zivilgesellschaft
bbb) Technokratisches, effizienzorientiertes Politikverständnis
ccc) Global Governance als Restrukturierung des globalen Kapitalismus
ddd) Keine hinreichende politische Reaktion aus asymmetrische Machtstrukturen
eee) So gut wie keine Auseinandersetzung mit der demokratischen Legitimation
fff) „Kritik der Kritik“
ee) Zum Problem der demokratischen Legitimierbarkeit von Global Governance
aaa) Das Modell der kosmopolitischen Demokratie
bbb) Die pluralistischen Mehrebenenansätze
ccc) Die deliberative Demokratietheorie
ddd) Fazit
ff) Fazit: Global Governance als realistische Perspektive?
4.) Ergebnis
C) Globalisierung und Global Governance im Kontext der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise
I) Ursachen
II) Schlussfolgerungen aus der Krise
1.) Regulierung durch die jeweiligen Nationalstaaten?
2.) Regulierung durch den Markt?
3.) Global Governance als koordinierte Marktkorrektur?
4.) Rein politisches Global Governance
III) Fazit
D) Resümee & Ausblick
Literaturverzeichnis
Online-Quellen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A) Einleitung
„Heutzutage ist es fast unmgl., eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein Magazin aufzuschlagen, ohne von einem Artikel traktiert zu werden, der auf die eine oder andere Art von der Globalisierung der Wirtschaft handelt: dem Kampf ums große Geld auf den internationalisierten und liberalisierten Kapitalmärkten; der wachsenden internat. Arbeitsteilung in multinat. Unternehmen; der zunehmenden weltweiten Konkurrenz um Märkte und Nischen; den Strategien, Akquisitionen und ständigen Umstrukturierungen der global players.“[1] Dies gilt umso mehr, seit die zwischenzeitlich im Tagesrhythmus verlautenden Pressemeldungen über die internat. Finanzmarktkrise und ihre eingetretenen oder noch mgl. Folgen auch für ein wachsendes Interesse aller Bevölkerungsschichten an diesem Thema gesorgt haben, sei es auch nur insoweit, dass nunmehr das Schlagwort „Weltwirtschaftskrise“ in aller Munde ist. Die Wenigsten wissen jedoch auch tatsächlich, was es damit auf sich hat, weil es bislang an einer strukturierten Darstellung der Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen in der Presse fehlt.
Die nachstehende Arbeit soll sich deshalb mit der Fragestellung befassen, was überhaupt unter dem Begriff der Globalisierung zu verstehen ist und in welchem Kontext die Finanzmarktkrise hierbei zu sehen ist.
B) Zur grundlegenden Problematik der Globalisierung
„Das Wort "Globalisierung" begegnet uns nun beinahe täglich als Argument, als Argument allerdings für alles Mögliche: Für radikale Bildungsreformen, für Englisch lernen schon im Kindergarten, aber auch für den Abbau von Arbeitsplätzen, für die Lockerung von ethischen Standards, z.B. in der Gentechnik, für die Verlagerung von Firmensitzen, für den Zusammenschluss von Unternehmen - und schließlich als Grund dafür, dass es das ganze Jahr über Erdbeeren gibt.“[2] Der Frage, was denn genau darunter zu verstehen ist, soll in diesem Abschnitt nachgegangen werden.
I) Begriff und Bedeutungen
Allgemein lässt sich darunter der Prozess der zunehmenden weltweiten Verflechtung in allen Bereichen verstehen.[3] Eine genauere Beschreibung über diese pauschale Definition hinaus ist nur mgl., wenn man die Bedeutung mit einfließen lässt, welche die einzelnen wissenschaftl. Disziplinen dem Begriff beimessen. Dabei muss jedoch bereits im Vorfeld festgehalten werden, dass die Beurteilung stets einhergeht mit der Analyse der Folgen, welche durch die Globalisierung ausgelöst werden.
1.) Globalisierung aus politisch-ökonomischer Sicht
Eine erste Mglkt. besteht in der Betrachtung des Globalisierungsbegriffs in einem politisch-ökonomischen Kontext.
a) Allgemeines
Danach ist unter Globalisierung der fortschreitende Prozess weltweiter Vernetzung der nat. Produkt-, Faktor- und Finanzmärkte, d.h., ihre fortschreitende Integration in die Weltwirtschaft, zu verstehen.[4] Denn, „da die polit. gesetzten Handelsschranken zwischen den Staaten zunehmend abgebaut werden und der Produktionsfaktor Kapital weltweit mobil und einsetzbar ist und ferner die neuen Kommunikationstechnologien grenzenlos angewendet werden können, wird zunehmend in solchen Staaten produziert, die die höchsten Kostenvorteile bieten. Kennzeichnend für die Globalisierung ist deshalb, dass diese Kostenvorteile nicht nur für jedes Endprodukt gesucht werden, sondern für nahezu jedes Einzelteil, aus dem das Endprodukt besteht. Der Prozess der Globalisierung erhöht damit entscheidend den Wettbewerbsdruck zwischen den einzelnen Unternehmen und hat darüber hinaus erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität und Sicherheit der Arbeitsplätze.“[5] Das Hauptmerkmal der Globalisierung liegt hier also in der Ökonomie. Eine sog. globale Ökonomie zeichnet sich dabei v.a. dadurch aus, dass sie „durch dichte ökonomische Interpendenzen zwischen den (entwickelten) Volkswirtschaften auf den Feldern des Handels und der Investition, durch kooperative wirtschaftl. Beziehungen zwischen in- und ausländischen Akteuren und durch ein geringes Maß an künstlichen, sprich polit. bewerkstelligten Beschränkungen für grenzüberschreitende Transaktionen, gekennzeichnet ist.“[6]
b) Indikatoren der wirtschaftlichen Globalisierung
Das Maß der wirtschaftl. Globalisierung lässt sich durch grundlegende statistische Daten, sog. Indikatoren, erfassen. Solche Messgrößen können jedoch nur mit äußerster Vorsicht gedeutet werden. Denn zum einen kann man nicht genau differenzieren, welche von ihnen tatsächlich zur Erfassung der Globalisierung geeignet sind, andererseits ist aber auch nicht genau bestimmbar, welche Ausprägung einzelne Indikatoren zur Bestimmung des Fortgangs der Globalisierung aufweisen müssten. Indikatoren können daher lediglich die Grundlage für die Erhebung detaillierter Daten darstellen. Im Folgenden sollen aufgrund der schier unüberschaubaren Fülle von Datenerhebungen und Statistiken exemplarisch nur die wesentlichen Messgrößen, die für die Bestimmung des Maßes der Globalisierung allgemein herangezogen werden, kurz vorgestellt werden.
aa) Makroökonomische Indikatoren
Will man die Indikatoren in Gruppen katalogisieren, so sind zunächst sog. makroökonomische, also gesamtwirtschaftl. Variablen zu nennen. Dabei handelt es sich um Daten, die einzelne Sachverhalte
oberhalb der Akteursebene zusammenfassen.[7]
aaa) Das Bruttosozialprodukt
Die wichtigste und gleichzeitig bekannteste Größe in diesem Zusammenhang stellt zweifelsohne das Bruttosozialprodukt dar. Dieses entspricht dem Wert aller im Laufe eines Jahres produzierten Waren und Dienstleistungen, zuzüglich der aus dem Ausland empfangenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen und abzüglich der von Ausländern im Inland erzielten Einkommen.[8] Die Bewertung erfolgt in Marktpreisen, wobei die Weltbank die Länderangaben zu Vergleichszwecken zum im Berichtsjahr gültigen Wechselkurs in US-Dollar umrechnet. Im Rahmen der Auswertung der in diesem Zusammenhang erhobenen Daten wird allgemein, wenngleich ihr Wachstumsanteil tatsächlich sukzessiv abnimmt, davon ausgegangen, dass der Abstand zwischen den reichen Ländern im Vergleich zu den ärmeren im Zuge der Globalisierung immer weiter anwächst.[9]
bbb) Der Anteil der weltweiten Exporte am Weltbruttoinlandsprodukt
Ein weiteres Bemessungskriterium der fortschreitenden Globalisierung ist der Anteil der weltweiten Exporte der verarbeitenden Industrie am Weltbruttoinlandsprodukt, also an dem Wert aller auf der Erde bereitgestellten Güter.[10] Das Weltbruttoinlandsprodukt stellt damit eine Zusammenfassung sämtlicher einzelner Bruttoinlandsprodukte, also der Werte aller Güter und Dienstleistungen, welche in einem Jahr innerhalb der Landesgrenzen der jeweiligen Volkswirtschaften erwirtschaftet wurden,[11] dar. Betrachtet man dabei die historische Entwicklung, so fallen insbes. zwei Phasen auf, nämlich die Periode von 1870 bis 1913, sowie die kapitalistische Entwicklungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Die besonderen Strukturmerkmale und quantitativen Ergebnisse dieser Abschnitte haben Beobachter dazu veranlasst, von sog. „golden-age“-Phasen zu sprechen.[12] So wurden in der Zeit von 1870 bis 1913 die rapide voranschreitenden Prozesse internat. Integration von einer äußerst offenen regulativen Struktur der Weltwirtschaft begünstigt, die es ermöglichte, Kapitalbewegungen nahezu unkontrolliert und nicht-reguliert zu tätigen.[13] Insbes. die weltwirtschaftl. bedeutsame Gruppe der europäischen Kernökonomien, die im Jahre 1913 nahezu die Hälfte der Ex- und Importe, sowie 90 Prozent der ausländischen Investments tätigten, wies dabei ein offenes Handelsregime auf, welches seinen Niederschlag v.a. in niedrigen Zöllen fand.[14] Dementspr. lässt sich auch bis 1913 eine konstante Zunahme des Internationalisierungsgrades der kapitalistischen Weltwirtschaft verzeichnen: Betrug der Anteil der weltweiten Exporte am Weltbruttoinlandsprodukt im Jahre 1850 nur 5,1 Prozent, so stieg er bis 1913 auf 11,9 Prozent
an.[15] Erst die beiden Weltkriege stoppten diesen Prozess, sodass der Anteil 1950 auf 7,1 Prozent gesunken war. Wenngleich seit 1950 wiederum ein stetiger Anstieg zu verzeichnen ist, so muss dieser lange Weltmarktaufschwung wohl eher als ein Aufholprozess charakterisiert werden, denn erst im Jahre 1974 erreichten die westlichen Ökonomien überhaupt wieder die Exportquoten des Jahres 1913.[16] Dennoch ist unübersehbar, dass, spätestens seit den 80er Jahren, eine verstärkte Weltmarktintegration zu verzeichnen ist.
bb) Die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen
Einen weiteren Maßstab für die Globalisierung bilden sog. ausländische Direktinvestitionen. Darunter sind alle Transaktionen zu verstehen, durch die ein Unternehmen im Ausland eine Filiale gründet oder die Kontrolle über mindestens 10 Prozent des Gesellschaftskapitals eines ausländischen Unternehmens erwirbt.[17] Diese haben seit Mitte der 80er Jahre stark zugenommen und lagen im Jahre 2000 bei 20 Prozent des Weltbruttosozialprodukts. Zurückzuführen ist diese Entwicklung v.a. auf Unternehmensfusionen und -akquisitionen, sowie die Rationalisierung innerhalb der entstandenen multinat. Konzerne, welche im Zuge der Spezialisierung der einzelnen Produktionseinheiten eine vertiefte internat. Arbeitsteilung zur Folge hat.[18] Die ausländischen Direktinvestitionen spielen sich größtenteils zwischen den hoch entwickelten Ländern ab; gleichwohl repräsentieren sie mittlerweile auch für die Entwicklungsländer einen wachsenden Anteil der Finanzmittel, die sie aus dem Ausland beziehen.[19]
cc) Finanzmärkte und spekulative Geldströme
Die Dimension der wirtschaftl. Globalisierung lässt sich aber schließlich auch an der Dimension der weltweiten Geldströme veranschaulichen. Das Anwachsen der Finanzströme hat sich seit den 80er Jahren noch beschleunigt, was v.a. darauf zurückzuführen ist, dass die Politik der Regierungen die Öffnung der nat. Märkte, sowie die dort gehandelten Aktiva, also Aktien, Schuldtitel, Devisen, Rohstoffe, usw., begünstigte.[20] Zwischenzeitlich stehen die zirkulierenden Finanzaktiva in keinem Verhältnis mehr zur Warenzirkulation oder zu den industriellen Investitionen: „So lag das tägliche Transaktionsvolumen auf den Devisenmärkten 1998 bei über 1400 Mrd. Dollar, das Hundertfache der Summe, die für die Finanzierung der Transaktionen von Gütern und Dienstleistungen erforderlich war.“[21]
aaa) Internationale Umschuldungsprogramme
Zurückzuführen ist dies zunächst auf die von den internat. Organisationen, insbes. die vom
Internationen Währungsfonds und der Weltbank, durchgesetzten Umschuldungsprogramme, die ihrem Zweck nach stark verschuldete Staaten, sowie Staaten mit einem sehr niedrigen Bruttoinlandsprodukt unterstützen sollen,[22] und die die Geschäftsbanken seit Beginn der 80er Jahre mit den überschuldeten Ländern der Dritten Welt aushandeln. Diese garantieren den Gläubigerbanken der Industrieländer einen kontinuierlichen Schuldendienst, „der zuweilen schon den Kapitalimport der betreffenden Länder überstieg.“[23]
bbb) Veränderung der Richtung der Geldströme
Betrachtet man darüber hinaus die Richtung der Geldströme, so lässt sich feststellen, dass in den 90er Jahren ein Großteil der Auslandsdirektinvestitionen und der Portfolioinvestitionen, also der unternehmerischen Investitionen in Beteiligungswerte,[24] auf einige wenige Schwellenländer konzentriert war. Seit der Asienkrise Ende 1997 flossen die Finanzierungsströme jedoch hauptsächlich in die Industrieländer, was wiederum durch deren enormen Bedarf an Auslandskapital begünstigt wurde. Lag der Anteil des Auslandskapitals in den Industrieländern 1970 noch bei ca. 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, so wuchs er sukzessiv auf über 200 Prozent an.[25] Ähnlich verhält es sich bei den Verbindlichkeiten ggü. dem Ausland: Während diese 1970 noch einen Anteil von ca. 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachte, wurden daraus zwischenzeitlich ca. 250 Prozent.[26]
ccc) Der Derivatehandel
Hohe Wachstumsraten verzeichnet ebenfalls der Derivatehandel, also der Handel mit Finanzprodukten, die sich von klassischen Anlageformen, wie Aktien, Anleihen, Devisen, Krediten, etc., ableiten und so die isolierte Handelbarkeit einzelner Risiken, zum Zwecke der Absicherung bzw. der Spekulation, ermöglichen.[27] Das bekannteste Beispiel für den Derivatehandel ist dabei das Optionsgeschäft. Die Besonderheit derartiger Geschäfte liegt dabei v.a. darin, dass sie es infolge ihrer spezifischen Hebelwirkung erlauben, Finanzaktiva in der Höhe eines Vielfachen des Eigenkapitals zu bewegen. So bedeutet bspw. ein Hebel von 10, dass der Optionsschein um 10 Punkte steigt, wenn die entspr. Aktie um nur einen Punkt zulegt, umgekehrt aber auch, dass der Optionsschein, verliert die Aktie nur einen Punkt, entspr. um 10 Punkte absackt.[28] Derivate ermöglichen damit die Erzielung mglst. hoher spekulativer Gewinne, bergen aber gleichzeitig auch in sich ein hohes Instabilitätsrisiko.
ddd) Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften
Zu den wichtigsten Akteuren auf den Finanzmärkten sind mittlerweile die Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften geworden, durch welche das Wachstum der grenzüberschreitenden Kapitalbewegungen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten erheblich beschleunigt und die gesellschaftl. Beziehungen, insbes. diejenigen zwischen Kapital und Arbeit und zwischen Aktionären und Unternehmensleistungen stark verändert wurden.[29] So ging bspw. der hohe Einkommenszuwachs der Kapitalbesitzer in den 90er Jahren mit sinkenden Arbeitskosten und steigender Ausbeutung der Arbeitskraft einher.
eee) Zwischenergebnis
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Aussage von der „Globalisierung der Finanzmärkte“ durchaus zutreffend ist. So haben die Finanzbewegungen mittlerweile einen derart hohen Stellenwert erreicht, dass sie, unmittelbar bzw. mittelbar, das gesamte Wirtschaftsleben (mit)bestimmen. Die dabei fließenden Finanzströme nehmen, nicht zuletzt durch die Rolle neuer Kapitalanlagemöglichkeiten, direkt Einfluss auf die Lage in den Industrieländern, sowie die Lebensbedingungen der Gesamtbevölkerung in den Drittländern.
c) Fazit
Die vorstehenden Fakten verdeutlichen, warum die Globalisierung vielfach lediglich als ein rein oder zumindest primär wirtschaftl. Prozess verstanden wird. Tatsächlich hat sie auf diesem Sektor deutliche Spuren hinterlassen. Gleichwohl weist Globalisierung aber auch noch andere Dimensionen und damit Definitionsmerkmale auf. Die Vergrößerung von wirtschaftl. Integrationsräumen durch die Einbeziehung zusätzlicher Volkswirtschaften in die internat. Arbeitsteilung, sowie die zunehmend internat. werdende Ausrichtung unternehmerischer Aktivitäten stellen eben nur, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, einen Teilbereich dar.
2.) Die technologische Globalisierung
Ein Vorgang, welcher in direktem Zusammenhang mit der wirtschaftl. Globalisierung steht, ist die Globalisierung der Technologie. Darunter ist sowohl die Verbreitung „neuartiger“ Technologien als auch die Mglkt. ihrer großflächigen, länderübergreifenden Nutzung zu verstehen.
a) Die Verbreiterung der Kommunikationsmöglichkeiten
Einen Aspekt stellt dabei ein Schlagwort dar, welches schon gar nicht mehr aus dem heutigen Sprachgebrauch wegzudenken ist, nämlich das des sog. Kommunikationszeitalters. Es lässt sich am besten mit folgendem Satz charakterisieren: „Der Weg war das Ziel - wir nähern uns dem Ende der Entfernung.“[30] Tatsächlich ist die Welt in den letzten Jahrzehnten „näher zusammengerückt“. Zurückzuführen ist dies auf die wachsende Verbreitung und Nutzung insbes. von Telefon und Internet. Derartige Kommunikationsnetze zeichnen sich v.a. dadurch aus, dass ihr Nutzen für alle mit jedem neuen Teilnehmer wächst: mehr Gesprächspartner, mehr Kunden, mehr Informationen, mehr Dienste… immer dichter wird das Telekommunikationsnetz, das von seiner eigenen Expansion lebt.[31]
b) Weitere „Massentechnologien“
Darüber hinaus ist an dieser Stelle beispielhaft auch die kontinuierliche Zunahme zivil genutzter Satelliten zu erwähnen, welche zwischenzeitlich die nahezu lückenlose GPS-Navigation ermöglichen, oder aber der Fernsehübertragung sowie der digitalen Informationsübermittlung dienen. Aber auch in den westlichen Regionen zwischenzeitlich alltägliche Dinge, wie bspw. die grds. Mglkt. der Nutzung von Kraftfahrzeugen, sind hierunter zu verorten.
c) Einschränkungen
Trotz alledem muss an dieser Stelle jedoch hervorgehoben werden, dass Technologie keinesfalls mit Gleichheit einhergeht. So steigt bspw. der Preis für einen Internetanschluss exponentiell mit der Entfernung von den Zentren der vernetzten Gesellschaft. „Die geographische Verteilung der High-Speed-Zugänge, der Fernsehsender und der innovativsten Industrien deckt sich mit der Verteilung der Einkommen und des Zugangs zu Bildung und Gesundheitsleistungen.“[32] Der Zugang zum Internet, das einmal als demokratisches Zukunftsmedium große Hoffnungen geweckt hat, bleibt deshalb bislang einer relativ kleinen Minderheit der Weltbevölkerung vorbehalten.
d) Zusammenfassung
Es bleibt deshalb an dieser Stelle festzuhalten, dass der technologische Fortschritt zweifelsohne ein wesentliches Element der Globalisierung darstellt. Dennoch sind die in diesem Zusammenhang erzielten Errungenschaften noch nicht der Mehrheit der Weltbevölkerung zugängig, weshalb nur mit Einschränkungen von einem weltweiten Technologietransfer gesprochen werden kann.
2.) Die sozialwissenschaftliche Bedeutung der Globalisierung
Als Folge der wirtschaftl. und technologischen Globalisierung stellt sich schließlich die soziologische Globalisierung dar. In diesem Kontext bedeutet Globalisierung auch eine Veränderung in sozialer und polit. Hinsicht.[33] Anders formuliert: „Die Globalisierung revolutioniert die Art und Weise, wie Gesellschaften organisiert sind.“[34] Im folgenden soll anhand zweier Beispiele verdeutlicht werden, inwieweit die Globalisierung in diesem Bereich ihre Spuren hinterlassen hat.
a) Auswirkungen auf die Sozialstruktur der Bevölkerung
Die Veränderung in sozialer Hinsicht lässt sich dabei am besten am Beispiel der sog. Global Cities verdeutlichen. Dabei handelt es sich um Ballungszentren, welche nicht nur die Zentralen der globalen Ökonomie mit umfangreichen Steuerungs- und Kontrollfunktionen, sondern auch als Orte eines kosmopolit. Milieus der Dienstleistungsgesellschaft und der Ausprägung einer neuen sozialen Klassifikation anzusehen sind.[35] Eine Global City, welche die Kontroll- und Steuerungsfunktionen in sich bündelt, sei immer dann gegeben, wenn die betreffende Stadt einerseits als ökonomische Kommandozentrale in Erscheinung trete, sie andererseits einen bedeutenden Markt für führende Industrien, besonders der Finanz- und Dienstleistungswirtschaft, biete und sie schließlich einen hohen Stellenwert in der Produktion jener Dienstleistungsgüter habe.[36] Diese Voraussetzungen seien aber nur erfüllbar, wenn einerseits ein Netz aus spezialisierten Anbietern komplementärer Dienstleistungen, bspw. Versicherungen, Softwareunternehmen, Anbieter von Informations- und Netzwerktechnik oder Wirtschaftsberater, Forschungseinrichtungen und Universitäten, Brokerfirmen oder Banken, existiere, auf der anderen Seite aber auch neben den urbanen infrastrukturellen Einrichtungen gute Kommunikations- und Verkehrsverbindungseinrichtungen gegeben seien. Neben der damit einhergehenden Folge der räumlichen Konzentration hochrangiger Kontroll- und Koordinationseinrichtungen der Weltwirtschaft, habe eine Global City jedoch auch noch eine Schattenseite. Diese sei in der dadurch bedingten Sozialstruktur zu erblicken, welche durch eine sich verschärfende Polarisierung zwischen Arm und Reich gekennzeichnet sei. So biete die Global City auf der einen Seite einen Arbeitsmarkt für hoch qualifizierte Arbeitnehmer, die als polit. und ökonomische Führungselite über sehr gute Einkommen verfügen, in den besten städtischen Vierteln wohnen und in ihrer Lebensweise und -einstellung global orientiert sind. Der Führungselite steht eine zahlenmäßig weitaus größere Anzahl von Menschen ggü., die der sog. Mittelschicht angehören. Diese Menschen gehen Tätigkeiten nach, welche eine geringere Qualifikation erfordern und sind in ihrer Einstellung weniger global als nat. geprägt. Denn, wenngleich sich die obere Mittelschicht in ihrem Denken und Handeln eher an der Oberschicht orientiert, steht der Großteil dieser Gruppe Globalisierungstendenzen eher skeptisch ggü. und sieht sich im internat. ökonomischen Wettbewerb mit anderen Nationen. Die unterste Bevölkerungsschicht bildet diejenige Gruppe von Menschen, die entweder vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder aber nur teilweise integriert sind. Diese Menschen überbetonen ihre nat. Zugehörigkeit, da sie häufig in direktem Wettbewerb mit Menschen anderer ethnischer Zugehörigkeit stehen.[37]
b) Die internationale Migration
Ein weiterer, neben das verstärkte Arm-Reich-Gefälle in soziologischer Hinsicht tretender Effekt der Globalisierung ist das Phänomen der Migration ganzer Bevölkerungsteile, zumeist aus den peripheren in die hochentwickelten Länder des Zentrums der Weltwirtschaft. Dabei wurde die Zuwanderung im Wesentlichen durch zwei Mechanismen gesteuert: Einerseits veranlasste der polit. Rückzug der Länder Westeuropas aus ihren ehemaligen Kolonien mehrere Millionen Europäer dazu, in ihre jeweiligen Heimatländer zurückzukehren. Ihnen folgten mehrere Millionen Menschen aus Afrika, Asien und der Karibik aufgrund der dortigen schlechten Lebensverhältnisse, wobei die meisten Migranten dabei ebenfalls die Mutterländer der jeweiligen Kolonialmacht bevorzugten. Andererseits setzte der zusätzliche Bedarf an billigen Arbeitskräften im Westeuropa der Nachkriegsjahrzehnte ebenfalls Millionen von Menschen in Bewegung.[38] Die hierbei von den Ausländern eingenommenen Arbeitsplätze finden sich zumeist am unteren Ende der beruflichen und sozialen Hierarchie, verdrängten teilweise die einheimische Bevölkerung oder übernahmen Segmente, die von der einheimischen Bevölkerung freiwillig aufgegeben wurden. Aber auch am oberen Ende der Arbeitshierarchie ist ein überproportionaler Anteil an Migranten beschäftigt.[39] Hierbei handelt es sich um Manager von transnat. Unternehmen, Wissenschaftler, Techniker und andere hochbegabte Menschen. Mit der Entstehung neuer Wirtschaftszentren ist zwischenzeitlich auch die Zahl der Aufnahmeländer gewachsen: So können nun selbst Staaten mit begrenzter Anziehungskraft, wie bspw. Japan und die asiatischen Länder, ein reg. bedeutsames Zufluchtsland sein.[40]
c) Fazit
Abschließend lässt sich damit festhalten, dass sich der Prozess der Globalisierung in soziologischer Hinsicht v.a. in der Herausbildung eines zunehmenden Arm-Reich-Gefälles, sowie an der internat. Migration ganzer Bevölkerungsteile aus wirtschaftl. benachteiligten Ländern in die Zentren der Weltwirtschaft äußert.
3.) Zusammenfassung - Die Dimensionen der Globalisierung
Wie vorstehender Abschnitt gezeigt hat, ist es nicht mgl., Globalisierung mit einer einfachen Definition treffend zu umschreiben. Eine äußerst hilfreiche Formulierung dürfte die Dieter Duwendags sein: „Früher sprach man von „internat. Verflechtung“ oder „weltwirtschaftl. Integration“ der Volkswirtschaften, um die Entwicklung grenzüberschreitender Transaktionen zu kennzeichnen - heute bzw. seit Ende der 1980er Jahre spricht man von „Globalisierung“. Und in der Tat reflektiert dieser Begriff mehr als nur die Substitution eines Wortes: Es sind das enorm gestiegene Tempo und Ausmaß der globalen Transaktionen, die diesen neuen Begriff rechtfertigen.“[41] Will man seine Tragweite dabei mglst. vollständig erfassen, so ist es erforderlich, sich darüber im Klaren zu werden, dass dieses Phänomen mittlerweile auf sämtliche Bereiche des täglichen Lebens Einfluss nimmt, bzw. selbige teilweise zwischenzeitlich sogar maßgeblich dominiert. So betrifft es zwar hauptsächlich die Wirtschaft, beeinflusst damit letztlich aber auch Gesellschaft und Kultur, sowie, wie sich noch zeigen wird, die Umwelt und die nat. und internat. Politik. Aufgrund der vielschichtigen, immer weiter zunehmenden Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisse der einzelnen Dimensionen ist es zwischenzeitlich nicht mehr ohne weiteres mgl., selbige immer klar voneinander zu trennen. So sind die Grenzen dazwischen, wie bspw. die technologische Globalisierung, welche Folge der wirtschaftl. und (Mit)Ursache der soziologischen Globalisierung ist, deutlich zeigt, fließend. Ebenso wichtig ist es aber auch, zu erkennen, dass nicht ohne weiteres alles zur Globalisierung gehört oder von ihr maßgeblich bestimmt wird. „Auch die Globalisierung stößt an ihre Grenzen.“[42] Es ist deshalb von äußerster Wichtigkeit, sich von der Macht dieses Begriffs und der Allgegenwärtigkeit seiner Verwendung zu distanzieren.
II) Globalisierung als Prozess
Wie bereits eingangs erörtert, ist Globalisierung keinesfalls als statische Beschreibung eines Ist-Zustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern vielmehr als ein fortwährender Prozess aufzufassen. Geht man aber von einer stetigen Entwicklung aus, so kommt man nicht umhin, den historischen Verlauf, die Ursachen, die zur Globalisierung geführt haben, sowie die Folgen, welche die Globalisierung mit sich bringt, näher zu beleuchten.
1.) Die theoretischen Ansätze zur historischen Entwicklung der Globalisierung
Doch bereits bei dem Versuch einer historischen Betrachtung tut sich ein neues Dilemma auf: Denn der Globalisierungsdiskurs wird nicht nur unter normativen Gesichtspunkten sehr kontrovers geführt, auch unter analytischen Gesichtspunkten herrscht große Unklarheit darüber, was denn unter Globalisierung zu verstehen ist, bzw. wann Globalisierung, historisch gesehen, eingesetzt hat. Im folgenden sollen die hierzu vertretenen Ansichten in zusammengefasster Form dargestellt werden.
a) Globalisierung zeitgleich mit der Verwendung des Begriffes?
Eine erste Mglkt. könnte darin bestehen, für den Zeitpunkt des Einsetzens der Globalisierung maßgeblich darauf abzustellen, ab wann der Begriff im Sprachgebrauch überhaupt verwendet wurde.[43] Während dieser in den 70er und 80er Jahren nämlich entweder gar nicht oder aber nur äußerst selten auftaucht, erfuhr er seit Anfang der 90er Jahre eine nahezu inflationäre Verwendung. Ob dieses Kriterium jedoch tatsächlich tauglich ist, einen langwierigen Prozess treffend zeitlich einzugrenzen, muss auf das Schärfste bezweifelt werden. Denn, wenngleich der Begriff „Globalization“ erstmals 1961 in einem englischsprachigen Lexikon auftaucht und erst seit der im Jahre 2000 erschienenen 22. Auflage im Duden geführt wird,[44] wurden bereits viel früher alternative Begriffe mit einem verwandten Bedeutungsgehalt verwendet. Nur ein Beispiel hierfür ist die Verwendung des Wortes „planetarisch“ durch den deutschen Psychiater und Philosoph Karl Jaspers bereits im Jahre 1932. „Als technische und wirtschaftl. scheinen alle Probleme planetarisch zu werden. Der Erdball ist nicht nur zu einer Verflechtung seiner Wirtschaftsbeziehungen und zu einer möglichen Einheit technischer Daseinsmeisterung geworden; immer mehr Menschen blicken auf ihn als den einen Raum, in welchem als einem geschlossenen sie sich zusammenfinden zur Entfaltung ihrer Geschichte.“[45]
b) Globalisierung bereits ab Mitte der 80er Jahre?
Man könnte auch davon ausgehen, dass die Globalisierung bereits Mitte der 80er Jahre, also vor der Prägung des begrifflichen Ausdruckes, einsetzte. „Zumindest das symbolische Auftaktdatum könnte demzufolge das New Yorker Plaza-Abkommen vom September 1985 gewesen sein, als eine Neufestsetzung der Wechselkurse der wichtigsten Volkswirtschaften verabredet wurde.“[46] Im Zuge dessen wurde, um die Ungleichheiten in den Handelsbilanzen dieser Länder zu korrigieren, der US-Dollar ggü. der Deutschen Mark und dem Japanischen Yen abgewertet. Dies führte jedoch keineswegs zu einer Verstärkung des Globalisierungseffekts: Denn, wenngleich gewaltige weltweite Finanztransaktionen die unmittelbare Folge waren, so bildete sich in Japan durch sog. „Kasino-Wirtschaft“ eine „Bubble Economy“, welche schließlich im Jahre 1990 platzte. Der Begriff der Kasino-Wirtschaft stammt von John Maynard Keynes. Dieser kam zu dem Schluss, dass die Investitionsentscheidungen in kapitalistischen Ökonomien mit hoch entwickelten Finanzmärkten letztlich nach einem dem Kasino-Spiel ähnelnden Muster getroffen werden. „Spekulanten mögen unschädlich sein als Seifenblase auf einem steten Strom der Unternehmungslust. Aber die Lage wird ernsthaft, wenn die Unternehmungslust die Seifenblase auf einem Strudel der Spekulation wird.“[47] Das Spiel der Spekulation führt dabei zu einer Überbewertung von Geldanlagen, insbes. von Aktien und Immobilien. Daraus folgen wiederum erhöhter Konsum, sowie gleichzeitig erhöhte Investitionen. Es bildet sich eine Blase. Unter „Bubble Economy“, zu deutsch „Blasen-Wirtschaft“, versteht man nun eine Volkswirtschaft, die (zunächst) von einer solchen Spekulationsblase profitiert (und dann nach dem Platzen der Blase darunter leidet). In Japan führte das Platzen der Blase letztlich, verschärft durch die Finanz und Wirtschaftskrise, die die ganze Welt erschütterte, zu Deflation und Nullwachstum.[48]
c) Globalisierung ab Mitte der 70er Jahre?
Es gibt aber Stimmen, die behaupten, die Globalisierung habe Mitte der 70er Jahre begonnen, „als es zum ersten Mal in großem Stil zur Verlagerung von Produktionsstandorten kommt, wobei hier nicht natürliche Faktoren (Vorkommen von Bodenschätzen, Böden, Klima) oder der Marktzugang als Folge von Protektionismus, sondern Kostengesichtspunkte (z.B. unterschiedliche Löhne) das Motiv für Auslandsinvestitionen sind.“[49] In diesem Zusammenhang entstehen weltweit in sog. Billiglohnländern, also Ländern, in denen große Teile des Bruttosozialprodukts durch niedrig entlohnte Arbeitskräfte erbracht werden, „freie Produktionszonen“, „Weltmarktfabriken“ oder „Industrieparks“, vornehmlich in den Bereichen der Montageindustrie, also bspw. der Bekleidungsindustrie, der Unterhaltungselektronik, der Spielwaren- oder der Sportartikelherstellung. Aus dieser Entwicklung folgte letztlich die Entstehung eines Weltmarktes für Arbeitskräfte und Industriestandorte.
d) 1945 als maßgeblicher Zeitpunkt?
Man könnte jedoch auch noch früher, nämlich im Jahre 1945 ansetzen.[50] Dahinter stehen im Wesentlichen drei Überlegungen: Einerseits erreichte die Entwicklung der Waffentechnik mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki erstmals einen Punkt, an dem die globale Zerstörung der Welt mgl. war, auf der anderen Seite handelte es sich aber bei dem in der Folgezeit hochkochenden Ost-West-Konflikt aufgrund der verschiedenen Schauplätze in Mitteleuropa und Ostasien um den ersten wirklich globalen Konflikt. Darüber hinaus führte die amerikanische Besatzung in vielen westeuropäischen Ländern, sowie in Ostasien zum Beginn der Ausbreitung des american way of life über die ganze Welt.
e) Das Ende des 19.Jahrhunderts
Aber auch mit dem Jahre 1945 ist noch nicht der Startzeitpunkt der Globalisierung gefunden. So kam es im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zu Innovationen wie bspw. dem Einsatz von Dampfschiffen und damit einhergehend dem Betrieb erster Schiffahrtslinien, dem Eisenbahnbau auch außerhalb von Europa und Nordamerika oder der geographischen Verbreitung des Telegraphen.[51] Zu diesem Zeitpunkt erlebte der internat. Handel den ersten wirklich quantitativen Aufschwung und die internat. Arbeitsteilung begann erstmals, rentabel zu werden.
f) Die Industrielle Revolution
Die Transportrevolution, die Ende des 19. Jahrhunderts schließlich ihren Niederschlag fand, war aber wiederum lediglich Folge der ihr vorangegangenen Industriellen Revolution. Erst in selbiger vollzog sich der Übergang der vormodernen Gesellschaft der frühen Neuzeit in die industrielle Gesellschaft der neuen und neuesten Zeit.[52] „Die Industrialisierung Europas war nicht nur ein welthistorisches Ereignis, weil sie mittelfristig jeden Winkel der Erde in der einen oder anderen Weise tangierte, sondern sie besaß sogar eine menschheitsgeschichtliche Dimension.“[53] Ihren Ursprung fand sie während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England,[54] wo Absolutismus und Grundherrschaft, viel früher als in anderen europäischen Ländern, gelockert waren. Mit der Abschaffung des Zunftzwanges waren damit die Voraussetzungen für eine freiere Ausbreitung des Handels, der Kapitalbildung, sowie der technischen Erneuerung gelegt. Als Ausgangspunkt der Industrialisierung wird die Erfindung der Dampfmaschine angesehen. Diese wurde zwar bereits im Jahre 1712 durch Thomas Newcomen konstruiert, aber erst im Jahre 1769 durch James Watt dergestalt weiterentwickelt, dass ihre Nutzung auch wirtschaftl. rentabel und damit für verschiedenste Einsatzgebiete nutzbar wurde. Allmählich setzte sich eine regelrechte Dampfmaschinen-Ökonomie durch, wobei die Textilindustrie, die bereits vorher Erfindungen wie bspw. das Spinnrad oder dem mechanischen Webstuhl für sich entdeckt hatte, in diesem Zusammenhang als Pionier der modernen industriellen Produktion gilt.[55] Erstmals war eine industrielle Massenfertigung auf mechanischer und nicht mehr nur handwerklicher Basis mgl., die einerseits einen wachsenden Rohstoffbedarf, andererseits aber auch einen zunehmenden Export von Gütern nach sich zog.[56] In diesem Zusammenhang sorgte v.a. die französische Kontinentalsperre von 1807 bis 1814 dafür, dass englische Textilien vom europäischen Kontinent nach Nord- und Südamerika, ja sogar nach Asien umgeleitet wurden. Begünstigt wurde die zunehmende Produktion und der sich immer weiter ausbreitende Handel schließlich durch die Entwicklung neuer, maschinell betriebener Fahrzeuge, wie der Dampflokomotive oder aber auch des Dampfschiffes, die sich in absehbarer Zeit, weil sie Waren sehr schnell und innerhalb einer berechenbaren Zeit über Land und Meer transportieren konnten, als neue Verkehrsmittel etablierten.
g) Die europäische Welteroberung am Ende des 15. Jahrhunderts
Der Zeitpunkt, in welchem die Globalisierung einsetzte, liegt aber noch viel weiter zurück. So begann am Ende des 15. Jahrhunderts die europäische Welteroberung, als Kolumbus 1492 vermeintlich und Vasco da Gama 1498 tatsächlich den Seeweg nach Indien fanden.[57] Es kam in diesem Zusammenhang zu einem Konflikt zwischen Spanien und Portugal darüber, wie die neu gefundenen Länder aufzuteilen seien. Portugal beanspruchte dabei die Kontrolle des Seeweges nach Indien entlang der afrikanischen Küste, Spanien hingegen wollte die Kontrolle sowie die Rechte über die von Christoph Columbus entdeckten Länder im Westen, also das vermeintliche Indien. Beigelegt werden sollte der Streit durch den Vertrag von Tordesillas im Jahre 1494. In selbigem wurde eine koloniale Demarkationslinie vereinbart und die davon westliche Hemisphäre der „neuen Welt“ den Spaniern, die östliche Hemisphäre den Portugiesen zugesprochen.[58] Ergänzt wurde dieser Vertrag 1529, nachdem die Spanier und Portugiesen als Folge der ersten Weltumsegelung Magellans auch im Pazifik aufeinander gestoßen waren und man erkannte, dass die für den Atlantik festgelegte Demarkationslinie einer korrespondierenden im Pazifik bedurfte, durch den Vertrag von Zaragossa.[59] Wenngleich der zwischen dem spanischen König Fernando VI und dem portugiesischen König Johann V im Jahre 1750 unterzeichnete Vertrag von Madrid, in welchem die Grenzen zwischen den Kolonien der beiden Monarchien in Südamerika neu definiert wurden, alle vorangegangenen und damit auch diese beiden Verträge für gegenstandslos erklärte, so sind darin dennoch die ersten Verträge der Weltgeschichte mit globaler Reichweite zu erblicken.[60]
h) Globalisierung bereits seit dem 13. Jahrhundert?
„Wenn aber, …, die Attraktivität Asiens so stark war, dass die Europäer nichts unversucht ließen, den direkten Kontakt mit Indien, China und Japan zu suchen, statt auf den indirekten Kontakt über arabische Zwischenhändler angewiesen zu sein, dann könnte es auch schon vor der Ankunft der ersten Europäer, also etwa seit dem 13. Jahrhundert, in Asien ein florierendes Weltsystem gegeben haben. Konsequenz wäre, dass Globalisierung viel älter wäre, nur hätte sie ihren Ausgang nicht in Europa, sondern in Asien genommen, wäre die Welt nicht im Sinne des klassischen Eurozentrismus von Westeuropa aus erschlossen worden.“[61]
i) Tatsächlich: zu allen Zeiten Weltwirtschaft
Tatsächlich muss die Suche nach dem genauen Startpunkt der Globalisierung im Uferlosen enden. Weltwirtschaft gab es nämlich, wie die nachfolgenden Beispiele eindrucksvoll verdeutlichen werden, zu allen Zeiten.
aa) Fundstellen in der Bibel
So kennt bereits die Bibel im Alten Testament in den Büchern der Könige die länderübergreifende Vermittlung von Rohstoffen und Personal, als der König Salomo seinen Tempel- und Palastbau in Angriff nahm: „Und der König Salomo sandte hin und ließ Hiram von Tyrus holen, … ein Arbeiter in Erz; und er war voll Weisheit und Einsicht und Kenntnis, um allerlei Werk in Erz zu machen; und er kam zu dem König Salomo und machte sein ganzes Werk.“[62] Da es aber auch an Rohstoffen wie Zedern- und Zypressenholz, sowie Gold für den Bau mangelte, unterstützte ihn der König von Tyrus, Hiram, auch diesbzgl.[63] König Salomo gelang es jedoch trotz größter kaufmännischer Anstrengungen, wie dem Transithandel mit Streitwagen oder Versuchen der eigenen Schifffahrt, die ggü. König Hiram offenen Forderungen zu begleichen.[64] Aus diesem Grunde musste Salomo an Hiram schließlich 20 Städte, sowie das sog. Land Kabul, eine wichtige und fruchtbare Region, abtreten.[65] Länderübergreifende Beziehungen und Verflechtungen gab es damit also auch bereits um das Jahr 945 v.Chr., also vor mehr als 3000 Jahren.
bb) Das Europa des 9. Jahrhunderts
Macht man einen Zeitsprung aus der vorchristlichen Zeit in das 9. Jahrhundert, so wird man auch hier einen gewissermaßen „globalen“ Handel finden. In dieser Zeit litt Nordwesteuropa unter zahlreichen Normanneneinfällen und der südliche und südwestliche Teil des Kontinents hatte es mit periodischen Raub- und Beutezügen der Sarazenen zu tun.[66] Jene Begegnungen führten, so die archäologischen Befunde, bspw. zu einer gewerblich betriebenen Tuchmalerei in Friesland, weil die Normannen dafür sorgten, dass die Einwohner ihre naturbegünstigte Wollerzeugung und ihr häusliches Werkgeschick in ein Gewerbe verwandeln konnten, aber auch zu den sog. Aufstiegsbahnen von Venedig und Amalfi, welche in der Herstellung internat. wirtschaftl. Verknüpfungen bestanden. Insbes. Amalfi entfaltete sich dabei zu einer araberfreundlichen Seerepublik, deren Quartiere und Kontakte rund um das Mittelmeer am Ende des 10. Jahrhunderts nahezu einen eigenen Handelsraum darstellten.[67]
cc) Europa im 11. und 12. Jahrhundert
Derartige erste Entwicklungen nahmen dann in den folgenden Jahrhunderten eine Größenordnung an, die bereits die Annahme vielschichtiger internat. Verflechtungen rechtfertigt. „Da das Mittelmeer und der Norden die beiden Pole des internat. Handels darstellten, bildeten sich im Vorstoß des Christentums in diese beiden Gravitationszentren zwei Randzonen mit mächtigen Handelsstädten heraus. Beide Bereiche verband eine Berührungszone, die sich dadurch auszeichnet, dass sie der Austauschfunktion zwischen beiden Handelsgebieten sehr bald eine industrielle, produzierende Funktion hinzufügte: Es handelt sich um das nordwestliche Europa - d.h. Südostengland, die Normandie, Flandern, die Champagne und die Gegend um Maas und Niederrhein.“[68] Dabei lief bspw. das Verhalten der Flandern auf eine Zirkulationsleistung hinaus: „Sie geben den englischen Zisterzienserklöstern Freiberger Silber gegen einheimische Wolle, bringen diese bspw. nach Ypern, wo sie dann entweder zu ungefärbtem oder mit Hilfe von byzantischem Alaun zu gefärbtem Wolltuch verarbeitet wird, um anschließend vielleicht nach Russland zu gelangen. Jedenfalls hatte man schon um 1100 in Nowgrood den Beitritt zur Bruderschaft der Kaufleute mit Tuch aus Ypern zu quittieren.“[69]
[...]
[1] Went, Ein Gespenst geht um… Globalisierung!, S.9.
[2] Rau in: Herausforderungen der Globalisierung für die nationale und supranationale Politik, S.141 ff (141).
[3] so auch Schmidt, Globalisierung, S.15.
[4] Duwendag, Globalisierung im Kreuzfeuer der Kritik, S.11.
[5] Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[6] Hübner, Der Globalisierungskomplex, S.21.
[7]
[8] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.46.
[9] vgl. Achcar u.a., La monde diplomatique, S.47.
[10] Emunds, Wirtschaft / Ökonomie, S.16.
[11] Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[12] vgl. Hübner, Der Globalisierungskomplex, S.59.
[13] Hübner, Der Globalisierungskomplex, S.59.
[14] Hübner, Der Globalisierungskomplex, S.59.
[15] vgl. Hübner, Der Globalisierungskomplex, S.61.
[16] vgl. Hübner, Der Globalisierungskomplex, S.61.
[17] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.26.
[18] vgl. Engelke, in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.57 ff (65).
[19] vgl. Achcar u.a., La monde diplomatique, S.27.
[20] Geographie Englisch Online, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[21] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.32.
[22] Bundesamt für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[23] Geographie Englisch Online, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[24] Wirtschaftslexikon 24, genau angegeben im Literaturverzeichnis.
[25] Quelle: Internationaler Währungsfond, World Economic Outlook, Mai 2005, Kapitel 3, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[26] Quelle: Internationaler Währungsfond, World Economic Outlook, Mai 2005, Kapitel 3, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[27] WGZ Bank, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[28] Wirtschaftslexikon 24, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[29] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.33.
[30] Knoke, in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.21 ff (22).
[31] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.10.
[32] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.11.
[33] Thomas Korber, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[34] Knoke in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.21 ff (22).
[35] vgl. Gerhard, Global Cities.
[36] so Noller, Globalisierung, Stadträume und Lebensstile, S.118 f.
[37] vgl. dazu: Korte / Mättig, Individualisierung und Globalisierung, S.124 ff.
[38] Thomas Korber, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[39] vgl. Achcar u.a., La monde diplomatique, S.54.
[40] Achcar u.a., La monde diplomatique, S.55.
[41] Duwendag in: Die neuen Kommandohöhen, S.119 ff (121).
[42] D@dalos, Globalisierung Grundkurs 2: Dimensionen der Globalisierung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[43] vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[44] Buchner, die Geschichte der Globalisierung, S.1.
[45] Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, S.74.
[46] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[47] Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, S.134.
[48] vgl. Japan-Infos, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[49] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[50] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[51] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[52] Condrau, Die Industrialisierung in Deutschland, S.1.
[53] Ziegler, Die Industrielle Revolution, S.1.
[54] Ziegler, Die Industrielle Revolution, S.13.
[55] Ziegler, Die industrielle Revolution, S.2, 3.
[56] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[57] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[58] vgl. Kalenderblatt der Deutschen Welle, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[59] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[60] vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[61] Bundeszentrale für politische Bildung, genaue Angabe im Literaturverzeichnis unter Online-Quellen.
[62] Die Bibel, Altes Testament, Erstes Buch der Könige 7, Absätze 13, 14.
[63] vgl. Die Bibel, Altes Testament, Erstes Buch der Könige 9, Absatz 11.
[64] Hedtke in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.91 ff (94).
[65] Tadmor in: Ben-Sasson, Geschichte des jüdischen Volkes, S.133.
[66] Hedtke in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.91 ff (95).
[67] Hedtke in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.91 ff (96).
[68] Le Goff, Kaufleute und Bankiers im Mittelalter, S.13.
[69] Hedtke in: Globalisierung - eine Satellitenaufnahme, S.91 ff (96).
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Globalisierung aus politisch-ökonomischer Sicht?
Unter Globalisierung wird der fortschreitende Prozess der weltweiten Vernetzung der nationalen Produkt-, Faktor- und Finanzmärkte verstanden, was zu einer tiefgreifenden Integration in die Weltwirtschaft führt.
Welche makroökonomischen Indikatoren messen die wirtschaftliche Globalisierung?
Zu den wichtigsten Indikatoren gehören das Bruttosozialprodukt, der Anteil weltweiter Exporte am Weltbruttoinlandsprodukt sowie die Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen und spekulativer Geldströme auf den Finanzmärkten.
Was ist das Ziel des Global-Governance-Konzepts?
Global Governance bezeichnet die Installation globalpolitischer Strukturen und Regelwerke, um die Herausforderungen der Globalisierung durch Multilateralismus und koordinierte Marktkorrekturen politisch zu steuern.
Welche Rolle spielt die technologische Globalisierung?
Die technologische Globalisierung umfasst die Verbreiterung von Kommunikationsmöglichkeiten und Massentechnologien, die eine grenzenlose Anwendung und Vernetzung erst ermöglichen.
Wie hängen Globalisierung und die Finanzmarktkrise zusammen?
Die Finanzmarktkrise wird im Kontext der Globalisierung als Folge unkontrollierter Geldströme und mangelnder globaler Regulierungsstrukturen gesehen, was die Notwendigkeit von Global Governance verdeutlicht.
- Quote paper
- Florian Hempel (Author), 2009, "Globalisierung" & "Global Governance", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135773