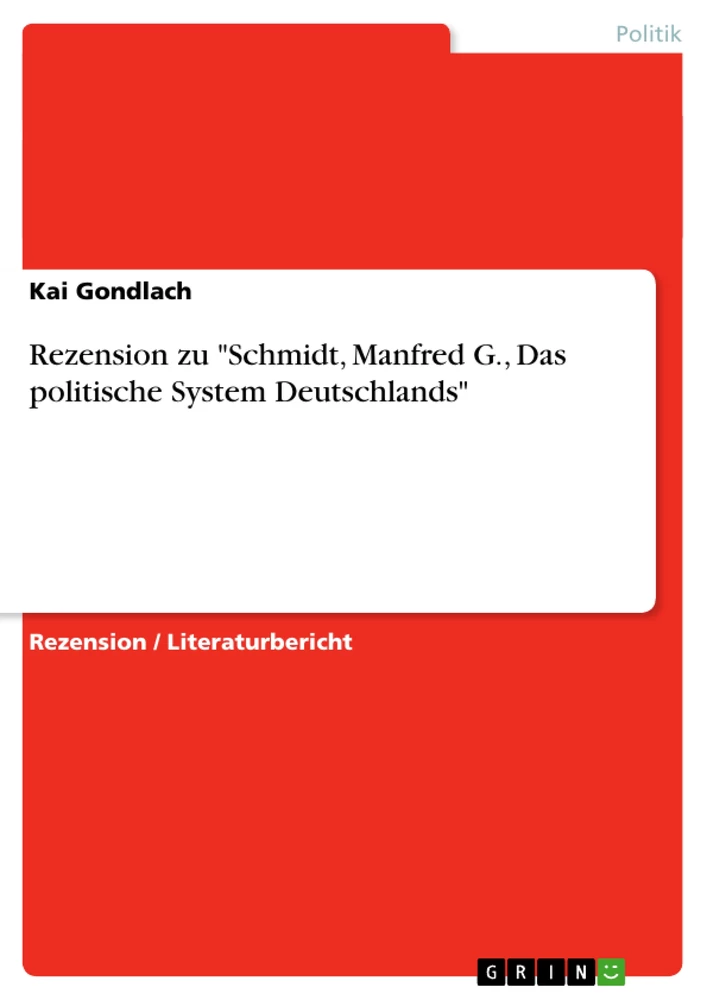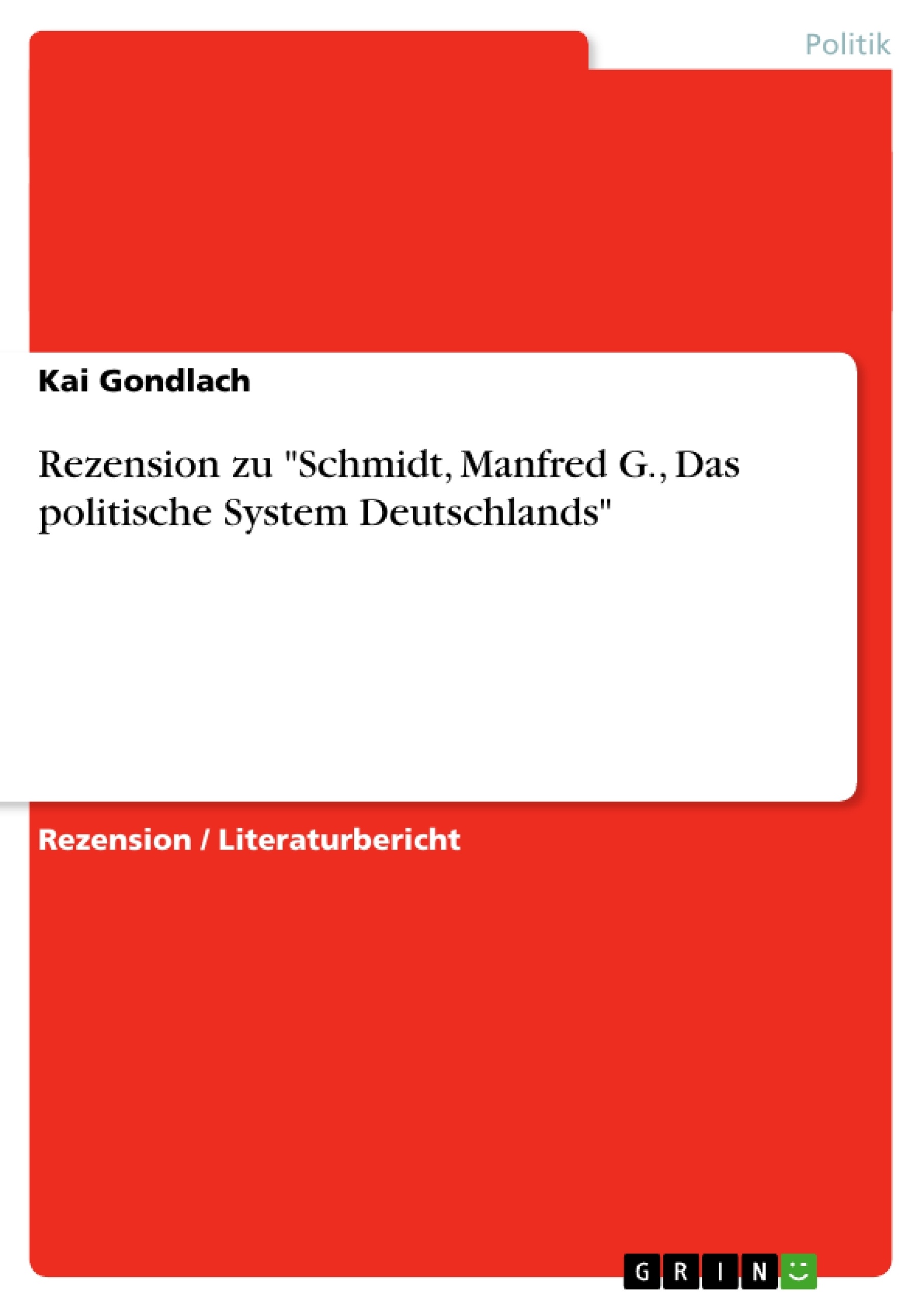Die vorliegende Rezension beschäftigt sich ausführlich mit dem bekannten Einführungswerk zum politischen System in Deutschland von Manfred G. Schmidt und versucht, im Stile eines Exzerpts den Inhalt teilweise kommentiert wiederzugeben. Der erste Teil wird ausführlicher dargestellt, einige Kapitel des zweiten Teils werden sehr stark komprimiert. Abgesehen von einem Lexikonartikel (siehe Literaturverzeichnis) wurde keine weitere Literatur hinzugezogen. Manfred G. Schmidt analysiert in dem Band „Das politische System Deutschlands“ die Institutionen, Willensbildung sowie Politikfelder in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Neben der Betrachtung auf dem Hintergrund der Geschichte Deutschlands vergleicht der Autor das System mit anderen Demokratien nicht nur auf Grundlage der eigenen Ansichten und früheren Werke, sondern diskutiert eine Vielzahl politik- und gesellschaftswissenschaftlicher Näherungsweisen. Schließlich kommt Schmidt dabei zu einer Bilanz, die sich im internationalen Vergleich sowie trotz den Kritiken der Anfangsjahre der Republik sehen lassen kann. Das Einführungswerk ist gegliedert in 19 Kapitel, die durch drei große thematische Teile gruppiert sind: die Staatsverfassung (I), Außen- und innenpolitische Politikfelder und das Verhalten der Regierungen (II) und schließlich Leistungen und Mängel (III), die sich aus den ersten beiden Teilen ergeben. Eingeleitet wird das Werk vom Autor, indem er seine Intention, den Gegenstand seiner Untersuchungen und schließlich die Zielgruppe definiert. Die Absicht des Autors ist es, auf der Grundlage der dargelegten Untersuchungen die politischen Abläufe, Institutionen und Inhalte der Bundespolitik im nunmehr seit fast 50 Jahren stabilen Staat zu bewerten.
Die vorliegende Rezension beschäftigt sich mit dem bekannten Einführungswerk zum politischen System in Deutschland von Manfred G. Schmidt und versucht, im Stile eines Exzerpts den Inhalt teilweise kommentiert wiederzugeben. Der erste Teil wird ausführlicher dargestellt, einige Kapitel des zweiten Teils werden sehr stark komprimiert. Abgesehen von einem Lexikonartikel (siehe Literaturverzeichnis) wur-de keine weitere Literatur hinzugezogen.
Manfred G. Schmidt analysiert in dem Band „Das politische System Deutschlands“ die Institutio-nen, Willensbildung sowie Politikfelder in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Neben der Betrachtung auf dem Hintergrund der Geschichte Deutschlands vergleicht der Autor das System mit anderen Demokratien nicht nur auf Grundlage der eigenen Ansichten und früheren Werke, sondern diskutiert eine Vielzahl politik- und gesellschaftswissenschaftlicher Näherungsweisen. Schließlich kommt Schmidt dabei zu einer Bilanz, die sich im internationalen Vergleich sowie trotz den Kritiken der Anfangsjahre der Republik sehen lassen kann.
Das Einführungswerk ist gegliedert in 19 Kapitel, die durch drei große thematische Teile grup-piert sind: die Staatsverfassung (I), Außen- und innenpolitische Politikfelder und das Verhalten der Regierungen (II) und schließlich Leistungen und Mängel (III), die sich aus den ersten beiden Teilen ergeben. Eingeleitet wird das Werk vom Autor, indem er seine Intention, den Gegenstand seiner Untersuchungen und schließlich die Zielgruppe definiert. Die Absicht des Autors ist es, auf der Grundlage der dargelegten Untersuchungen die politischen Abläufe, Institutionen und Inhalte der Bundespolitik im nunmehr seit fast 50 Jahren stabilen Staat zu bewerten.
Im ersten Kapitel behandelt der Autor die Staatsverfassung der Bundesrepublik Deutschland un-ter Berücksichtigung der turbulenten Geschichte, insbesondere der in den Jahren 1933-1945 herr-schenden Diktatur der Nationalsozialisten. Das Verhalten der Besatzungsmächte und insbesondere deren Sendungsbewusstsein prägte das Grundgesetz im Westen stark, allerdings wurden auch alttradierte Grundzüge des deutschen „Feindstaats“ gewürdigt und eingearbeitet. In der sowjeti-schen Besatzungszone wurde im selben Jahr der Gründung der Bundesrepublik Deutschland die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen, welche aber im vorliegenden Werk nicht näher analysiert wird.
Die Ausarbeitung der Verfassung erfolgte hauptsächlich unabhängig von den Besatzern, lediglich sechs grundlegende Vorgaben mussten befolgt werden: „Rechtsstaat, Republik, Demokratie, Bun-desstaat, Sozialstaat, ‚offener Staat‘“ (Schmidt 2007:26). Im Folgenden erläutert der Autor die nä-here Bedeutung der Begriffe und bevor er zur kontroversen Erörterung der Resultate der Staats-verfassung kommt, wird flüchtig der Verlauf Deutschlands als gespaltene Nation mit eingeschränktem Souveränitätsstatus bis 1990 skizziert. Das Überwiegen an positiven Bewertungen des Grund-gesetzes gegenüber den negativen spricht für den Begriff der „Erfolgsgeschichte“ (Schmidt 2007:16).
Zum Teil vorgreifend stellt Schmidt im sechsten und letzten Unterkapitel sieben Hauptmerkmale der Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland heraus: Es liegt eine Mischung aus mehrheits-und konkordanzdemokratischer Regelsysteme vor, zahlreiche Mechanismen zur Aufteilung von Macht funktionieren. Ferner herrscht eine gewisse Halbsouveränität infolge der absoluten Vor-rangstellung der Verfassung und Souveränitätstransfers an inter- und supranationale Organisatio-nen wie beispielsweise die EU (mit der gleichen Argumentation begründet Schmidt den „offenen Staat“, der hauptsächlich für die Reintegration Deutschlands in die westliche Welt verantwortlich ist), und Dauerstress für alle politisch Beteiligten aufgrund der überdurchschnittlich vielen Veto-spieler und Mitregenten neben den Parteien. Die letzten beiden Punkte sind Kompetenzverlage-rungen auf gesellschaftliche Assoziationen, sowie die Existenz eines „Staat[s] der großen Koaliti-on“, der sich durch die Notwendigkeit der Konsensfindung zwischen den beiden großen Parteien in Deutschland – SPD und die Unionsparteien CDU/CSU – auszeichnet (Schmidt 2007:40ff.).
Das zweite Kapitel untersucht die verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Wahlrecht und die Ver-fassungswirklichkeit. Zur Veranschaulichung holt Schmidt bis zur griechischen Antike aus, erläutert dann das Wahlsystem in der Bundesrepublik seit 1949, insbesondere bei Bundestagswahlen, und listet verschiedene Ausformungen der Verhältniswahl im Kontrast zur Mehrheitswahl auf. Schmidt kritisiert zum Einen den Umgang mit Überhangmandaten und außerdem die überdurchschnittlich starke Stellung der politischen Parteien bei der Auswahl der Kandidaten, die auf der starren Liste zur Wahl stehen, was zu einem deutlichen Demokratieverlust führt. Schließlich bezieht der Autor insofern Stellung, als er verschiedene positive und negative Kritikpunkte am Wahlsystem darstellt, insgesamt aber zu dem Schluss kommt, dass das deutsche Wahlsystem insgesamt stabil und ge-recht ist und die „wichtigsten Gütekriterien [...] erfüllt“ (Schmidt 2007:52) werden. Die Idee einer Wahlrechtsreform wird als unwahrscheinlich eingestuft.
Kapitel drei setzt sich mit dem deutschen Durchschnittswähler auseinander. Von der sozialen Zu-sammensetzung der Wählerschaft über die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich ho-he Wahlbeteiligung von 84,6 % (zwischen 1949 und 2005) zeigt Schmidt den Wandel vom Drei-Parteien- zum Sechs-Parteien-System im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik mit tendenziel-ler Entwicklung von den bürgerlichen zu den Mitte-links bis Linksparteien, was ebenfalls eine Sel-tenheit in Europa ist. Besonders nach der Wiedervereinigung 1990 lassen sich große Unterschiede innerhalb der Wählerschaft feststellen. Zu den wichtigsten Folgen im Wähler- und Parteiengefüge der Bundesrepublik gehört die Wanderung auf der ideologischen Achse von Mitte-rechts zu Mitte-links-Parteien sowie die Gründung einer neuen Partei Bündnis’90 / Die Grünen, die fortan eine wichtige Rolle in der Politik spielte und zwischen 1998 und 2005 sogar an der Bundesregierung beteiligt war.
In Teil fünf und sechs des dritten Kapitels werden die Milieubindungen sowie Parteiidentifikation als Entscheidungsfaktor bei der Stimmenabgabe bei Bundestagswahlen und abschließend Bundes-tags- und Landtagswahlen im nationalen Vergleich analysiert. Ein Ergebnis ist, dass Landespolitik in der Regel keinen großen Einfluss auf Bundespolitik hat, mit der großen Ausnahme der Mitwirkung der Exekutiven der Länder im Bundesrat.
Das vierte Kapitel behandelt die Parteienlandschaft der Bundesrepublik unter besonderer Be-obachtung der These vom „Parteienstaat“, in welchem die Parteien eine Monopolstellung bei der Interessenvermittlung zwischen Staat und Bürgern sowie bei der Rekrutierung von Führungsper-sonal einnehmen, was sich in Deutschland speziell durch den geringen Anteil fraktionsloser Parla-mentarier auszeichnet. Die Untersuchung der Parteien erfolgt hauptsächlich auf historisch-ideologischer Ebene, an deren Ende der Autor eine abstrakte Kurzformel für jede Partei formuliert.
Das Parteiensystem Deutschlands ist geprägt durch eine „große politisch-ideologische Spannwei-te“ (Schmidt 2007:101), besonders seit dem Fall der Mauer und der Wiedereingliederung der östli-chen Bundesländer. Die relativ hohe Mitte-Lastigkeit der Parteienlandschaft führt zum Einen zu einer hohen Koalitionsfähigkeit bei Regierungsbildungen insbesondere auf Länderebene und au-ßerdem zu den bisher stets geglückten Regierungswechseln. Während die beiden größten Partei-enformationen (Unionsparteien CDU/CSU sowie die SPD) sozialstaatsfreundliche Programme ha-ben, was die Ausformung des Sozialstaats begünstigt, fehlen systemgegnerische Parteien gänzlich, was ebenso bezeichnend wie selten im internationalen Vergleich ist. Die Beobachtung der Politik-inhalte der Parteien zeigt das Fehlen grundlegender Unterschiede zwischen den Parteien. Lediglich in einigen Politikfeldern gehen die Ansichten stärker auseinander, beispielsweise bei der Wirt-schafts- und Sozialpolitik. Im Wesentlichen lassen sich die sechs Parteien in zwei Gruppen trennen; die Linksparteien (SPD, B’90 / Grüne und Die Linke.PDS) auf der einen und die bürgerlichen Partei-en (Unionsparteien und FDP) auf der anderen Seite – diese Teilung schließt Koalitionsbildung zwi-schen den Gruppen allerdings nicht aus, was sich besonders anhand der Koalition der SPD mit der FDP zwischen 1969 und 1982 sowie den beiden Großen Koalitionen (1966-1969 und seit 2005) zeigt.
[...]
- Arbeit zitieren
- Kai Gondlach (Autor:in), 2008, Rezension zu "Schmidt, Manfred G., Das politische System Deutschlands", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135630