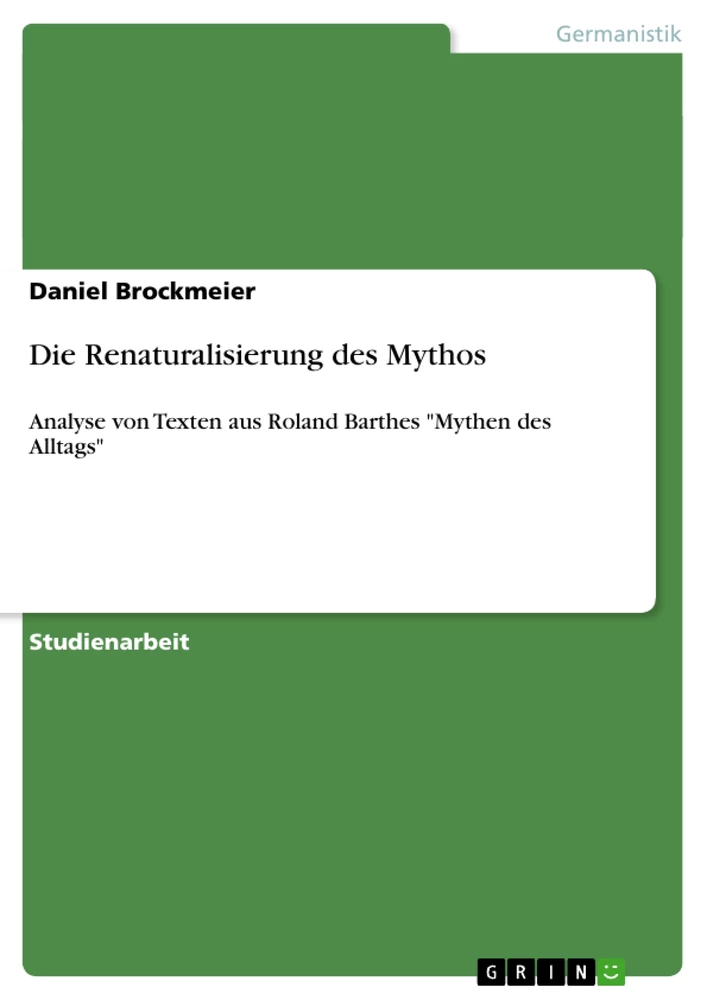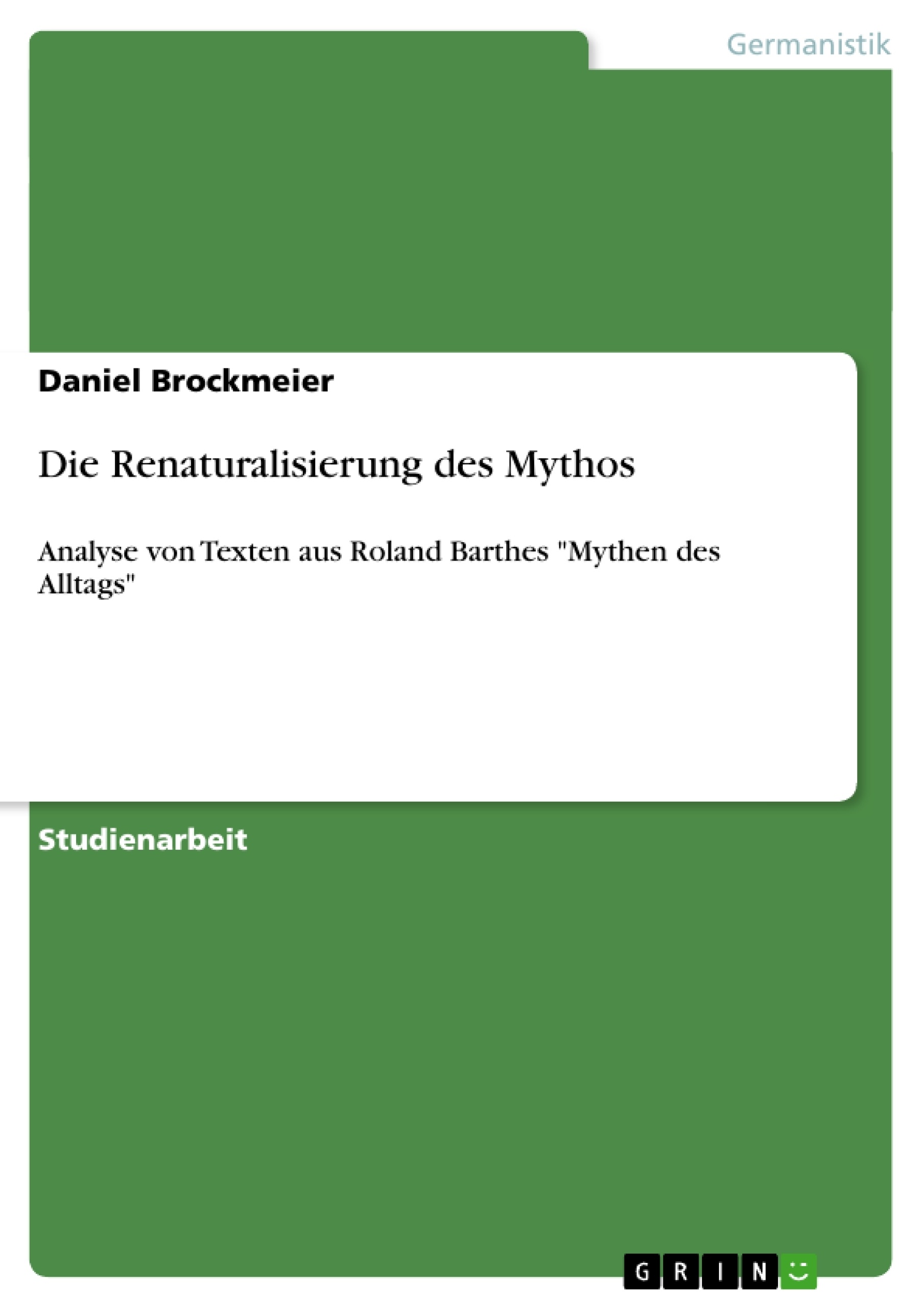Roland Barthes Mythentheorie aus "Mythen des Alltags" (1964) wird mit Hilfe von Nelson Goodmans Symboltheorie kritisch analysiert.
Das Ergebnis dieser Anaylse, dass der Mythos Bezugnahmegebiete ausblendet, wird dann im Gegenzug wieder an den Essays von Roland Barthes geprüft.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist der Mythos?
2.1 Barthes’ System des Mythos als Metasprache
2.2. Hat Roland Barthes die Mittel den Mythos zu beschreiben?
3. Was meint Barthes? – Einige Textbeispiele
3.1 Die Ikonographie des Abbé Pierre
3.2 quia ego nominor leo
3.3 Einsteins Gehirn
3.4 Der neue Citroën
4. Zwei Arten der Ausblendung von Bezugnahmegebieten
5. Fazit
6. Anhang
6.1 Titelblatt der „Paris Match“, Nummer 255, vom 20. Februar 1954.
6.2 Karikatur des Abbé Pierre
6.3 Titelblatt der „Paris Match“, Nummer 326, vom 25. Juni 1955.
7. Literatur
1. Einleitung
„Was ist ein Mythos heute? (…) der Mythos ist eine Aussage.“[1] So beginnt Roland Barthes, den zweiten Teil seiner „Mythen des Alltags“.[2] Der erste Teil des Buches besteht aus mehreren Essays über alltägliche Mythen, während jener zweite Teil die Theorie enthält.
In diesem Teil des Buches entwirft Roland Barthes eine Theorie, wonach der Mythos eine Metasprache sei. Demnach würde ein Zeichen der normalen Sprache oder Objektsprache zum signifiant verarmt und diesem ein neuer, ein mythischer signifié zugeordnet.[3]
In dieser Hauptseminarsarbeit soll die These geprüft werden, daß Barthes nicht die logischen Mittel hat, um den Mythos zutreffend zu beschreiben.[4] Roland Barthes stützt sich bei seiner Analyse auf die Terminologie Saussures, er untersucht signifiant, signifié und Zeichen.[5] Allerdings äußert sich Barthes nicht zur logischen Grundleistung, die ein Etikett erst in den Status eines Symbols versetzt: die Bezugnahme.[6]
Im Folgenden wird zunächst Barthes’ Theorie des Mythos als Metasprache dargelegt. Im nächsten Schritt soll geprüft werden, ob diese Theorie angemessen ist und wo gegebenenfalls ihre Schwächen liegen. Anschließend wird die, von Christian Stetter vertretene These, der Mythos blende Bezugnahmegebiete aus, vorgestellt und anhand der Essays von Roland Barthes geprüft[7]. Zum Schluß werde ich noch der Frage nachgehen, ob diese Ausblendung von Bezugnahmegebieten etwas Besonderes ist, oder ob dies nicht bei jeder, mithin auch bei nicht-mythischer Symbolisierung geschieht.
In dieser Hausarbeit werden in erster Linie Texte aus Roland Barthes „Mythen des Alltags“ analysiert. Barthes schreibt dem Mythos gewisse Eigenschaften zu, wobei er wiederholt Aussagen tätigt wie: „der Mythos (…) bezeichnet und zeigt an, er gibt zu verstehen und schreibt vor.“[8] Bei dieser Analyse des Mythos stellt sich die Frage, wer hier etwas zu verstehen gibt oder vorschreibt. Denn der Mythos selbst, sofern es sich bei ihm um ein Symbolschema handelt, ist dazu nicht in der Lage. Bedeutung wird durch Bezugnahme hergestellt und Bezugnahme ist eine menschliche Operation[9]. Dies soll nicht bedeuten, daß das Symbol neutral ist, „die Anwendung eines Etiketts bringt ebenso häufig eine Klassifikation hervor, wie sie sie festhält.“[10] Allerdings muß es jemanden geben, der ein Etikett anwendet. Ob der Mythos nun eine Metasprache ist, die ein Zeichen zum signifiant verarmt, oder ob durch ihn Bezugnahmegebiete ausgeblendet werden, es gibt in der gesprochenen oder geschriebenen Sprache nur die Möglichkeit mit Hilfe einer geeigneten Prädikation dies zu erreichen[11]. Die Frage ist, wer den mythischen Symbolen die entsprechenden Prädikate zuschreibt. Es ist ohne Frage Barthes selbst, der die Symbole mit „mythischen“ Prädikaten beschreibt. Er macht dies gewissermaßen stellvertretend, etwa für die französische Gesellschaft im Essay über Abbé Pierre oder für die Firma Citroёn im Essay über den Citroёn D.S. Barthes ist sich allerdings dieser Problematik bewußt:
„Und die Bedeutungen habe ich bei allen behandelten Gegenständen herauszufinden gesucht. Sind es meine Bedeutungen? Anders gesagt: gibt es auch eine Mythologie des Mythologen? Ganz sicher! Und der Leser wird meinen Wetteinsatz selbst erkennen.“[12]
Roland Barthes sieht darin allerdings kein Problem, sondern betrachtet es als eine Regel des Sprachspiels, das er spielt:
„Ich glaube jedoch gar nicht, daß das Problem, streng genommen, sich ganz auf diese Weise stellt. (…) Das soll heißen, daß ich nicht die alte Überzeugung teilen kann, nach der eine wesensmäßige Differenz zwischen der Objektivität des Gelehrten und der Subjektivität des Schriftstellers besteht (…).“[13]
Entsprechend werde ich in dieser Arbeit nicht der Frage nachgehen, ob die Mythen, die Barthes beschreibt, tatsächlich Mythen sind, sondern lediglich untersuchen, was er tut, wenn er diese Mythen beschreibt.
2. Was ist der Mythos?
2.1 Barthes’ System des Mythos als Metasprache
Im zweiten Teil der „Mythen des Alltags“[14] präsentiert Roland Barthes ein theoretisches Modell des Mythos. Seine erste Feststellung ist, daß es sich beim Mythos um eine Aussage handele. Der Mythos sei jedoch keine beliebige Aussage, statt dessen brauche die Sprache besondere Bedingungen, um Mythos zu werden.[15] Er geht davon aus, „daß der Mythos kein Objekt, kein Begriff oder eine Idee sein kann; er ist eine Weise des Bedeutens, eine Form.“[16]
Barthes’ Grundthese ist folglich, daß alles Mythos werden kann. Es gibt zwar formale Grenzen, aber keine inhaltlichen.[17] Weiter habe der Mythos eine geschichtliche Grundlage, keine natürliche,[18] womit Barthes aussagen möchte, daß lediglich semiotisches Material zum Mythos werden könne. Nichts, das nicht von Menschen geschaffen ist, ist in der Lage von sich aus, auf natürliche Weise Mythos zu sein.[19] Dennoch könne alles zum Mythos werden, auch beispielsweise ein Baum:
„(…) ein Baum von Minou Drouet ausgesprochen, ist schon nicht mehr ganz ein Baum, er ist ein geschmückter Baum, der einem bestimmten Verbrauch angepaßt ist, der mit literarischen Wohlgefälligkeiten, mit Auflehnungen, mit Bildern versehen ist, kurz: mit einem gesellschaftlichen Gebrauch“.[20]
Ferner sei der Mythos nicht auf die orale oder literale Sprache beschränkt, sondern jedes semiologische System könne Träger mythischer Aussagen sein. So faßt Barthes „Aussage“ auch entsprechend weit und verdeutlicht: „Eine Photographie ist für uns auf die gleiche Art und Weise Aussage wie ein Zeitungsartikel, die Objekte selbst können Aussage werden, wenn sie etwas bedeuten.“[21] Nach Barthes ist der Semiologe aus einem ganz einfachen Grunde berechtigt, Bilder und Sprache gleich zu behandeln: er sagt über beide nicht mehr, als daß sie beide Zeichen sind. Sie bilden beide eine Objektsprache, derer sich der Mythos bedient. Mit der gleichen Bedeutungsfunktion versehen gelangen sie beide zur Schwelle des Mythos.[22] Er erläutert an anderer Stelle, warum auch Objekte selbst zu Aussagen werden können:
„Jeder Gegenstand der Welt kann von einer geschlossenen, stummen Existenz zu einem besprochenen, für die Abneigung durch die Gesellschaft offenen Zustand übergehen, denn kein – natürliches oder nichtnatürliches – Gesetz verbietet von den Dingen zu sprechen.“[23]
Im folgenden beschäftigt sich Barthes mit dem Mythos als semiologischem System. Als Strukturalist folgt er dabei der Terminologie Saussures[24] und erinnert zunächst daran, daß jede Semiologie sich um die Beziehung zwischen signifiant und signifié zu kümmern hat. Diese Beziehung analysiert er als eine Beziehung der Äquivalenz (nicht der Gleichheit). Er legt ferner Wert darauf, wobei er ganz Saussure folgt[25], daß der signifiant nicht bloß den signifié ausdrückt, sondern das beide gemeinsam das Zeichen bilden. Der signifiant ist leer, während das Zeichen Bedeutung trägt. Signifiant, signifié und Zeichen stehen zueinander in einer Teil-Ganzes-Relation. Barthes legt Wert darauf, daß diese Feststellung wichtig, gar unerläßlich für die Untersuchung des Mythos ist.
Im Mythos findet sich die Trias von signifiant, signifié und Zeichen wieder. Das Besondere am Mythos ist nach Barthes die Tatsache, daß er ein sekundäres semiologisches System darstellt. Das Zeichen des ersten Systems, der Sprache, wird im zweiten, dem Mythos, zum signifiant reduziert.
Im Mythos seien zwei semiologische Systeme enthalten. Zum einen dasjenige, welches Barthes die Objektsprache nennt, die normale Sprache oder eine, ihr gleichgestellte Darstellungsweise, deren sich der Mythos bedient, „um sein eigenes System zu errichten“.[26] Zum anderen der Mythos selbst, die Metasprache. Es sei eine Sprache, in der man von der ersten Sprache spreche.
Barthes gibt nun einige Beispiele: Zunächst das des grammatischen Beispielsatzes, anhand dessen sich das Verhältnis von Objekt- und Metasprache exemplifizieren läßt.
„Ich bin Schüler einer Quinta in einem französischem Gymnasium, ich schlage meine lateinische Grammatik auf und lese darin einen aus Äsop oder Phädrus stammenden Satz: quia ego nominor leo. Ich halte inne und denke nach, dieser Satz hat eine Doppelbedeutung, einerseits haben die Wörter einen einfachen Sinn: denn ich werde Löwe genannt; andererseits steht der Satz offensichtlich da, um mir etwas anderes zu bedeuten; insofern er sich an mich, den Quintaner, richtet, sagt er mir ganz deutlich: ich bin ein grammatisches Beispiel, das bestimmt ist, die Regel für die Übereinstimmung von Subjekt und Prädikatsnomen zu illustrieren. Ich muß sogar erkennen, daß der Satz mir gar nicht seinen Sinn bedeutet, er versucht gar nicht, vom Löwen (und wie er genannt wird) zu sprechen; seine wirkliche und letzte Bedeutung besteht darin, sie mir als Präsenz einer bestimmten grammatischen Übereinstimmung aufzuzwingen.“[27]
Man kann an diesem Beispiel meines Erachtens sehr gut das Verhältnis von Objekt- und Metasprache im Bartheschen Sinne erkennen. Die Objektsprache stellt einfach eine Folge von signifiants dar, der ein signifié zugeordnet wird, woraus sich ein Zeichen mit der Bedeutung: „denn ich werde Löwe genannt“ ergibt. Doch in seiner Funktion, ein Beispielsatz zu sein, wird diese Bedeutung gestrichen und der Satz dient bloß noch als signifiant, dem nun ein neuer signifié zugeordnet wird und das so entstandene Zeichen trägt nun die Bedeutung: „Ich bin ein grammatisches Beispiel“.
Barthes nächstes Beispiel ist ein Bild aus Paris-Match:
„Auf dem Titelbild erweist ein junger Neger in französischer Uniform den militärischen Gruß, den Blick erhoben und auf eine Falte der Trikolore gerichtet.[28] Das ist der Sinn des Bildes. Aber ob naiv oder nicht, ich erkenne sehr wohl, was es mir bedeuten soll: daß Frankreich ein großes Imperium ist, daß alle seine Söhne, ohne Unterschied der Hautfarbe, treu unter seiner Fahne dienen und daß es kein besseres Argument gegen die Widersacher eines angeblichen Kolonialismus gibt als den Eifer dieses jungen Negers, seinen angeblichen Unterdrückern zu dienen.“[29]
Erneut zeigt Barthes, wie der Mythos funktioniert. Das primäre semiologische System erzeugt ein Zeichen mit der Bedeutung: „ein farbiger Soldat erweist den französischen militärischen Gruß.“[30] In der Metasprache wird dieses Zeichen erneut zum signifiant reduziert und ihm wird ein neuer signifié zugeordnet. Nach Barthes erhält das entstandene Zeichen nun eine Bedeutung, die eine absichtliche Mischung von Franzosentum und Soldatentum darstellt.[31]
An diesen Beispielen läßt sich erkennen, daß der signifiant des Mythos eine herausragende Stellung für Barthes Metasprache hat. Er ist bereits Zeichen der Sprache und wird zur bloßen Zeichengestalt des Mythos reduziert. Das Zeichen der Sprache, welches Barthes Sinn nennt, um es von seiner Funktion als signifiant des Mythos[32] abzuheben, bildet für sich bereits ein ganzes:
„Der Sinn ist bereits vollständig, er postuliert Wissen, eine Vergangenheit, ein Gedächtnis, eine vergleichende Ordnung der Fakten, Ideen und Entscheidungen.
Indem er Form wird, verliert der Sinn seine Beliebigkeit; er leert sich, verarmt, die Geschichte verflüchtigt sich, es bleibt nur noch der Buchstabe.“[33]
Als signifiant wird der Sinn zur Form verarmt, doch Barthes legt Wert darauf, daß der Sinn nicht entfernt werde, sondern „zur Verfügung“ gehalten wird.[34] Der Mythos könne jederzeit auf den Sinn zurückgreifen, wenn er ihn benötige. Der Sinn stelle einen Vorrat an Geschichte zur Verfügung, der vom Mythos zurückgerufen und wieder entfernt werden könne.[35] So borgt sich der Mythos gewissermaßen die Bedeutung der Sprache aus.
„Der grüßende Neger ist kein Symbol für das französische Imperium, dafür eignet ihm zuviel Präsenz, er gibt sich als ein reiches, spontanes, gelebtes, unschuldiges, unbestreitbares Bild. Doch gleichzeitig ist diese Präsenz unterworfen, beiseite gerückt, wie durchsichtig gemacht, sie weicht ein wenig zurück, macht sich zum Helfershelfer des Begriffes, der voll bewaffnet, zu ihr stößt, der französischen Imperialität: sie wird ausgeborgt.“[36]
Der signifié des Mythos beinhalte, so Barthes, nicht das Reale, sondern lediglich eine gewisse Kenntnis vom Realen. Dieses Wissen sei konfus, aus unbestimmten, unbegrenzten Assoziationen gebildet, „es ist eine formlose, unstabile, nebulöse Kondensation, deren Einheitlichkeit und Kohärenz mit ihrer Funktion zusammenhängen.“[37]
Barthes geht davon aus, daß der grundlegende Charakter des mythischen Begriffs darin bestehe, angepaßt zu sein. So fungiere das oben genannte grammatische Beispiel nur für eine ganz bestimmte Klasse von Schülern als solches. Das, die Imperialität symbolisierende, Bild richte sich nur an eine bestimmte Sorte von Lesern.[38]
[...]
[1] Barthes 1964; S.85.
[2] Barthes 1964.
[3] Vgl. Barthes 1964; S.85ff.
[4] Christian Stetter hat uns in seinem Hauptseminar: „Die Semiologie Roland Barthes“ im SoSe 2005 diese These dargelegt.
[5] Vgl. Stetter 1996; S.426ff.
[6] Vgl. Goodman 1993; S.162ff.
[7] Auch diese These hat Christian Stetter meines Wissens nicht publiziert, aber im o. g. Hauptseminar präsentiert.
[8] Barthes 1964; S.96.
[9] Vgl. Stetter 2005; S.36/37.
[10] Goodman 1968; S.41.
[11] Dieser Punkt wird im Kapitel 3 dieser Arbeit genauer erläutert.
[12] Barthes 1964; S.8.
[13] Barthes 1964; S.8.
[14] Barthes 1964; S.85ff.
[15] Barthes 1964; S.85.
[16] Barthes 1964; S.85.
[17] Barthes 1964; S.85.
[18] Vgl. Barthes 1964; S.86: „man kann sich sehr alte Mythen denken, aber es gibt keine ewigen; denn nur die menschliche Geschichte läßt das Wirkliche in den Stand der Aussage übergehen“.
[19] Vgl. Barthes 1964; S.90; Fußnote.
[20] Barthes 1964; S.86.
[21] Barthes 1964; S.87.
[22] Vgl. Barthes 1964; S.94.
[23] Barthes 1964; S.86.
[24] Vgl. Stetter 1996; S.426ff.
[25] Vgl. Stetter 1996; S.426ff.
[26] Barthes 1964; S.93.
[27] Barthes 1964; S.94.
[28] Wo ist die Trikolore auf dem Bild? Mir liegt das Titelblatt vor, aber eine Trikolore ist darauf nicht zu sehen Vgl. Anhang 6.2; S.28.
[29] Barthes 1964; S.95.
[30] Barthes 1964; S.95.
[31] Vgl. Barthes 1964; S.95.
[32] Bei Barthes die Form; vgl. Barthes; 1964; S.96ff.
[33] Barthes 1964; S.96/97.
[34] Vgl. Barthes 1964; S.97.
[35] Vgl. Barthes 1964; S.97.
[36] Barthes 1964; S.98.
[37] Barthes 1964; S.99.
[38] Vgl. Barthes 1964; S.99.
- Quote paper
- Daniel Brockmeier (Author), 2006, Die Renaturalisierung des Mythos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135601