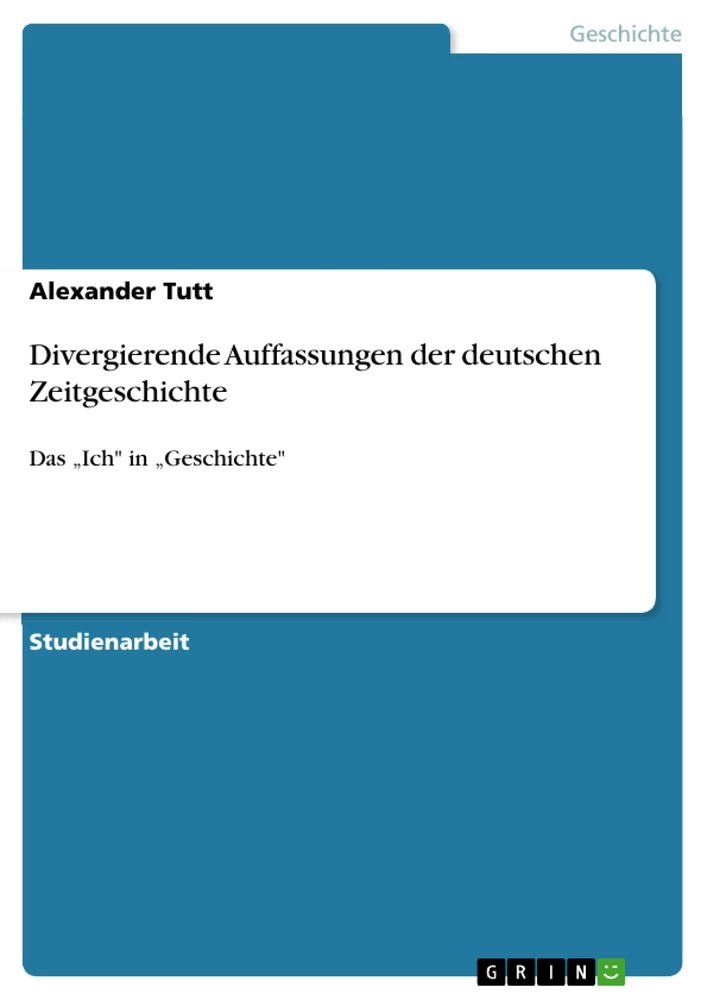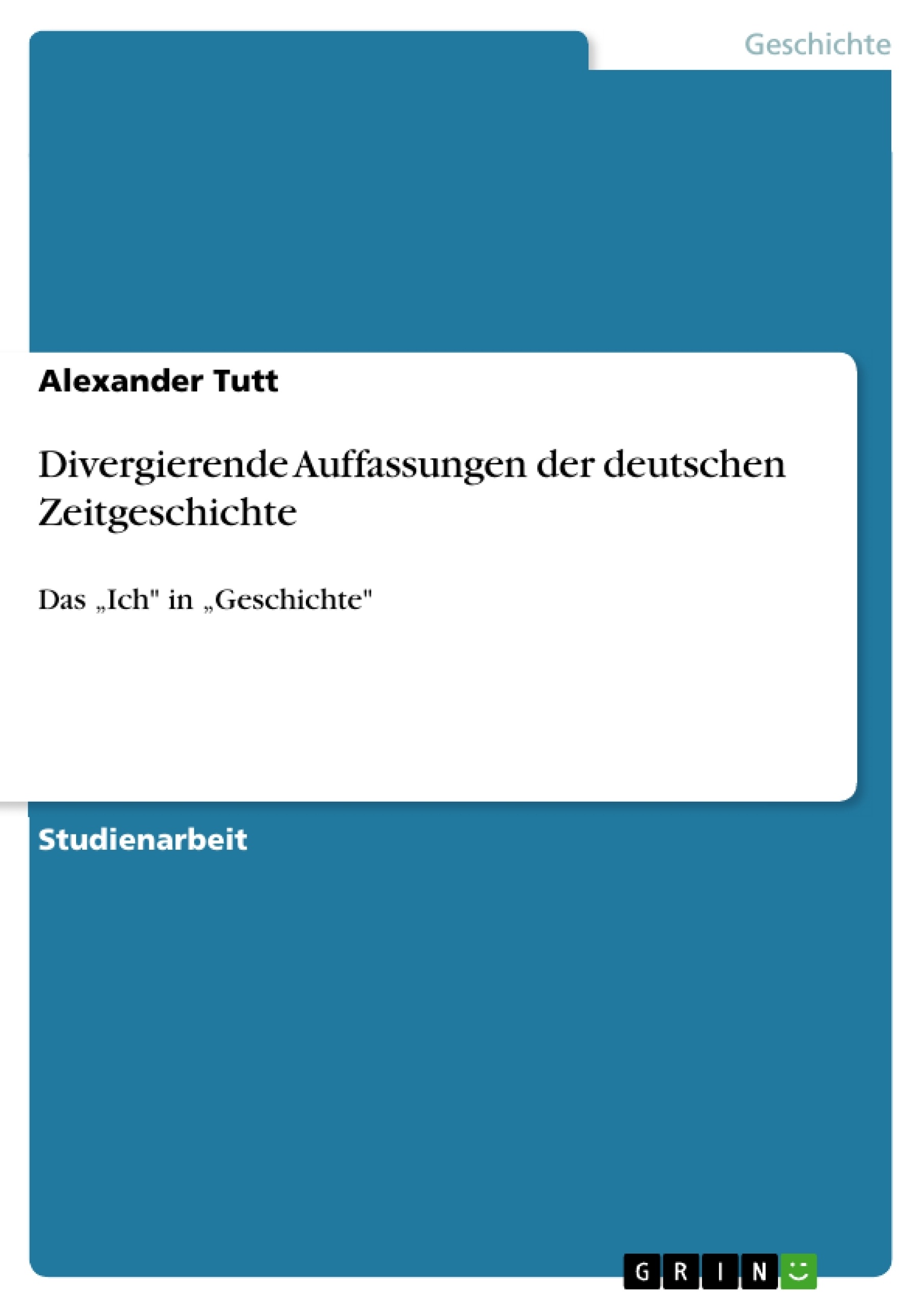Einleitung
Sobald man sich mit dem Begriff „Zeitgeschichte“ beschäftigt, wird man vor eine Vielzahl von Problemen der Begrifflichkeit und der Periodisierung ebenjener gestellt. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der näheren Vergangenheit, insbesondere der NS-Zeit, hat in den letzten Jahrzehnten an Popularität in der deutschen Bevölkerung zu-genommen. Ein Grund dafür ist der Boom der audiovisuellen Dokumentationen, welche von vielen Publizisten monumental und sensationell in Szene gesetzt werden. Diesen vorangegangene oder aus jenen hervorgegangene Publikationen taugen in der Regel nicht als Quelle für wissenschaftliche Arbeiten, es sei denn, sie beschäftigen sich mit der Thematik der Medialisierung der Historiographie. Nichtsdestotrotz ist die Quellenlage verwendbarer Publikationen für den Themen-bereich mehr als umfangreich, was die Sichtung relevanten Quellenmaterials sehr zeit-aufwendig gestaltet. Ziel dieser Hausarbeit ist es daher nicht, eine allgemeingültige epochale Einteilung der deutschen Zeitgeschichte zu definieren, sondern vielmehr, die Debatte um die Begrifflichkeit und Periodisierung zu beleuchten. Eingeläutet wurde die Debatte maßgeblich vom Mitherausgeber der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) Hans Rothfels, welcher in seinen einleitenden Worten der ersten Ausgabe dieser Zeitschrift die Auseinandersetzung der Zeitgeschichte als „Aufgabe“ bezeichnete. Diesen Hinweis haben viele Zeithistoriker aufgenommen, was sich in der Anzahl der Zitate eben jener Textpassage niederschlägt. Die Schwierigkeiten, die während der wissenschaftlich-historischen Auseinandersetzung mit der Gegenwart auftreten, thematisierte Peter Rassow im Jahre 1948 folgendermaßen:
„Aber die Tendenzen der eigenen Zeit in ihrem Wirrsal überhaupt zu
unterscheiden, ist für jeden Lebenden gerade unserer Zeit unendlich schwer.
Wer unterscheidet die lauten von den starken Kräften, die aktuellen, aus dem
Heute neu aufgebrochenen Kräfte von den aus der Vergangenheit zu uns
hereinwirkenden?“
Diese rhetorische Frage könnten viele Zeithistoriker als Ansporn für die Ausübung ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit sehen. Was vier bedeutende von ihnen bisher an Ergebnissen hervorbrachten soll in dieser Hausarbeit nun anhand ihrer diesbezüglichen Publikationen zusammengefasst und gegenübergestellt sein.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Die Auffassungen programmatischer Zeithistoriker
2.1 Hans-Joachim Rothfels
2.2 Eberhard Jäckel
2.3 Hans Günter Hockerts
2.4 Hans-Peter Schwarz
3. Fazit und Ausblick
1. Einleitung
Sobald man sich mit dem Begriff „Zeitgeschichte“ beschäftigt, wird man vor eine Vielzahl von Problemen der Begrifflichkeit und der Periodisierung ebenjener gestellt. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der näheren Vergangenheit, insbesondere der NS-Zeit, hat in den letzten Jahrzehnten an Popularität in der deutschen Bevölkerung zugenommen. Ein Grund dafür ist der Boom der audiovisuellen Dokumentationen, welche von vielen Publizisten monumental und sensationell in Szene gesetzt werden. Diesen vorangegangene oder aus jenen hervorgegangene Publikationen (z.B. die des Publizisten Guido Knopp) taugen in der Regel nicht als Quelle für wissenschaftliche Arbeiten, es sei denn, sie beschäftigen sich mit der Thematik der Medialisierung der Historiographie. Nichtsdestotrotz ist die Quellenlage verwendbarer Publikationen für den Themenbereich mehr als umfangreich, was die Sichtung relevanten Quellenmaterials sehr zeitaufwendig gestaltet. Ziel dieser Hausarbeit ist es daher nicht, eine allgemeingültige epochale Einteilung der deutschen Zeitgeschichte zu definieren, sondern vielmehr, die Debatte um die Begrifflichkeit und Periodisierung zu beleuchten. Eingeläutet wurde die Debatte maßgeblich vom Mitherausgeber der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) Hans Rothfels, welcher in seinen einleitenden Worten der ersten Ausgabe dieser Zeitschrift die Auseinandersetzung der Zeitgeschichte als „Aufgabe“ bezeichnete.[1] Diesen Hinweis haben viele Zeithistoriker aufgenommen, was sich in der Anzahl der Zitate eben jener Textpassage niederschlägt. Die Majorität der Zeithistoriker kommt zudem nicht umhin, das Zeitgeschichtsschreibertum des Thukydides zu thematisieren und somit den Weg freizumachen für eine meist philosophisch anmutende und dementsprechend umständlich formulierte Debatte.[2] Die Schwierigkeiten, die während der wissenschaftlich-historischen Auseinandersetzung mit der Gegenwart auftreten, thematisierte Peter Rassow im Jahre 1948 folgendermaßen:
„Aber die Tendenzen der eigenen Zeit in ihrem Wirrsal überhaupt zu unterscheiden,
ist für jeden Lebenden gerade unserer Zeit unendlich schwer. Wer unterscheidet die
lauten von den starken Kräften, die aktuellen, aus dem Heute neu aufgebrochenen
Kräfte von den aus der Vergangenheit zu uns hereinwirkenden?“[3]
Diese rhetorische Frage könnten viele Zeithistoriker als Ansporn für die Ausübung ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit sehen. Was vier bedeutende von ihnen bisher an Ergebnissen hervorbrachten soll in dieser Hausarbeit nun anhand ihrer diesbezüglichen Publikationen zusammengefasst und gegenübergestellt sein.
2. Die Auffassungen programmatischer Zeithistoriker
2.1 Hans-Joachim Rothfels
Als Koryphäe für die anfängliche Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen der deutschen Zeitgeschichte gilt Hans-Joachim Rothfels. Als Mitbegründer des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) 1952 und dadurch auch Mitherausgeber der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) wurde ihm ein programmatischer Ruf zuteil.[4] Die oben bereits erwähnte Einleitung des ersten VfZ enthielt bereits den Großteil der Fragestellungen, mit denen sich rezente Zeithistoriker heute noch auseinandersetzen. Rothfels setzte sich einleitend mit der Begrifflichkeit und der Herkunft des Wortes „Zeitgeschichte“ auseinander. Den epochalen Charakter der Zeitgeschichte ergründend kam er zu dem Schluss, dass die global auswirkenden Zäsuren der Jahre 1917/18 den Markstein einer „neuen universalgeschichtlichen Epoche“ ausmachten.[5] Einen Gegensatz zu dieser Periodisierung der Zeitgeschichte stellt seine Auffassung dar, dass Zeitgeschichte überdies „die Epoche der Mitlebenden und deren wissenschaftliche Behandlung“ verkörpere.[6] Dies macht aus heutiger Sicht den zeitgeschichtlichen Fixpunkt 1917/18 zu einer gewagten These. Unten wird näher darauf eingegangen. Rothfels verstand es, alle für die Darstellung der Zeitgeschichte relevanten Punkte zu thematisieren: zeitliche Distanz, Objektivität und Internationalität.[7] Obwohl Objektivität mitunter das Resultat zeitlicher Distanz darstellt, spielt jedes von beidem in Rothfels‘ Verständnis eine eigene signifikante Rolle. Zeitliche Distanz sei zwar in der Regel nötig, um einen Sachverhalt objektiv zu beschreiben, andererseits jedoch für das Aufnehmen der Eindrücke von Zeitzeugen rein logisch unmöglich. Die Objektivität hat zwar für Rothfels eine wichtige Funktion, sie wird aber auch als Grundeinstellung eines jeden Historikers angesehen. Die subjektive Betrachtung eines Zeithistorikers könne, insbesondere bei Themen, welche die eigene Geschichte betreffen, niemals vollends ausgeblendet werden.[8] Diese Ansicht verstärkend erklärt Rothfels,
„daß sie [die Zeitgeschichte] an keinerlei heißen Eisen, weder internationalen noch
nationalen, sich vorbeidrückt und nicht leere Räume offenläßt, in die Legenden sich
einzunisten neigen“.[9]
Zusammenfassend misst Rothfels der zeitgeschichtlichen Forschung mehrere Funktionen bei: „eine Forschungsaufgabe als wissenschaftliche Disziplin, eine staatsbürgerliche Erziehungsaufgabe und eine politische Aufgabe“.[10] Diese Ansicht resultierte im Falle Rothfels natürlich auch aus der Brisanz des Kalten Krieges. In zwei deutschen Staaten wurde grundverschiedenes Gedankengut vermittelt und Rothfels, seines Zeichens konservativer Hardliner, war umso mehr darauf bedacht, die ideologischen, politischen und vor allem globalen Verstrickungen für die Nachwelt festzuhalten. Sein Erbe, die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, stellen ein „Sammelbecken“ für Beobachtungen und Forschungen auf diesem Gebiet dar.[11] In seinem Werk „Zeitgeschichtliche Betrachtungen“ unterstreicht Rothfels den dynamischen Charakter der Zeitgeschichte und beschreibt im Zuge dessen die zu behandelnde Epoche als einen vom Historiker „ungeliebten Wandel“ dem man sich nicht entziehen könne.[12]
2.2 Eberhard Jäckel
In seinem Aufsatz „Begriff und Funktion der Zeitgeschichte“ geht Jäckel ebenfalls ausführlich auf die Etymologie des Begriffes „Zeitgeschichte“ ein und bemerkt dabei stolz, dass keine andere Sprache als die deutsche ein so „griffiges Wort“ für diesen Gegenstand der Geschichtswissenschaft zu bilden vermochte. Folgend definiert er die Zeitgeschichte als das, „was gleichzeitig geschieht und erzählt wird, historia sui temporis“.[13] Die Ansichten Rothfels‘ werden von Eberhard Jäckel auf negative Art und Weise aufgegriffen und kommentiert. Zum einen kritisiert er die „doppelte Definition“ des Zeitgeschichtsbegriffes Rothfels‘, zum anderen die wiederholte falsche Adaptation an ebenjene durch andere Historiker.[14] Auf die Suggestion von Hans Rothfels, dass die Beschäftigung mit der Zeitgeschichte einer unterschiedlichen Methodik folgen müsste, zeigt Jäckel seine Haltung dazu mit einem Zitat des britischen Historikers Alan Bullock. Demnach sind die vom Historiker auf seinem Bildungsweg erworbenen Fähigkeiten auf die Erforschung „der Geschichte unserer Zeit ebenso anwendbar“, da sich am qualitativen Charakter der Geschichte nichts ändere.[15] Eine Periodisierung von Zeitgeschichte, wie sie Rothfels für das Jahr 1917 vornahm, lehnt Jäckel vehement ab:
„Zeitgeschichte ist nicht allgemein datierbar. Sie ist kein geeigneter Begriff der
historischen Periodisierung. Sie bezeichnet vielmehr das Verhältnis eines Subjektes
zur Geschichte.“[16]
[...]
[1] Rothfels, H., Zeitgeschichte als Aufgabe, in: VfZ 1 (1953), S. 2.
[2] Geyer, M. H., Im Schatten der NS-Zeit - Zeitgeschichte als Paradigma einer (bundes-)republikanischen Geschichtswissenschaft, in: Zeitgeschichte als Problem - Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa, hrsg. v. Alexander Nützenadel - Wolfgang Schieder, Göttingen 2004, S. 25.
[3] Rassow, P., Der Historiker und seine Gegenwart, München 1948, S. 31.
[4] 1949 gegründet unter dem Namen „Deutsches Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit“.
[5] Rothfels, H., Zeitgeschichte als Aufgabe, S.6. Gemeint sind hier die russische Revolution, der Kriegseintritt der USA und die Folgen der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg.
[6] Ebd. S. 2.
[7] Ebd. S. 2-6.
[8] Rothfels, H., Sinn und Aufgabe der Zeitgeschichte, in: Ders., Zeitgeschichtliche Betrachtungen, Göttingen 19632, S. 13.
[9] Ebd. S. 8.
[10] Beer, M., Hans Rothfels und die Traditionen der deutschen Zeitgeschichte, in: Hans Rothfels und die deutsche Zeitgeschichte, Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, hrsg. v. Johannes Hürter - Hans Woller, München 2005, S. 184.
[11] Rothfels, H., Zeitgeschichte als Aufgabe, S. 4.
[12] Rothfels, H., Sinn und Aufgabe der Zeitgeschichte, S. 11.
[13] Jäckel, E., Begriff und Funktion der Zeitgeschichte, in: Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit, hrsg. v. Ders. - Ernst Weymar, Stuttgart 1975, S. 162.
[14] Jäckel, E., Begriff und Funktion der Zeitgeschichte, S. 171.
[15] Ebd. S. 173.
[16] Ebd. S. 172.
- Quote paper
- Alexander Tutt (Author), 2009, Divergierende Auffassungen der deutschen Zeitgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135454