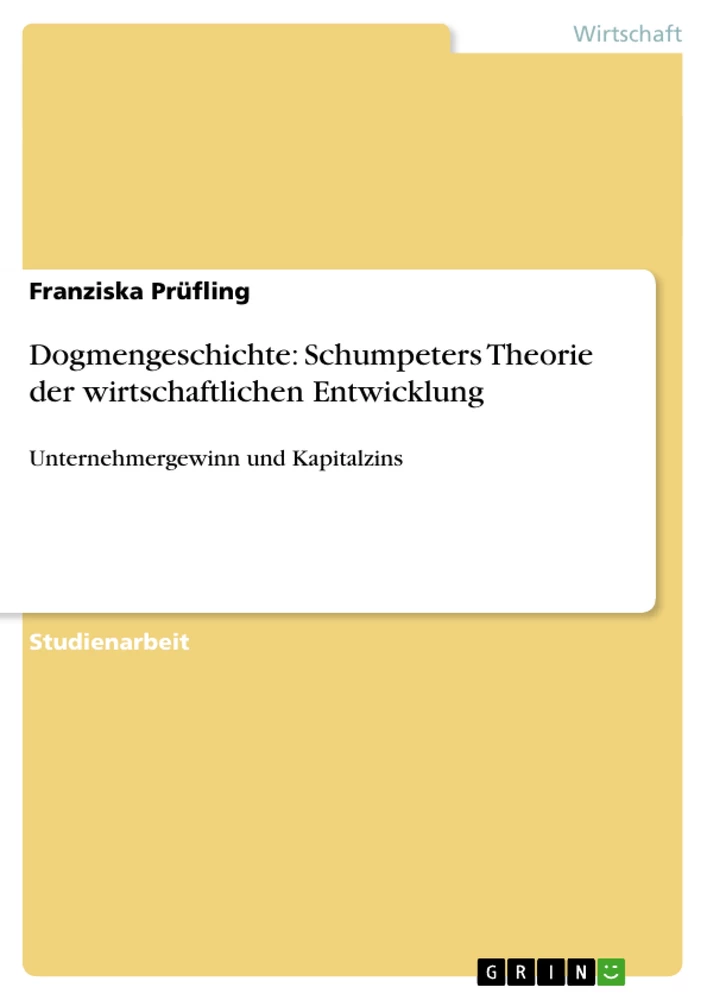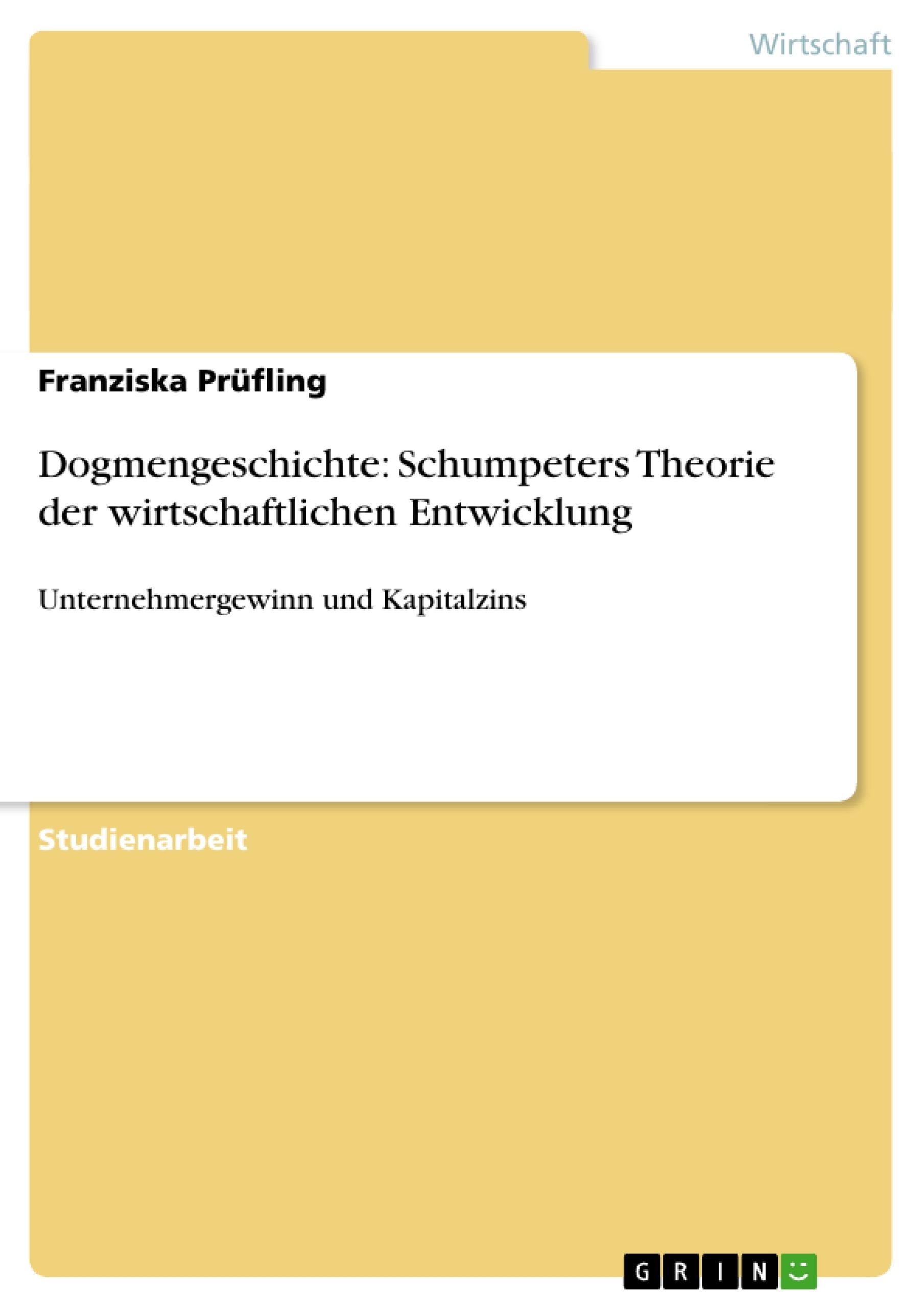Gegenstand dieser Arbeit ist die in Schumpeters `Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung´ herausgearbeitete Analyse des Unternehmergewinns oder Mehrwerts sowie dessen Konsequenz, dem Kapitalzins. Die Grundlage des Unternehmergewinns sieht Schumpeter, ausgehend von einem stationären Gleichgewicht, im Prozess eines dynamischen Kreislaufs. So wird die stationäre Wirtschaft - gekennzeichnet durch sogenannte stationäre Wirte - durch dynamische Pionierunternehmer und deren Imitatoren aus ihrem bisherigen Gleichgewicht gerissen, wodurch ein konjunktureller Aufschwung folgt.1 Ist die Innovation jedoch erfolgreich, erfolgt ein Prozess der schöpferischen Zerstörung, wobei alte Produktionsanlagen
oder Produkte entwertet und letztendlich aus der Volkswirtschaft verdrängt werden; es kommt zu einer Verlangsamung des Aufschwungs.2 Nach Schumpeter sind der Pionierbzw. Unternehmergewinn sowie der Zins lediglich ein Resultat der dynamischen Wirtschaft. Der Zins ist ein solches, da er nach Schumpeter seinen Ursprung im Unternehmergewinn findet. So ist der Zins entsprechend der extremen Version Schumpeters Zinstheorie in der stationären Kreislaufwirtschaft gleich Null.5 Diese Ansicht wird von vielen Ökonomen kritisiert. So entsteht nach Böhm-Bawerk ein Kapitalzins, aus welchem man sich ein dauerndes Einkommen schaffen kann, auch, wenn der Unternehmer hierfür „keine Hand zu seiner Entstehung gerührt hat“ und damit existiert er selbst in stationären Volkswirtschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Unternehmergewinn und Mehrwert
- Der Unternehmergewinn am Beispiel der Verbesserung des Produktionsprozesses
- Weitere Quellen des Unternehmergewinns
- Schaffung von Mehrwert durch den Einsatz neuer Kombinationen
- Kapitalzins
- Konsumtiv- vs. Produktivzins
- Schumpeters Leitsätze der Zinstheorie zur Lösung des Zinsdilemmas
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Schumpeters Theorie des Unternehmergewinns und des Kapitalzinses in seiner "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung". Die Zielsetzung besteht darin, Schumpeters Konzeption des Unternehmergewinns als Folge dynamischer Prozesse im Gegensatz zu einem statischen Gleichgewicht zu erläutern und die daraus resultierende Theorie des Kapitalzinses zu beleuchten.
- Der Unternehmergewinn als Ergebnis von Innovationen
- Schumpeters Konzept der schöpferischen Zerstörung
- Die Rolle des Unternehmers (Entrepreneur) in Schumpeters Theorie
- Der Zusammenhang zwischen Unternehmergewinn und Kapitalzins
- Kritik an Schumpeters Zinstheorie im Vergleich zu anderen Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Diese Arbeit untersucht Schumpeters Analyse des Unternehmergewinns und des Kapitalzinses in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Schumpeter sieht den Unternehmergewinn im dynamischen Kreislauf der Wirtschaft, der das stationäre Gleichgewicht durch Innovationen stört. Der Kapitalzins resultiert aus diesem dynamischen Prozess und ist in einem statischen Modell gleich Null. Diese These steht im Gegensatz zu anderen ökonomischen Ansätzen, wie der von Böhm-Bawerk, die den Kapitalzins auch in einer stationären Wirtschaft postulieren. Die Arbeit wird die beiden Konzepte beleuchten und die Unterschiede diskutieren.
Unternehmergewinn und Mehrwert: Dieses Kapitel analysiert den Unternehmergewinn als Kostenüberschuss, der aus der Differenz zwischen Erlösen und Ausgaben resultiert. Dieser Überschuss entsteht nur in einer dynamischen Wirtschaft durch Innovationen wie Prozess- oder Produktinnovationen, den Zugang zu neuen Märkten oder neue Organisationsstrukturen. Schumpeter betont die Rolle des Unternehmers als Initiator dieser Innovationen und erklärt, wie der Unternehmergewinn durch Nachahmung schwindet und nur temporär ist. Das Kapitel beleuchtet detailliert wie Prozessinnovationen durch den Einsatz neuer Produktionsmethoden zu einem Wertüberschuss führen, welcher letztendlich zum Unternehmergewinn wird und die Reorganisation der Branche nach sich zieht. Letztlich wird erörtert, wer von diesem Gewinn profitiert – der Unternehmer als Initiator der Innovation.
Schlüsselwörter
Unternehmergewinn, Kapitalzins, Schumpeter, Innovation, schöpferische Zerstörung, dynamische Wirtschaft, stationäres Gleichgewicht, Prozessinnovation, Produktinnovation, Entrepreneur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schumpeters Theorie des Unternehmergewinns und Kapitalzinses
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über Joseph Schumpeters Theorie des Unternehmergewinns und des Kapitalzinses, wie sie in seiner "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung" dargestellt wird. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Unternehmergewinns als Folge dynamischer Prozesse und Innovationen im Gegensatz zu einem statischen Gleichgewicht, sowie der daraus abgeleiteten Zinstheorie.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt zentrale Aspekte von Schumpeters Theorie, darunter: den Unternehmergewinn als Ergebnis von Innovationen (Prozess- und Produktinnovationen), Schumpeters Konzept der "schöpferischen Zerstörung", die Rolle des Unternehmers (Entrepreneur), den Zusammenhang zwischen Unternehmergewinn und Kapitalzins, die Unterscheidung zwischen konsumtivem und produktivem Zins, Schumpeters Leitsätze der Zinstheorie und eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Zinstheorie im Vergleich zu anderen Ansätzen (z.B. Böhm-Bawerk).
Wie wird der Unternehmergewinn in Schumpeters Theorie erklärt?
Schumpeter erklärt den Unternehmergewinn als temporären Kostenüberschuss, der aus der Differenz zwischen Erlösen und Ausgaben resultiert. Dieser Überschuss entsteht durch Innovationen, die das statische Gleichgewicht der Wirtschaft stören. Innovationen können Prozessinnovationen (Verbesserung des Produktionsprozesses), Produktinnovationen, der Zugang zu neuen Märkten oder neue Organisationsstrukturen sein. Der Unternehmergewinn verschwindet, sobald die Innovationen nachgeahmt werden.
Welche Rolle spielt der Unternehmer (Entrepreneur) in Schumpeters Theorie?
Der Unternehmer ist in Schumpeters Theorie der Initiator von Innovationen. Er ist die treibende Kraft des dynamischen Wirtschaftsprozesses und der Quelle des Unternehmergewinns. Ohne den Unternehmer gäbe es keine Innovationen und folglich keinen Unternehmergewinn.
Wie erklärt Schumpeter den Kapitalzins?
Schumpeter sieht den Kapitalzins als Ergebnis des dynamischen Wirtschaftsprozesses, der durch Innovationen angetrieben wird. Im Gegensatz zu statischen Modellen, in denen der Zins gleich Null wäre, resultiert der Zins bei Schumpeter aus dem Unternehmergewinn und den damit verbundenen Innovationen. Der Text vergleicht Schumpeters Zinstheorie mit anderen Ansätzen, insbesondere mit der von Böhm-Bawerk, die den Kapitalzins auch in einer stationären Wirtschaft postuliert.
Was ist die "schöpferische Zerstörung" nach Schumpeter?
Die "schöpferische Zerstörung" ist ein zentrales Konzept in Schumpeters Theorie. Sie beschreibt den Prozess, bei dem Innovationen bestehende Strukturen und Unternehmen zerstören, aber gleichzeitig neue Möglichkeiten und Wirtschaftswachstum schaffen. Der Unternehmergewinn ist ein Ergebnis dieser schöpferischen Zerstörung.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Problemstellung, Unternehmergewinn und Mehrwert (mit Unterpunkten zum Unternehmergewinn am Beispiel der Verbesserung des Produktionsprozesses, weiteren Quellen des Unternehmergewinns und der Schaffung von Mehrwert durch neue Kombinationen), Kapitalzins (mit Unterpunkten zu konsumtivem vs. produktivem Zins und Schumpeters Leitsätzen der Zinstheorie), und eine thesenförmige Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Unternehmergewinn, Kapitalzins, Schumpeter, Innovation, schöpferische Zerstörung, dynamische Wirtschaft, stationäres Gleichgewicht, Prozessinnovation, Produktinnovation und Entrepreneur.
- Quote paper
- Franziska Prüfling (Author), 2009, Dogmengeschichte: Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135407