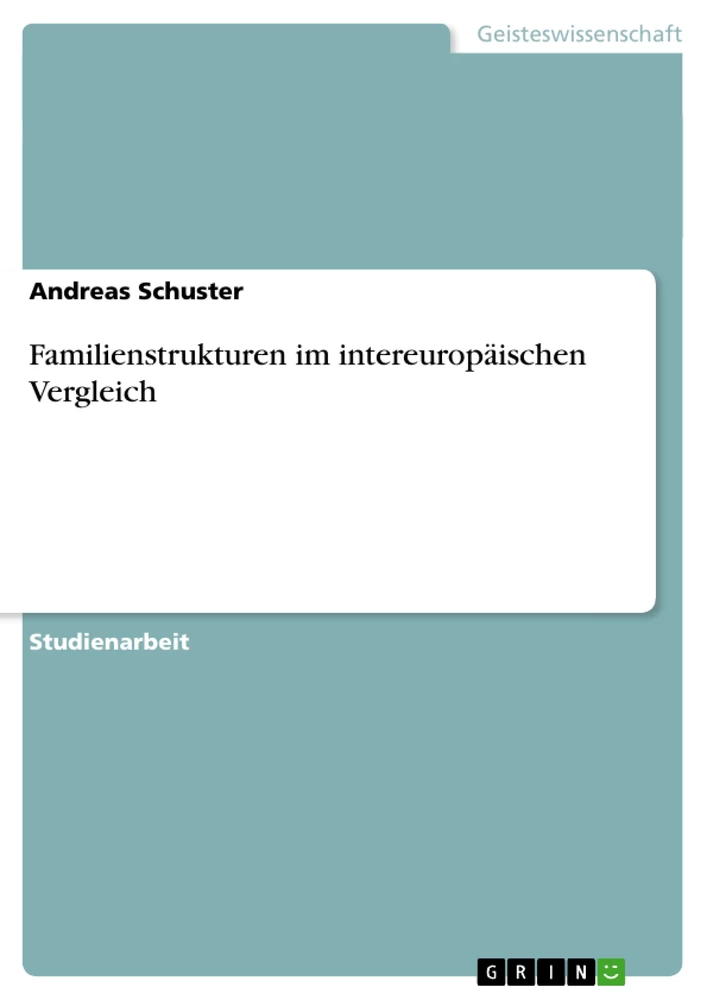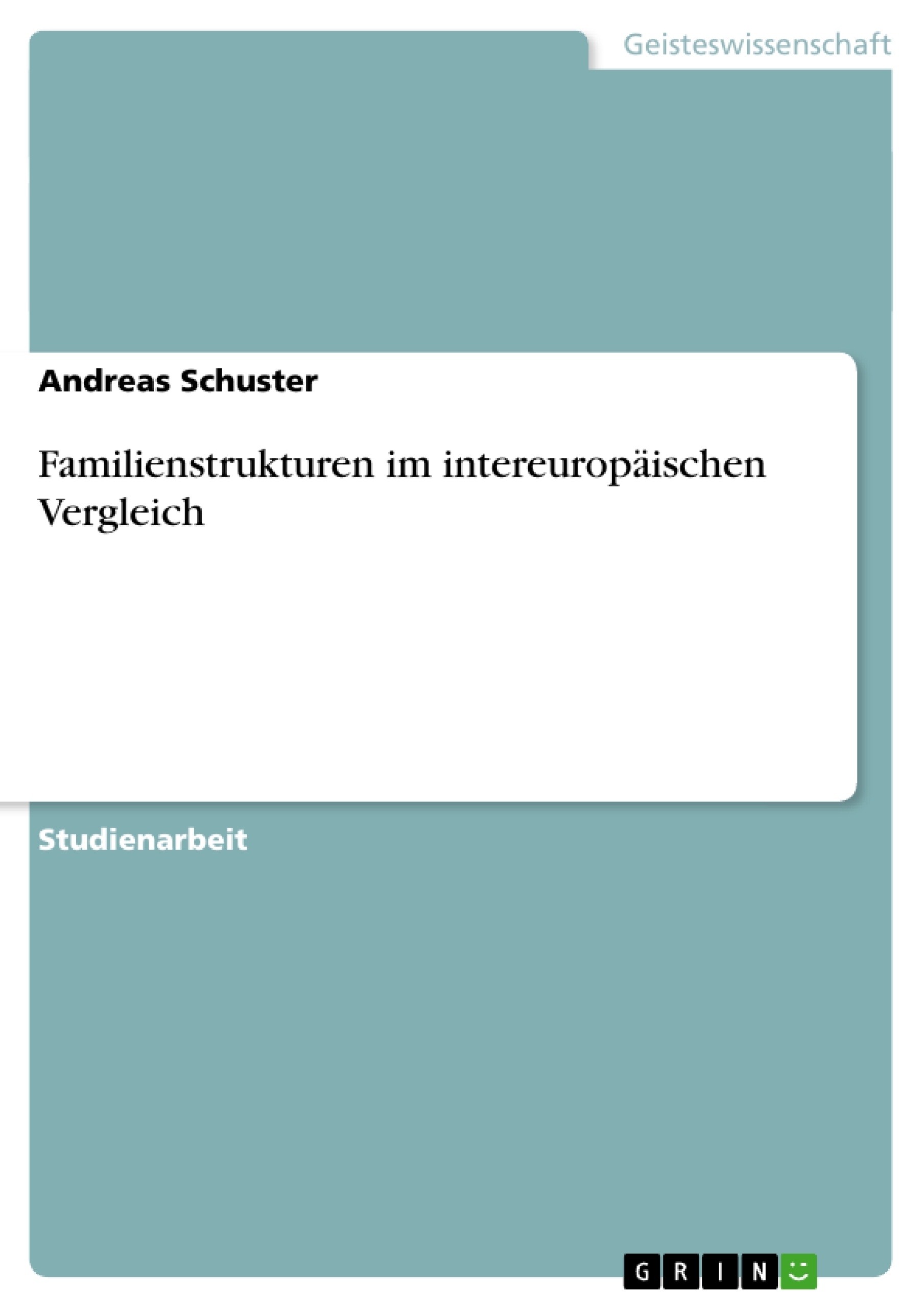n Zeiten steigender Bedeutung der europäischen Union und des immer engeren Zusammenwachsens der einzelnen Länder Europas stellt sich die Frage, ob dieses Europa innerlich einheitliche, oder noch immer zutiefst unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen aufweist.
Anhand des Textes „Haushalts- und Familienstrukturen im intereuropäischen Vergleich“ von Francois Höpflinger werde ich dieser Frage in Bezug auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Staaten in verschiedenen Teilaspekten der Familienstrukturen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen derselben nachgehen.
Wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Strukturwandel haben unbestritten zu einem Wertewandel und zu der Entwicklung eines weniger fixierten Familienbildes geführt. Der Blick auf die intereuropäischen Zusammenhänge wird nun zeigen, inwieweit dieses Phänomen einheitlich ist, und welche Variationen zwischen den einzelnen Ländern vorherrschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wandel der Haushaltsstrukturen
- Trend zur Kleinfamilie
- Trend zu Einpersonenhaushalten
- Lebensformen junger Erwachsener
- Eheschließung und Familiengründung
- Verringerung der Heiratsneigung
- Geburten außerhalb der Ehe
- teilweise erhöhte Kinderlosigkeit
- Elternschaft, Frauenerwerbstätigkeit, Kinderbetreuung
- Value of children
- Frauenerwerbstätigkeit
- Kinderbetreuung
- Familienauflösung und Pluralisierung
- Entwicklung der Scheidungshäufigkeit
- Familienformen
- Konsequenzen
- Familial verwandtschaftliche Beziehungen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Haushalts- und Familienstrukturen im intereuropäischen Vergleich“ von Francois Höpflinger untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Familienstrukturen in europäischen Ländern. Ziel ist es, die Entwicklung des Familienbildes in den verschiedenen Staaten im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen und sozialen Strukturwandels zu beleuchten.
- Wandel der Haushaltsstrukturen: Trend zur Kleinfamilie und Einpersonenhaushalten
- Lebensformen junger Erwachsener: Verlängerte Jugend und neue Lebensformen
- Eheschließung und Familiengründung: Verringerung der Heiratsneigung, Geburten außerhalb der Ehe und Kinderlosigkeit
- Elternschaft und Frauenerwerbstätigkeit: Bedeutung von Kinderbetreuung und die Rolle der Frau in der Familie
- Familienauflösung und Pluralisierung: Scheidungshäufigkeit und verschiedene Familienformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des intereuropäischen Vergleichs von Familienstrukturen in Zeiten zunehmender europäischer Integration heraus. Das Kapitel „Wandel der Haushaltsstrukturen“ befasst sich mit dem Trend zur Kleinfamilie und dem Anstieg der Einpersonenhaushalte, wobei regionale Unterschiede aufgezeigt werden. Die Kapitel „Lebensformen junger Erwachsener“, „Eheschließung und Familiengründung“ und „Elternschaft, Frauenerwerbstätigkeit, Kinderbetreuung“ analysieren die Entwicklung der Heiratsneigung, die Veränderung des Erstheiratsalters, das Aufkommen nicht-ehelicher Lebensformen, die Rolle der Frau in der Erwerbsarbeit und die Herausforderungen der Kinderbetreuung.
Schlüsselwörter
Familienstrukturen, intereuropäischer Vergleich, Haushaltsstrukturen, Lebensformen, Eheschließung, Familiengründung, Kinderlosigkeit, Frauenerwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, Familienauflösung, Scheidung, Pluralisierung, Wertewandel, wirtschaftliche Entwicklung, sozialer Strukturwandel.
- Quote paper
- Andreas Schuster (Author), 2003, Familienstrukturen im intereuropäischen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13534