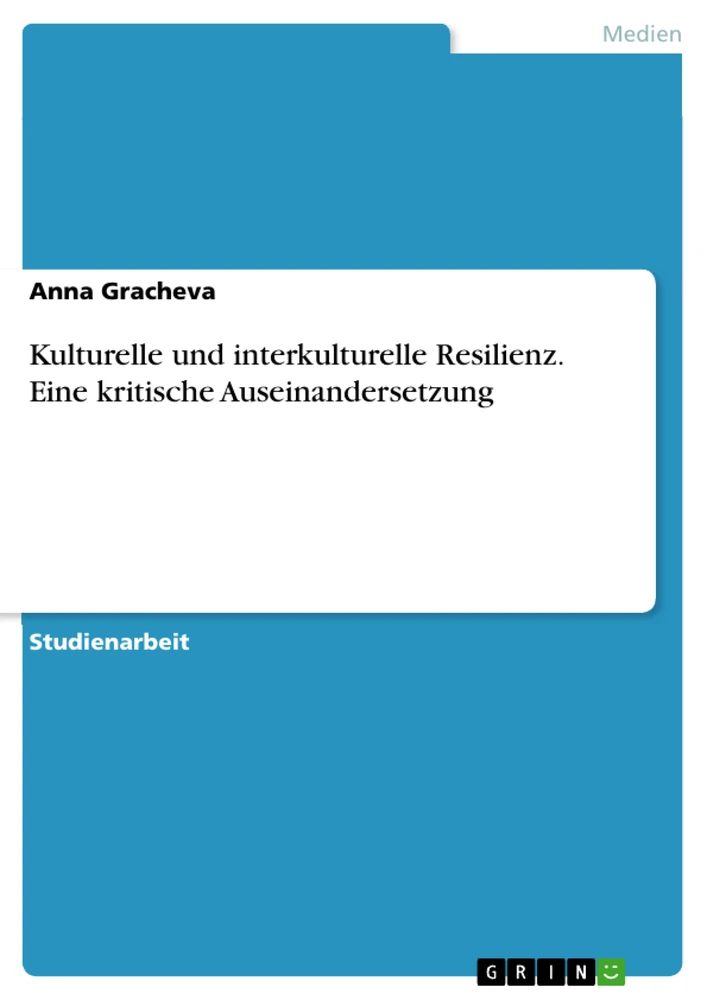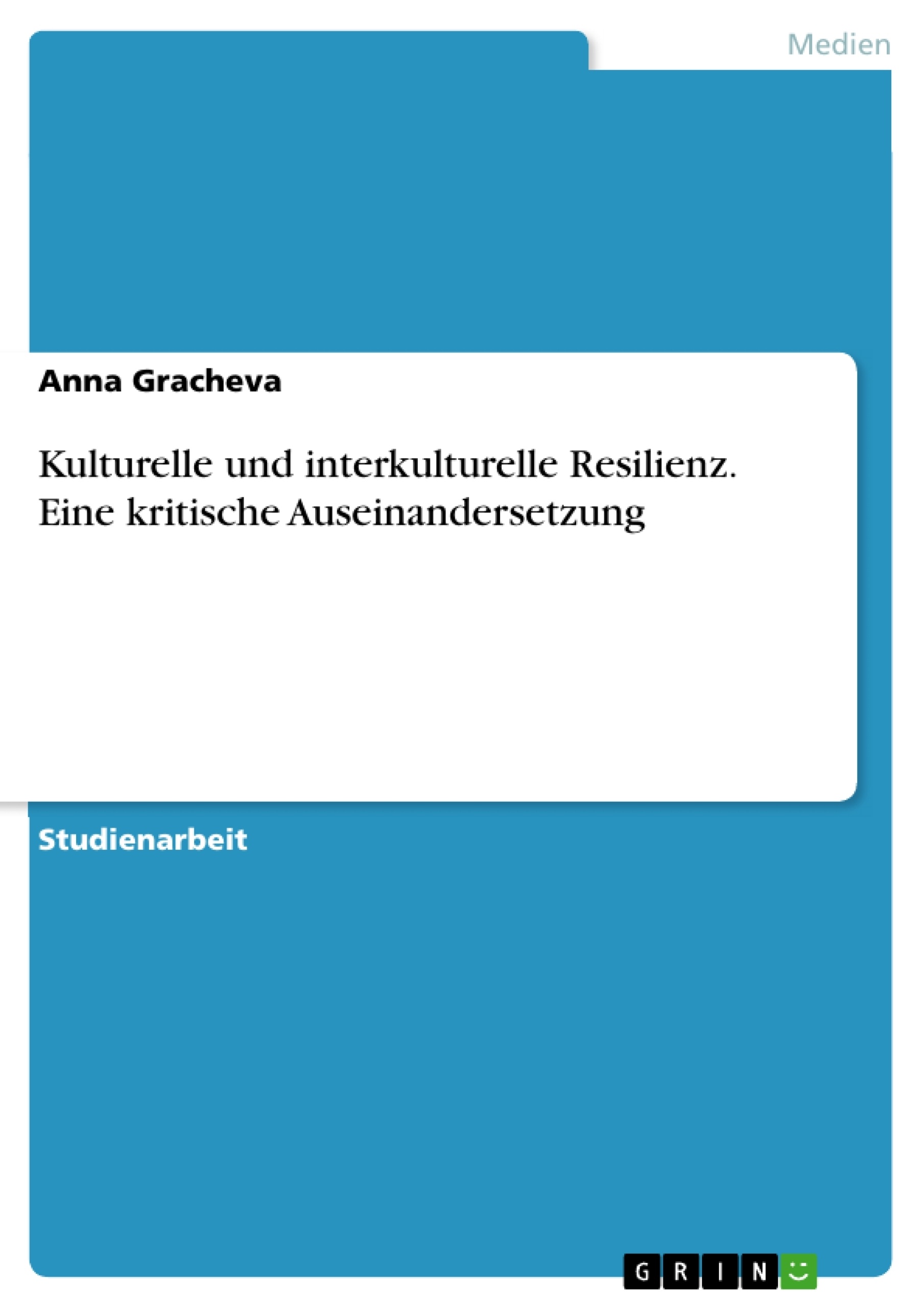Das Ziel der vorliegenden Hausarbeit besteht in einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen „Resilienz“. Besondere Bedeutung kommt dabei den Begriffen „Resilienz“, „kulturelle Resilienz“ sowie „Resilienz im interkulturellen Kontext“ zu.
Die Arbeit ist in drei Kapitel gegliedert. Im ersten Schritt wird ein Überblick über die relevanten Studien zur Resilienzforschung gegeben und die für die Entwicklung von Resilienz bedeutenden Faktoren beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird Resilienz mit Einbezug von kulturellen Aspekten betrachtet. Dabei wird auf den Kulturbegriff von Geert Hofstede sowie auf die Resilienz-Forschung von Michael Ungar gestützt. Des Weiteren wird auf Resilienz im interkulturellen Kontext eingegangen und diese diskutiert. Schlussfolgerungen aus den verschiedenen Punkten runden die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsziel.
- 1. Resilienz.
- 1.1. Resilienz als Forschungsphänomen.
- 1.2. Resilienz in der Populärwissenschaft.
- 2. Kulturelle Resilienz.
- 2.1. Kulturbegriff nach Geert Hofstede.
- 2.2. Resilienzforschung von Michael Ungar.
- 3. Resilienz im interkulturellen Kontext.
- 3.1. Interkulturelle Adaptation.
- 3.2. Kulturerlernen und Kulturverlernen.
- 4. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich kritisch mit dem Phänomen der Resilienz und untersucht insbesondere die Bedeutung der Begriffe "Resilienz", "kulturelle Resilienz" und "Resilienz im interkulturellen Kontext".
- Analyse der Resilienzforschung und ihrer Kernaussagen.
- Einbezug des Kulturbegriffs von Geert Hofstede zur Betrachtung kultureller Einflussfaktoren auf Resilienz.
- Diskussion der Resilienz im interkulturellen Kontext und der damit verbundenen Herausforderungen.
- Bewertung der wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Resilienzkonzept.
- Identifizierung von Forschungslücken und zukünftigen Forschungsbedarfen im Bereich der interkulturellen Resilienz.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Resilienz.
Das Kapitel bietet einen Überblick über die wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Debatte um das Konzept der Resilienz. Es beleuchtet die Entstehung des Begriffs in der Forschung und die Erweiterung seiner Anwendung auf verschiedene Lebensbereiche.
2. Kulturelle Resilienz.
Dieses Kapitel geht der Frage nach, inwieweit Resilienz von kulturellen Faktoren beeinflusst wird. Es werden die kulturellen Werte nach Geert Hofstede sowie die Resilienzforschung von Michael Ungar vorgestellt, um die Bedeutung kultureller Einflüsse auf Resilienz aufzuzeigen.
3. Resilienz im interkulturellen Kontext.
Im dritten Kapitel wird Resilienz im interkulturellen Kontext betrachtet, insbesondere im Zusammenhang mit Migrationsprozessen. Es werden Anpassungsfaktoren und Bewältigungsstrategien im interkulturellen Kontext erläutert, sowie die Forschungslandschaft im Bereich der interkulturellen Resilienz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Resilienz, Kulturelle Resilienz, Interkulturelle Resilienz, Kulturbegriff, Geert Hofstede, Michael Ungar, Interkulturelle Adaptation, Kulturerlernen, Kulturverlernen, Populärwissenschaft, Forschungslücken, Ethnozentrismus.
- Quote paper
- Anna Gracheva (Author), 2020, Kulturelle und interkulturelle Resilienz. Eine kritische Auseinandersetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1353355