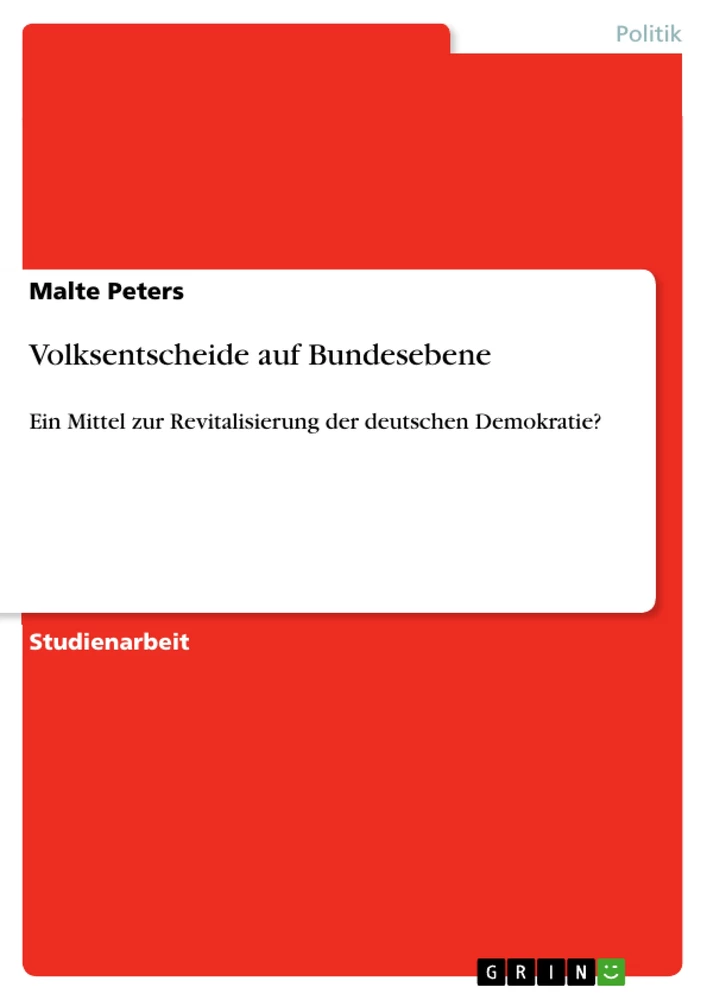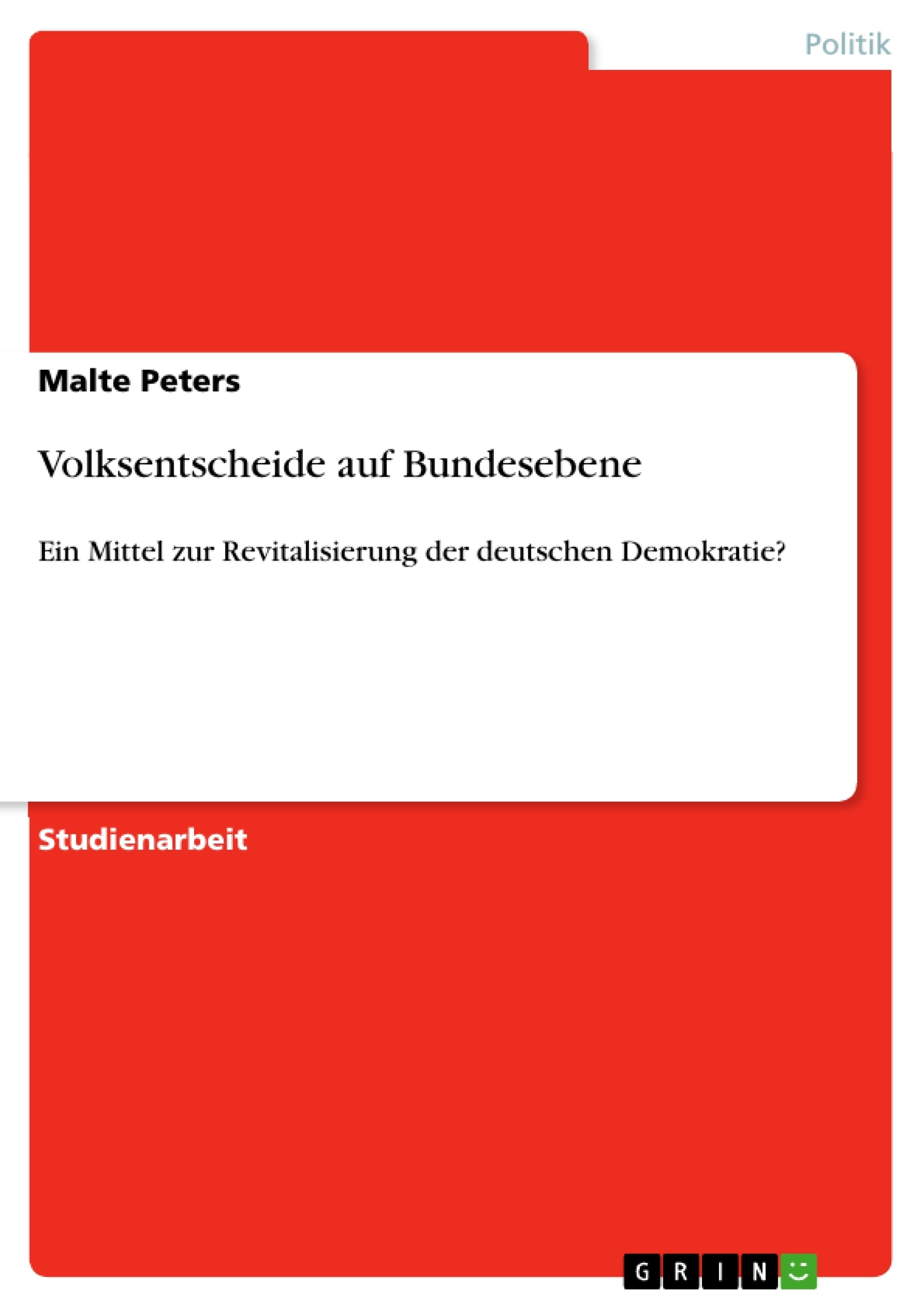Am 19. September 2004, nur wenige Wochen bevor die Welt den 60. Jah-restag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee feiert, ziehen DVU und NPD in die Landtage Brandenburgs und Sachsens ein. Die NPD erreicht in Sachsen einen Stimmenanteil von 9,2 Prozent und liegt damit nur knapp hinter der SPD, die mit 9,8 Prozent das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unabhängig von den gegenwärtig diskutierten Fragen, ob ein neuerliches Verbotsverfahren gegen die NPD erfolgversprechend ist, und ob die Wirtschaftspolitik der Regierung Schröder für den Aufschwung der Rechtsradikalen verantwortlich zeichnet, weisen die Wahlerfolge von DVU und NPD eindeutig auf ein schwer-wiegendes Problem hin: Eine beträchtliche Anzahl Bürger bzw. Wähler ist mit der staatlichen Verfasstheit Deutschlands derart unzufrieden, dass sie für Parteien stimmen, die die bestehende demokratische Ordnung kategorisch ablehnen und ihre Zerschlagung anstreben. Eine wachsende Unzufriedenheit der Bürger mani-festiert sich auch in einer kontinuierlich sinkenden Wahlbeteiligung, insbesondere bei Kommunal- und Landtagswahlen sowie Wahlen zum Europäischen Parla-ment. Zum Beispiel beteiligten sich im Jahr 2004 nur 43 Prozent am Urnengang zum Europaparlament, während es 1994 noch stolze 60 Prozent waren (vgl. www.destatis.de). Zahlreiche Umfrageergebnisse lassen ebenfalls eine steigende Unzufriedenheit der Bürger mit dem politischen System der Bundesrepublik er-kennen. So glaubt etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland nicht daran, dass die Demokratie dazu in der Lage ist, die zentralen nationalen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen (vgl. Pazelt 2001: 9).
Im Hinblick auf die geschilderte Problematik zeichnen sich sowohl der wis-senschaftliche als auch der öffentliche Diskurs durch zahlreiche verschiedene Reformvorschläge aus. Beispiele hierfür sind die jüngst gescheiterte Föderalis-muskommission, die Forderung nach mehr Transparenz der Nebeneinkünfte von Abgeordneten und die bereits angesprochenen, parteiübergreifenden Überlegun-gen bezüglich eines neuen Verbotsverfahrens gegen die NPD. Im Mittelpunkt der vorliegenden Hausarbeit soll jedoch ein anderer Vorschlag stehen: die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Zum einen dreht sich ein Großteil der Reformdiskussion seit langem um die Idee, direktdemokratische Elemente zu stärken. Zum anderen gewinnt diese Frage vor dem Hintergrund zahlreicher Volksabstimmungen über die Annahme der Europäischen Verfassung...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen: Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid
- Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in Deutschland
- Kommunale Ebene
- Landesebene
- Bundesebene
- Zur Einführung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene: Für und Wider
- Ablehnende Stimmen
- Befürwortende Stimmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene in Deutschland. Sie analysiert die Notwendigkeit solcher direktdemokratischer Elemente im Kontext sinkender Wahlbeteiligung und wachsender Unzufriedenheit mit dem politischen System. Die Arbeit bewertet sowohl die allgemeine Bedeutung von Volksabstimmungen als auch den konkreten Vorschlag der rot-grünen Koalition.
- Definition und Abgrenzung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid
- Analyse der bestehenden direktdemokratischen Instrumente auf kommunaler, Landes- und Bundesebene
- Bewertung der Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene
- Beurteilung des demokratischen Nutzens plebiszitärer Elemente
- Bewertung des Gesetzesentwurfs der rot-grünen Koalition
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund des Erstarkens rechtsextremer Parteien und sinkender Wahlbeteiligung in Deutschland. Sie argumentiert, dass eine zunehmende Unzufriedenheit der Bürger mit dem politischen System besteht und nennt die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene als einen möglichen Lösungsansatz. Die Arbeit formuliert zwei zentrale Forschungsfragen: die allgemeine Bewertung direktdemokratischer Instrumente auf nationaler Ebene und die Bewertung des Vorschlags der rot-grünen Koalition zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auf Bundesebene.
Begriffsbestimmungen: Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid: Dieses Kapitel definiert die drei zentralen Begriffe „Volksinitiative“, „Volksbegehren“ und „Volksentscheid“, wobei der Grad an tatsächlicher Entscheidungsgewalt der Bürger im Mittelpunkt steht. Es erläutert die Unterschiede zwischen diesen Instrumenten, beginnend mit der Volksinitiative als einem Vorschlagsrecht der Wählerschaft, über das Volksbegehren als weiterführendes Mittel bei Misserfolg der Volksinitiative, bis hin zum Volksentscheid als entscheidende Abstimmung des Volkes bei wiederholtem Scheitern im Parlament. Die Definitionen basieren maßgeblich auf der Arbeit von Guido Sampels.
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Verbreitung und Institutionalisierung direktdemokratischer Elemente auf kommunaler, Landes- und Bundesebene in Deutschland. Es analysiert den jeweiligen Umfang und die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Instrumente auf den verschiedenen Regierungsebenen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Ebenen und den Unterschiede in der Umsetzung direktdemokratischer Prinzipien.
Zur Einführung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene: Für und Wider: Dieses Kapitel präsentiert die Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Es analysiert sowohl die Befürwortungen, die auf die Stärkung der direkten Demokratie und die Steigerung der Legitimität politischer Entscheidungen abzielen, als auch die ablehnenden Positionen, die mögliche Nachteile wie Entscheidungsfindung durch emotionalisierte Mehrheiten und die Überforderung des Bürgers betonen. Die Gegenüberstellung ermöglicht eine umfassende Bewertung der Vor- und Nachteile dieser Reformmaßnahme.
Schlüsselwörter
Volksentscheid, Volksinitiative, Volksbegehren, direkte Demokratie, plebiszitäre Elemente, Bundesebene, Deutschland, politische Partizipation, Demokratiedefizit, Rechtsradikalismus, Wahlbeteiligung, rot-grüne Koalition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Volksentscheide auf Bundesebene in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene in Deutschland. Sie analysiert die Notwendigkeit direktdemokratischer Elemente angesichts sinkender Wahlbeteiligung und wachsender Unzufriedenheit mit dem politischen System. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bewertung des Vorschlags der rot-grünen Koalition.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. Sie analysiert die bestehenden direktdemokratischen Instrumente auf kommunaler, Landes- und Bundesebene und bewertet die Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Der demokratische Nutzen plebiszitärer Elemente und eine Beurteilung des Gesetzesentwurfs der rot-grünen Koalition werden ebenfalls untersucht.
Wie sind Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid definiert?
Die Hausarbeit definiert die drei Begriffe und betont den Unterschied im Grad der Entscheidungsgewalt der Bürger. Die Volksinitiative ist ein Vorschlagsrecht, das Volksbegehren ein weiterführendes Mittel bei Misserfolg der Initiative, und der Volksentscheid die entscheidende Abstimmung bei wiederholtem Scheitern im Parlament. Die Definitionen basieren auf der Arbeit von Guido Sampels.
Wie verbreitet sind direktdemokratische Elemente in Deutschland?
Die Hausarbeit untersucht die Verbreitung und Institutionalisierung direktdemokratischer Elemente auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, analysiert den Umfang und die rechtlichen Rahmenbedingungen und vergleicht die verschiedenen Ebenen und Unterschiede in der Umsetzung direktdemokratischer Prinzipien.
Welche Argumente sprechen für und gegen Volksentscheide auf Bundesebene?
Die Arbeit präsentiert Argumente für (Stärkung der direkten Demokratie, Steigerung der Legitimität) und gegen (Entscheidungsfindung durch emotionalisierte Mehrheiten, Überforderung des Bürgers) die Einführung von Volksentscheiden. Eine Gegenüberstellung ermöglicht die Bewertung der Vor- und Nachteile.
Welche Rolle spielt der Kontext von Rechtsextremismus und sinkender Wahlbeteiligung?
Die Einleitung der Arbeit beschreibt den Kontext von Erstarken rechtsextremer Parteien und sinkender Wahlbeteiligung in Deutschland. Sie argumentiert für eine zunehmende Unzufriedenheit der Bürger und nennt die Einführung von Volksentscheiden als möglichen Lösungsansatz.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit formuliert zwei zentrale Forschungsfragen: die allgemeine Bewertung direktdemokratischer Instrumente auf nationaler Ebene und die Bewertung des Vorschlags der rot-grünen Koalition zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auf Bundesebene.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Volksentscheid, Volksinitiative, Volksbegehren, direkte Demokratie, plebiszitäre Elemente, Bundesebene, Deutschland, politische Partizipation, Demokratiedefizit, Rechtsradikalismus, Wahlbeteiligung, rot-grüne Koalition.
- Quote paper
- Malte Peters (Author), 2005, Volksentscheide auf Bundesebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135328