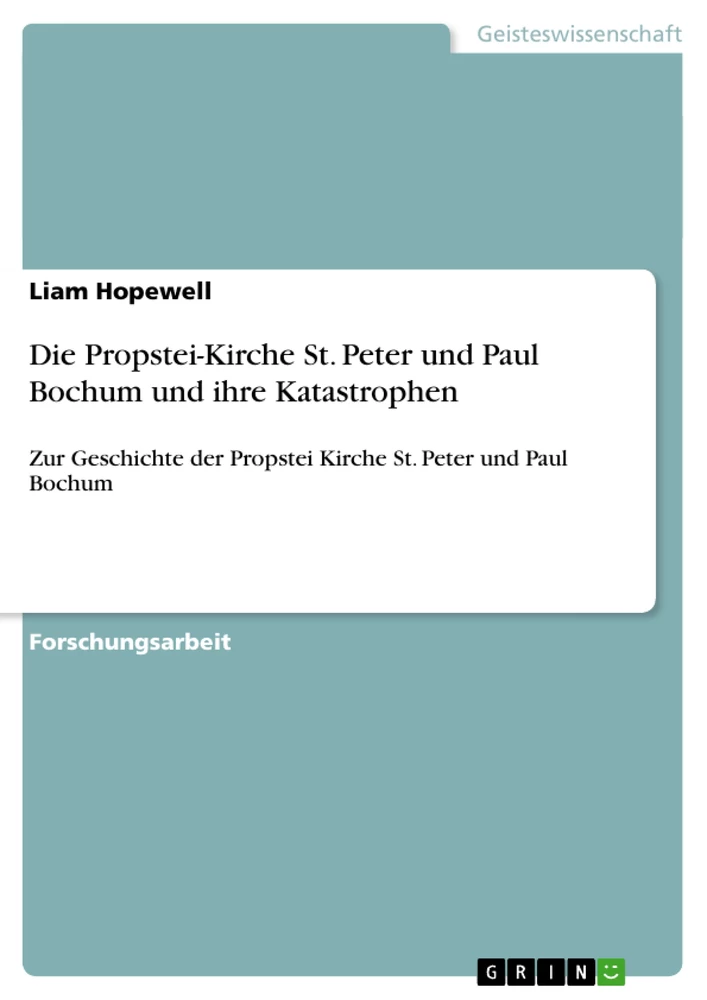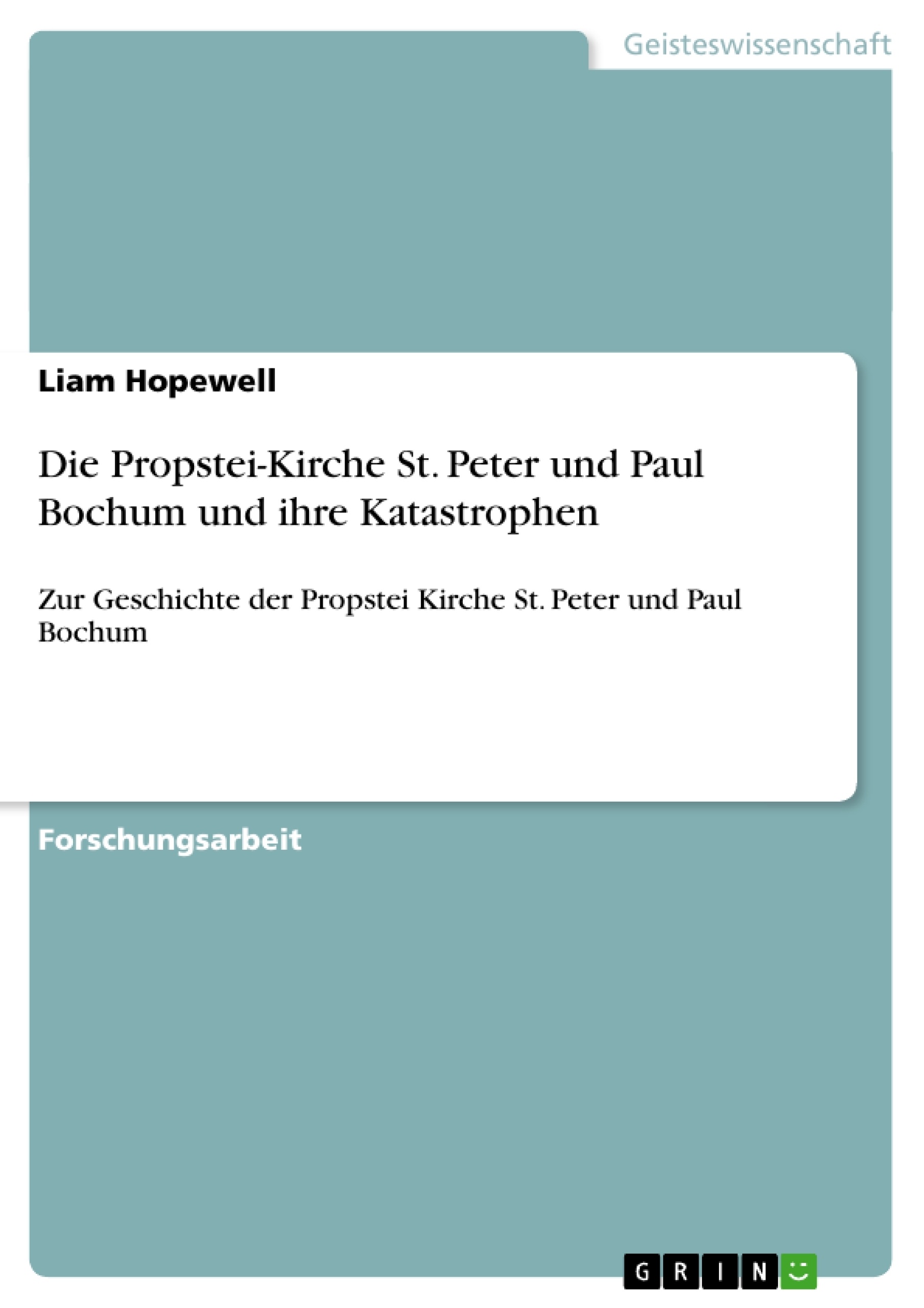Bisher wurde erstaunlich wenig Forschungsarbeit gegenüber der Propstei-Kirche St. Peter und Paul Bochum geleistet. Die meisten Untersuchungen verbleiben bei einer für die Kirche selbst sehr oberflächlichen Betrachtung. Dabei bietet die Geschichte dieser Kirche, welche ihre Gründung stolz auf Karl den Großen zurückführen kann, unglaublich viele Ansatzpunkte für eine detaillierte Untersuchung. Drei große Katastrophen sollen exemplarisch für dieses Feld einmal vorgestellt werden und die Geschichte der Propstei-Kirche Bochum neu beleuchten.
Einleitung
Der Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul Bochum kann man sich auf den verschiedensten Wegen nähern. Immerhin ist sie eine Pfarrei mit einer Geschichte, die weit in die Vergangenheit reicht und ihre Gründung stolz auf Karl den Großen zurückführen kann. Und sicherlich wird man dieser Pfarrei nicht gerecht werden können, wenn man nur einen Aspekt herausgreift und darstellt. Dennoch gilt es genau diesen Versuch zu unternehmen.
Führt man in einem ersten Schritt eine Literaturrecherche durch, um eine genaue Übersicht der bisher erarbeiteten Thematik zu gewinnen, verwundert es ein wenig, dass das Interesse an dieser Pfarrgemeinde im Speziellen sehr gering gewesen sein muss. Die häufigsten Darstellungen sind vor allem an allgemeinen Aussagen der Pfarrei interessiert und beleuchten ihr Dasein von globalen historischen Aspekten aus. So gibt es zum Beispiel Untersuchungen zum Verhalten der Katholiken in Bochum zur Zeit des Kulturkampfes oder aber Studien zur konfessionellen Ausprägung der Bürger. Andere Arbeiten befassen sich schließlich mit der allgemeinen Kirchengeschichte und berichten von den Geschehnissen in grober chronologischer Abfolge, ohne großartige Verknüpfungen herzustellen oder Rückfragen zu stellen. Nur selten werden ganz spezielle und persönliche Aspekte dieser Pfarrgemeinde angesprochen und dargestellt. Alle Publikationen zusammen ergeben so jedoch ein sehr genaues Bild von der Geschichte der Pfarrei und dem Leben in ihr.
Die vorliegende Untersuchung möchte es sich so nun zum Ziel machen, die bereits differenziert ausgearbeiteten Ergebnisse zur Geschichte und Entwicklung, weiter zu vertiefen, in dem sie einen Aspekt der Geschichte dieser Pfarrgemeinde thematisiert, der in der Literatur meist nur beiläufig als simples Faktum wiedergegeben wird, jedoch der Bedeutung für die Pfarrgemeinde an sich in keinster Weise gerecht wird – dem Verlust der Kirche.
Die Katholiken Bochums kennen dabei gleich drei schwerwiegende Ereignisse in ihrer Geschichte, durch die sie die von Karl dem Großen gegründete Propstei-Kirche St. Peter und Paul verloren und plötzlich ohne ein Gotteshaus da standen und mit diesem Umstand fertig werden mussten. Alle drei sollen hier betrachtet werden, während vor allem das Augenmerk auf den Kirchbrand von 1920 gelegt werden soll, da hieran sehr gut gezeigt werden kann, wie die Reaktionen auf den Brand waren und welche Bedeutung die Kirche für die Menschen Bochums hatte.
Generell möchte diese Untersuchung so also den Fragen nachgehen: Welche Ereignisse – oder besser gesagt Katastrophen – führten zum Verlust der Kirche? Welche Bedeutung hatte dies für die Katholiken in Bochum? Und darauf aufbauend: welche Bedeutung hatte die Propstei-Kirche St. Peter und Paul somit ganz allgemein für die Bochumer Katholiken bzw. Bürger der Stadt? Diese Abhandlung möchte somit schlussendlich jenes Kapitel in der Geschichte der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul näher beleuchten, in denen das Gemeindeleben durch den Verlust der Kirche stark getroffen wurde.
Die Quellen dieser Untersuchung bilden in erster Linie Zeitzeugen-Berichte, welche in den Beständen des Stadtarchivs ausfindig gemacht werden konnten, sowie Wiedergaben in der Sekundärliteratur, welche auf Recherchen im Kirchenarchiv beruhen. Die Arbeit selbst kann dabei am Ende dennoch nur in Teilen ein Bild der damaligen Situation zeichnen, da das vorliegende Material trotz alle dem nicht sehr umfangreich ist. Sie beansprucht entsprechend nicht eine vollständige Darstellung zu sein, setzt sich aber zum Ziel, die Situation dennoch stichhaltig und nachvollziehbar aufzuzeigen.
Der große Stadt-Brand von 1517
a. Grund und Ausmaß der Katastrophe
Es war wohl der verheerendste Brand, den die Stadt Bochum jemals erlebt hat. Im Jahre 1517 brannte ganz Bochum nieder. Auch die Kirche St. Peter wurde nicht von den Flammen verschont. In der Kirchenzeitung der Nachkriegszeit Bochums „Kirche und Heimat“ erschienen so Archivaufzeichnungen, die die Ergebnisse sehr bildlich wiedergeben. Es heißt dort: „Am Freitag vor dem 1. Mai 1517 kletterte der Rote Hahn über das Dach der ehrwürdigen Kirche hinweg, den Turm hinauf und spie seine feurigen Zungen über die Stadt. Die ganze Stadt war ein einziges Feuermeer, über dem die Kirche wie eine riesige rote Fackel leuchtete.“1
Bestätigt wird diese Aussage durch Funde im Dortmunder Stadtarchiv, wo sich zum Brand die folgende Notiz findet: „Dis jahrs am avende Marci brante Bouchum rein uet mit der Kerken.“2
Festzuhalten bleibt so erst einmal, dass Bochum Anfang Mai 1517 alles verloren hatte und scheinbar völlig vernichtet wurde3 – unter anderem auch die Kirche mit ihrer stolzen Tradition. Sie ging nicht nur in ihrer Gründung auf Karl den Großen zurück4 und war auf diese Weise zu einer sehr wichtigen Missionskirche im Gebiet geworden5, sondern war seit nun fast einem Jahrhundert auch zu einer Wallfahrts-Kirche erhoben worden.6
Es gilt also nun an dieser Stelle zu fragen, wie es zu diesem verheerenden Brand überhaupt kommen konnte. Leider sind die Unterlagen nur sehr schwer einsehbar gewesen bzw. konnte nicht viel in Erfahrung gebracht werden. Als informativ stellte sich jedoch die Arbeit des Heimatforschers Franz Darpe heraus, der um 1900 herum eine Geschichte der Stadt Bochum veröffentlichte und nicht nur die weiter unten wiedergebende Brandursache beschrieb, sondern auch herausstellte, welchen Verlust die Stadt erlitten hatte, wie die Bevölkerung selbst jahrelang an den Folgen litt und wie der Aufbau der Stadt samt der Kirche wieder vorangetrieben wurde. Dies kann hier allerdings nicht näher wiedergegeben werden und so soll nur auf die Zeitungsartikel von 1920 eingegangen werden, welche als Quelle für den Brand von 1920 vorliegen, aber auch den Brand von 1517 thematisieren, dabei vor allem aber offensichtlich aus Darpes Stadtbiografie zitierten. Ergänzend wird Darpe aber auch selbst zu zitieren sein, um ein möglichst komplettes Bild der Situation zu erhalten.
Danke Franz Darpe sind so nun um 1920 die Informationen über den Brand der Stadt von 1517 allgemein bekannt gewesen. So kann man nämlich in den Zeitungsartikeln, die nach dem Kirchbrand von 1920 veröffentlicht wurden, zahlreiche Darstellungen der Ereignisse von 1517 finden und beobachten, wie jede Zeitung ihren Vergleich zu den aktuellen Geschehnissen zog.7 Durch diese gesammelten Informationen lässt sich schließlich ein ungefähres Bild von dem zeichnen, was 1517 in Bochum geschehen sein muss. Es ist wenig verwunderlich, dass der große Stadtbrand scheinbar auf Unachtsamkeit bei der Verwendung von Feuer zurückging. Es wird so in dem gesichteten Material davon berichtet, dass ein Rentmeister, sein Name soll Schriver gewesen sein8, wohl sehr unvorsichtig mit dem Feuer in seinem eigenen Haus umgegangen sein soll. Dabei soll sich schließlich das Haus des Rentmeisters entzündet und wenig später die ganzen Nachbarhäuser in Brand gesteckt haben. Ehe das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte muss es zu einem ungünstigen Wind gekommen sein, so dass das Feuer über die ganze Stadt getragen worden ist und schließlich alles entzündete, was brennbar war. Dazu gehörte auch die Kirche St. Peter.9
Nach dem Brand, so heißt es weiter, musste Rentmeister Schriver aus der Stadt flüchten, da die Bürger der Stadt ihn in einer Art von Lynchjustiz verfolgten. Da die Bochumer ihn nicht mehr zu Rechenschaft ziehen konnten, beschlagnahmten sie sein ganzes Hab und Gut, was in diesem Falle vor allem seinen Gutsbesitz meint. Hieraus versuchte man zumindest einen Teil des entstandenen Schadens zu bezahlen, was bei einer derartig weitflächigen Zerstörung aber nur symbolischen Charakter gehabt haben konnte.10
Der erste schwere Verlust der Kirche, so ist nun abschließend zur Brand-Ursache zu sagen, geht also aller Wahrscheinlichkeit nach auf menschliches Versagen zurück. Dies hatte zur Ursache, dass eine ganze Stadt abbrannte und von der wertvollen Kirche St. Peter nur noch der romanische Chor und steinerne Turmreste stehen blieben.11 Im Folgenden ist daher zu fragen, wie die Situation nach dem Brand aussah. Es musste nicht nur eine Kirche, sondern eine ganze Stadt wieder aufgebaut werden. Hatten die Bewohner Bochums überhaupt noch die Kraft auch sofort wieder eine Kirche zu erreichten, die einer Wallfahrtkirche gerecht wurde, oder galt es erst einmal wieder mit einer kleinen Kapelle anzufangen?
b. Die Gemeinde nach dem Brand
Als die Bochumer in ihre abgebrannte Stadt zurückkehrten und den Verlust von Haus und Hof wahrnahmen, wird ihnen da auch der Verlust ihrer Kirche klargewesen sein? Vielleicht sollte man aber anders fragen: wird ihnen in diesem Moment der Verlust der Kirche so wichtig gewesen sein, wie der Verlust ihres Hab und Guts?
Ein Indiz hierfür ist der Umstand, dass man erst 1518, also fast ein Jahr nach dem Brand daran ging und sich um den Wiederaufbau der Kirche kümmerte. Hier ist vor allem Adrian von Leithen (Haus Laer) zu nennen, der als Mitglied des Kirchenvorstandes den Blick wieder auf die Kirche richtete und versuchte, einen Wiederaufbau der Kirche zu ermöglichen.12 Erst 1521 war es aber wieder möglich, in einer „notdürftig hergerichteten Kirche“ Gottesdienste zu feiern.13 Was mit „notdürftig gemeint ist, ist dabei unklar. Da der romanische Chorraum aber erhalten geblieben ist, wird von hier aus wohl die Feier des Gottesdienstes wieder möglich gewesen sein.
Dennoch dürfe hieran zu erkennen sein, dass die Bochumer Einwohner erst einmal daran gegen sein dürften, ihre eigenen Häuser wieder aufzubauen und das eben die Mittel zum Neubau der Kirche fehlten. Das Fehlen der Mittel wird dabei gerade auch bei Darpe genau beschrieben. Er führt hier diverse Statistiken der Einkünfte der Pfarrei an und stellt so heraus, dass in den Jahren zwischen 1517 und 1519 fast gar keine Mittel für einen Wiederaufbau zur Verfügung standen, da es weder Einnahmen durch Spenden, Steuern noch durch Grundbesitz gab. Erst mit Spendenaufrufen weit außerhalb der Stadt konnten Mittel aufgebracht werden, die aber auch nicht ausreichten, so dass die Pfarrei sich zum Verkauf von Grundbesitz entschloss und erst jetzt ein Wiederaufbau möglich wurde.14
Wie bis 1521 Gottesdienste gefeiert wurden bleibt dabei leider unklar, fest steht aber, dass es bereits 1519 wieder eine Messfeier gegeben haben muss, das zu diesem Zeitpunkt eine Abendmahlsteuer eingeführt wurde, um den Wiederaufbau zu finanzieren.15
[...]
1 So zu finden bei Kühne, Peter / Grotenhermen, Klaus: Die Propsteikirche Sankt Peter und Paul Bochum. Geschichte von Karl d. Gr. Bis zur Gegenwart, Bochum 1994, S. 13f. [im Folgenden zitiert als Kühne/Grotenhermen: Propsteikirche]
2 Wird entsprechend in der Festschrift des Hauses Laer zum 650jährigen Bochumer Stadtjubiläums von 1971 wiedergegeben, vgl. Eriemeier, Hans/Fernkorn, Paul/Frielinghaus, Volker: Die Bochumer Propsteikirche und ihre Kunstschätze. 1000 Jahre Kultur im mittleren Ruhrrevier, in: Schriftreihen des Archivs Haus Laer in Bochum, Bochum 1971, S. 13. [im Folgenden zitiert als Eriemeier u.a.: Künstschätze]
3 So spricht Franz Darpe davon, dass die Bochumer alles verloren hätten – auch ihren beweglichen Besitz – und am Ende der Verlust so grol3 gewesen sei, dass der Wiederaufbau der Stadt fast zwei Jahrzehnte gedauert hat, die Bochumer während dieser Zeit aber in grol3er Armut lebten, da sie nicht nur alles verloren hatten, sondern auch noch durch die Kosten des Wiederaufbaus hoch verschuldet gewesen seien, vgl. Darpe, Franz: Geschichte der Stadt Bochum, Band 1, Nachdruck der Originalausgabe von 1894, Bochum 1991, S. 119f. [im Folgenden zitiert als Darpe: Bochum]
4 Eriemeier, u.a.: Kunstschätze, S. 11, als auch
Kühne/Grotenhermen: Propsteikriche, S. 3f.
5 Ebd.
6 Ernennung zur Wallfahrts-Kirche 1415 durch Papst Johannes XXIII, also einem jener Päpste, die nach dem Schisma von 1378 zu Gegenpäpsten gewählt wurden, vgl. Kühne/Grotenhermen: Propsteikirche, S. 11.
7 So etwa bei einem Artikel der Rheinisch Westfälischen Zeitung, vom 24. September 1929, vgl. Stadtarchiv Bochum, B51 / 13. Diese Artikel bauen zu großen Teilen vor allem aber auf den Informationen aus Darpes Stadtbiografie auf, was wenig verwunderlich sein dürfte, erschien die Biografie gerade einmal 20 Jahre vor dem Brand.
8 Darpe konkretisiert diesen Fall, indem er berichtet, dass ein Johann Schriver für den Brand verantwortlich gewesen sein soll, da er in seinem Haus durch Unachtsamkeit das Feuer entfacht haben soll, welches ganz Bochum niederbrannte. Schriver musste fliehen und wurde schließlich herzöglicher Rentmeister in Blankenstein, vgl. Darpe: Bochum, S. 119f.
9 Bei Darpe: Bochum, S. 119, als auch entsprechend in Stadtarchiv Bochum, B51 / 22.
10 Darpe: Bochum, S. 119f.
11 Kühne/Grotenhermen: Propsteikriche, S. 14, als auch B 51 / 22, ebenso zum Erhalt des Chors, Eriemeier: Kunstschätze, S. 19, hier erfolgt auch der Hinweis, dass der Chor 1872/74 abgebrochen wurde, um an dieser Stelle die Kirche zu weitern.
12 Eriemeier, u.a.: Kunstschätze, S. 17, als auch Kühne/Grotenhermen: Propsteikirche, S. 14.
13 Ebd.
14 Darpe: Bochum, S. 120 – 124. Darpe erzählt hier zudem, dass ab 1519 eine neue Steuer erlassen wurde. So musste jeder Erwachsene eine Abendmahlsteuer entrichten.
15 Ebd.
- Quote paper
- Liam Hopewell (Author), 2009, Die Propstei-Kirche St. Peter und Paul Bochum und ihre Katastrophen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135321