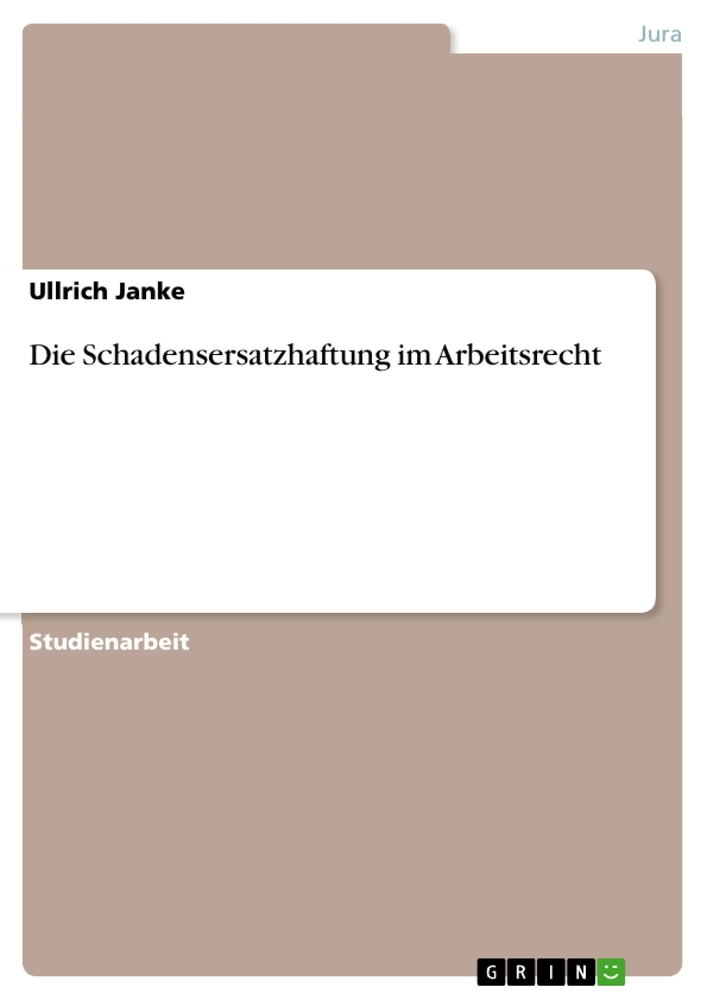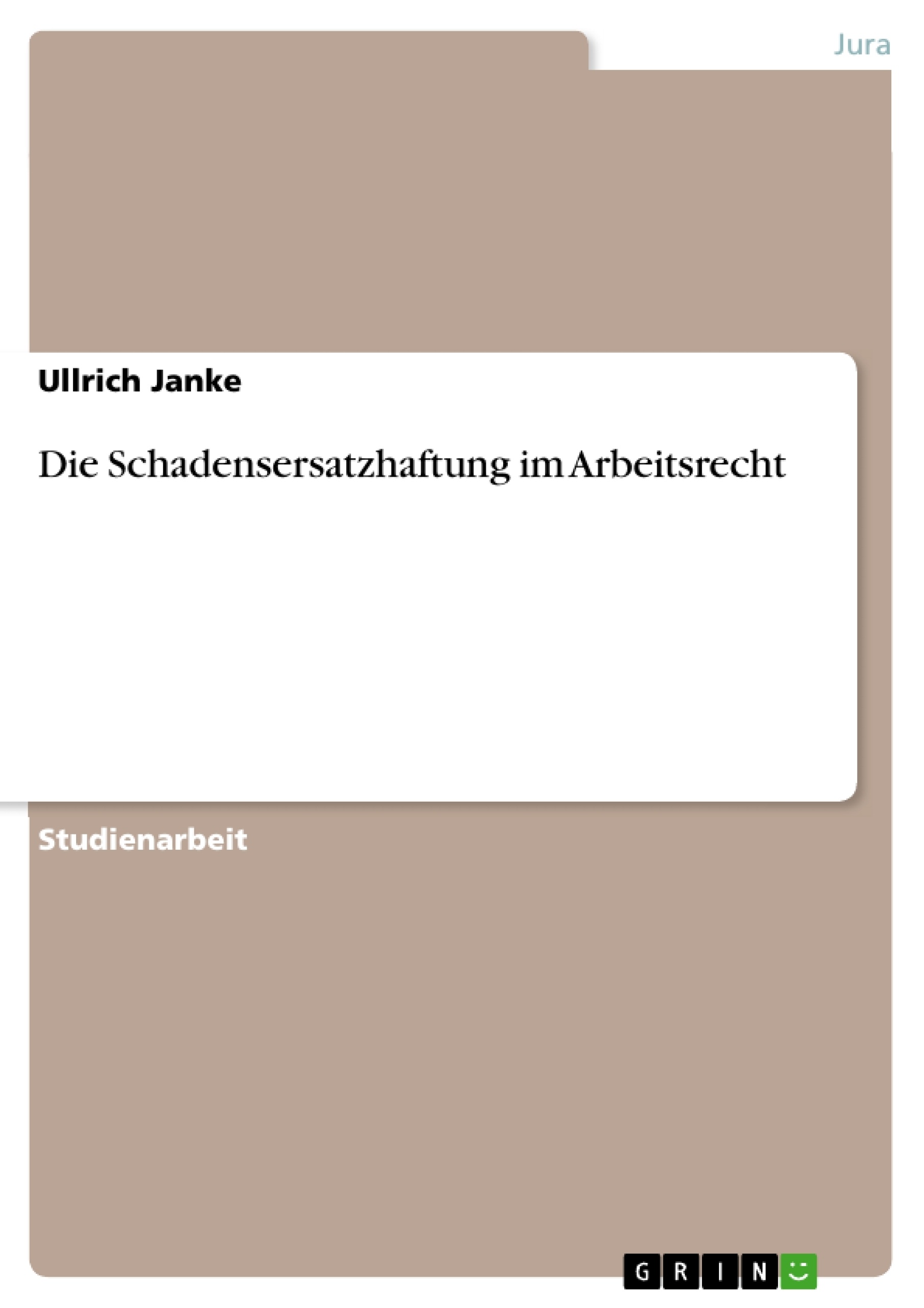Das in § 249 BGB verankerte Prinzip der Totalreparation besagt, dass ein zum Schadensersatz verpflichteter Schuldner prinzipiell unabhängig vom Maß des eigenen Verschuldens auf Ersatz des vollen Schadens haftet, wenn den Gläubiger kein Mitverschulden trifft. Bereits bei der Fassung des BGB im Jahr 1896 wurde aber erkannt, dass dieses Prinzip für Arbeitsverhältnisse nicht geeignet ist, weil der Arbeitnehmer einem unüberschaubaren Risiko ausgesetzt würde. Trotzdem fehlt es bis heute an einer einheitlichen spezialgesetzlichen Regelung zum Arbeitsvertragsrecht, die auch die Frage des Schadensersatzes umfasst. Auch durch den im Rahmen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes am 01.01.2002 eingefügten § 619 a BGB wurde diese Lücke nicht geschlossen, da es sich hier um eine reine Beweislastregel handelt.
Die heute über die allgemeinen Regelungen des BGB hinaus anzuwendenden Prinzipien der Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht wurden daher hauptsächlich in der Rechtsprechung entwickelt und nur zum Teil in das BGB übernommen. So hat erstmalig 1936 das Arbeitsgericht Plauen bei einem dem Arbeitgeber entstandenen Schaden geurteilt, dass nach Treu und Glauben bei nur leichter Fahrlässigkeit der Arbeitnehmer nicht auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden könne. Das Bundesarbeitsgericht hat 1957 unterschieden, ob eine Arbeit gefahrgeneigt sei und für diesen Fall die Haftung für den Arbeitnehmer auf mindestens mittlere Fahrlässigkeit eingeschränkt. Nach Vorlage durch den großen Senat des BAG und Zustimmung durch den Bundesgerichtshof wurde mit Urteil des BAG vom 27.9.1994 diese Einschränkung für jede betriebliche Tätigkeit angenommen, durch die ein Schaden verursacht wird (sog. Haftungsprivileg des Arbeitnehmers). In der vorliegenden Arbeit wird differenziert nach den unterschiedlichen Fallkonstellationen die jeweilige Haftungssituation des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers unter Berücksichtigung der letzten einschlägigen Rechtsprechung dargestellt. Der Schwerpunkt der Betrachtung soll auf der Haftung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arbeitnehmerhaftung
- Haftung gegenüber dem Arbeitgeber
- Sachschäden
- Personenschäden
- Haftung der Arbeitnehmer untereinander
- Haftung gegenüber Dritten
- Haftung gegenüber dem Arbeitgeber
- Arbeitgeberhaftung
- Haftung für Sachschäden der Arbeitnehmer
- Haftung für Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht, insbesondere die Haftung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Sie analysiert die relevanten Rechtsgrundlagen und die Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich. Der Fokus liegt auf der Klärung der Haftungsbedingungen und der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
- Haftung des Arbeitnehmers für Sachschäden
- Haftung des Arbeitnehmers für Personenschäden
- Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die von Arbeitnehmern verursacht werden
- Entwicklung der Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht
- Anwendung der allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze im Arbeitsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht ein. Sie erläutert das Prinzip der Totalreparation nach § 249 BGB und dessen eingeschränkte Anwendbarkeit auf Arbeitsverhältnisse. Es wird auf das Fehlen einer einheitlichen gesetzlichen Regelung hingewiesen und die Bedeutung der Rechtsprechung für die Entwicklung der Prinzipien der Schadensersatzhaftung hervorgehoben. Die Arbeit kündigt die differenzierte Betrachtung der Haftungssituation von Arbeitnehmer und Arbeitgeber in verschiedenen Fallkonstellationen an, wobei der Schwerpunkt auf der Haftung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber liegt. Die Einleitung verweist auf die historische Entwicklung der Rechtsprechung, beginnend mit dem Urteil des Arbeitsgerichts Plauen 1936 bis hin zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1994, das das Haftungsprivileg des Arbeitnehmers für jede betriebliche Tätigkeit festschreibt.
Arbeitnehmerhaftung: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Haftung des Arbeitnehmers. Es wird zwischen der Haftung gegenüber dem Arbeitgeber, der Haftung untereinander der Arbeitnehmer und der Haftung gegenüber Dritten unterschieden. Innerhalb der Haftung gegenüber dem Arbeitgeber werden Sach- und Personenschäden detailliert behandelt. Die jeweiligen Anspruchsgrundlagen und Rechtsfolgen werden analysiert, wobei der Schwerpunkt auf der Mankohaftung liegt. Die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den verschiedenen Haftungsformen werden herausgearbeitet und mit einschlägigen Beispielen und Urteilen belegt.
Arbeitgeberhaftung: Dieses Kapitel widmet sich der Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die von seinen Arbeitnehmern verursacht wurden. Untersucht werden die Haftung für Sachschäden und für Schäden an Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer. Es werden die rechtlichen Grundlagen und die relevanten Kriterien für die Zurechnung von Schäden zum Arbeitgeber analysiert. Die unterschiedlichen Haftungsregelungen und -ausnahmen werden detailliert erläutert, mit Fokus auf den Fallkonstellationen, in denen der Arbeitgeber für das Handeln seiner Arbeitnehmer haftet. Die Darstellung bezieht sich auf die aktuelle Rechtsprechung und die einschlägigen gesetzlichen Regelungen.
Schlüsselwörter
Schadensersatzhaftung, Arbeitsrecht, Arbeitnehmerhaftung, Arbeitgeberhaftung, Sachschaden, Personenschaden, Mankohaftung, Fahrlässigkeit, Rechtsprechung, BGB, § 249 BGB, Haftungsprivileg des Arbeitnehmers, Totalreparation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit der Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht, insbesondere der Haftung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Sie untersucht die Haftung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber, die Haftung unter Arbeitnehmern, die Haftung gegenüber Dritten sowie die Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die von seinen Arbeitnehmern verursacht wurden. Die Arbeit analysiert die relevanten Rechtsgrundlagen, die Rechtsprechung und die Anwendung der allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze im Arbeitsrecht.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert die Haftung des Arbeitnehmers für Sach- und Personenschäden, die Haftung des Arbeitgebers für Schäden durch Arbeitnehmer (Sach- und Personenschäden), die Entwicklung der Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht und die Anwendung von § 249 BGB im Arbeitsverhältnis. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Mankohaftung und dem Haftungsprivileg des Arbeitnehmers.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Arbeitnehmerhaftung (inkl. Unterkapiteln zur Haftung gegenüber dem Arbeitgeber, untereinander und gegenüber Dritten), ein Kapitel zur Arbeitgeberhaftung und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der relevanten Aspekte.
Was sind die zentralen Ziele der Seminararbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Haftungsbedingungen im Arbeitsrecht zu klären und die Verantwortlichkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber abzugrenzen. Sie untersucht die relevanten Rechtsgrundlagen und die Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Schadensersatzhaftung, Arbeitsrecht, Arbeitnehmerhaftung, Arbeitgeberhaftung, Sachschaden, Personenschaden, Mankohaftung, Fahrlässigkeit, Rechtsprechung, BGB, § 249 BGB, Haftungsprivileg des Arbeitnehmers, Totalreparation.
Wie wird die Rechtsprechung berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die aktuelle Rechtsprechung und relevante Gerichtsurteile, beginnend mit einem Urteil des Arbeitsgerichts Plauen von 1936 bis hin zu einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1994, welches das Haftungsprivileg des Arbeitnehmers für jede betriebliche Tätigkeit festschreibt. Die Arbeit veranschaulicht die Entwicklung der Rechtsprechung und ihre Auswirkungen auf die Praxis.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberhaftung?
Die Arbeit differenziert deutlich zwischen der Haftung des Arbeitnehmers (z.B. für eigene Fehler) und der Haftung des Arbeitgebers (z.B. für Fehler seiner Arbeitnehmer). Es werden die unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen, Rechtsfolgen und Ausnahmen detailliert erläutert.
Wie wird § 249 BGB in der Arbeit behandelt?
§ 249 BGB (Totalreparation) wird in der Einleitung eingeführt und seine eingeschränkte Anwendbarkeit auf Arbeitsverhältnisse erläutert. Die Arbeit zeigt auf, wie die Prinzipien der Totalreparation im Kontext des Arbeitsrechts angewendet werden und welche Besonderheiten zu beachten sind.
- Quote paper
- Ullrich Janke (Author), 2009, Die Schadensersatzhaftung im Arbeitsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135282