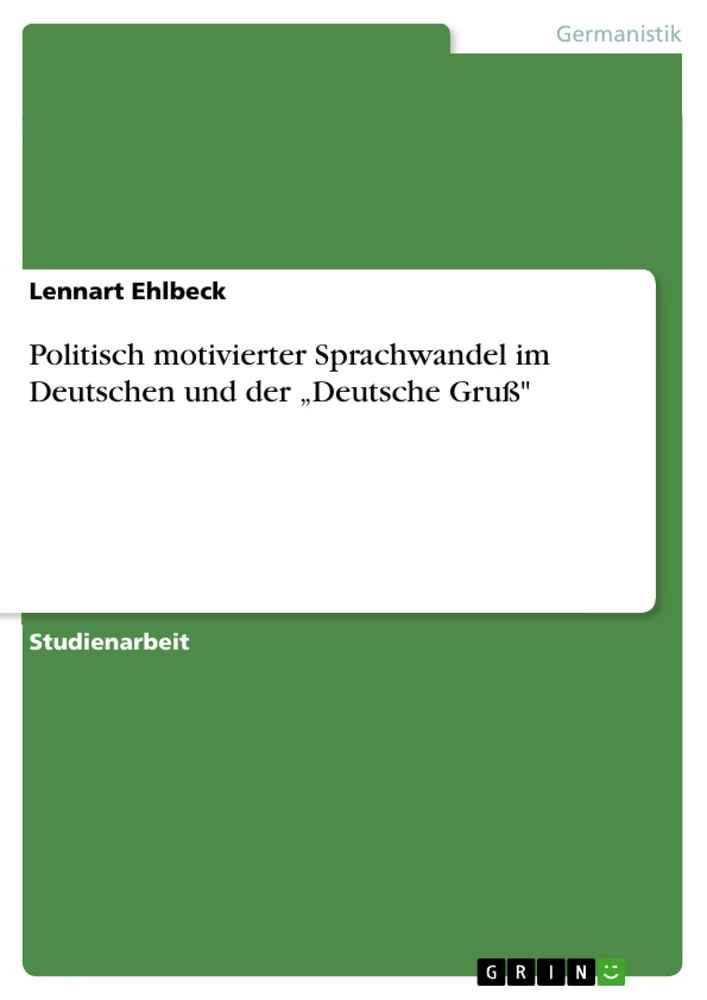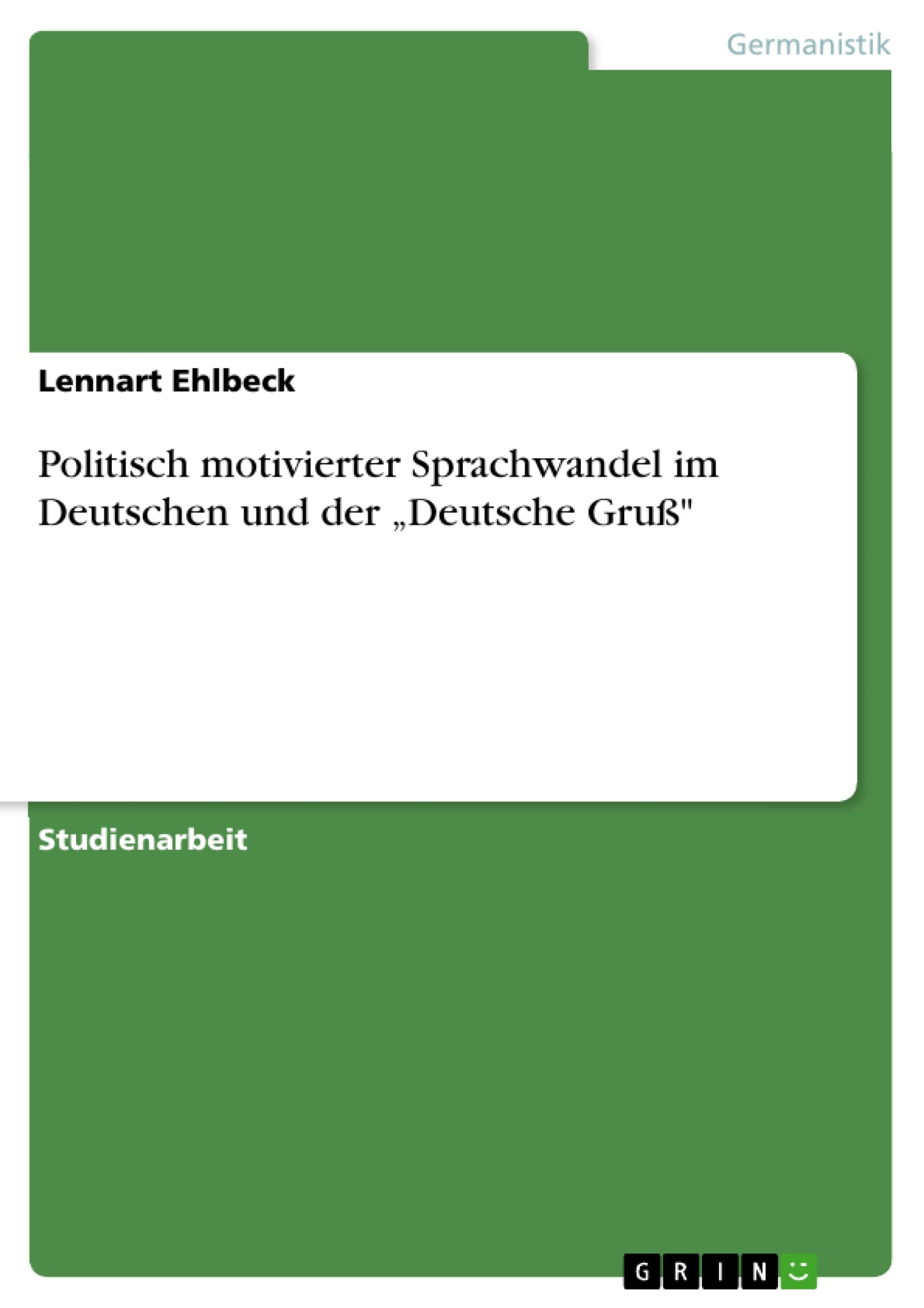Diese Arbeit untersucht den „Deutschen Gruß“ hinsichtlich dessen Herkunft und die sprachwandeltheoretischen Aspekte der Einführung 1933 und des Verbots 1945. Zur Beschreibung des Sprachwandels werden hauptsächlich Herrmann Paul und Armin Burkhardt herangezogen. Den sogenannten „Deutschen Gruß“ und ausgewählte Aspekte dessen beschreiben Tilman Allert, Rudolph Herzog und Klaas-Hinrich Ehlers näher. Der Aufbau der Arbeit richtet sich nach dem diachronen Verlauf des Grußes. Der „Deutsche Gruß“, der aus der sprachlichen Formel „Heil, Hitler“ und der Geste des auf Augenhöhe gehobenen ausgestreckten Armes mit ausgestreckter Hand zusammengesetzt ist, wird dabei nur auf der sprachlich-funktionalen Ebene betrachtet. Die Entstehung des imperialen „faschistischen Grußes“ ist für den Sprachwandel zunächst von geringerer Bedeutung, spielt jedoch in der Betrachtung des Grußes als Ganzes nach 1945 und dem Verbot nationalsozialistischer Zeichen und Gesten eine Rolle.
Die nationalsozialistischen Grüß- und Erkennungszeichen „Sieg, Heil!“, „Heil Hitler!“, und deren mittels arabischer Zahlen codierten Entsprechungen „88“ sowie „18“ – sind durch §86 StGB als verfassungsfeindliche Zeichen verboten, in der rechten Szene jedoch weit verbreitet. Während die Zahlencodes ein Ergebnis des Verbotes sind, sind die ersten beiden Ausrufe die wohl bekanntesten des NS-Regimes. Im Vergleich zu der Darstellung anderer nationalsozialistischer Zeichen und Symbole (Hakenkreuzfahne) ist die Verwendung der Grußform „Heil Hitler!“ in Filmen und ähnlichen Medien weniger umstritten, wenn auch beim sogenannten „Deutschen Gruß“ der Kontext, in dem dieser dargebracht wird, historisch kontextualisiert sein muss und nicht ideologisch begründet sein darf.
Schon an dieser Stelle zeigt sich, dass der „Deutsche Gruß“ starkem Sprachwandel unterworfen ist und dies durch die ideologische und politische Aufladung seines Begriffes auch nicht mehr verlieren wird, da immer wieder neu debattiert wird, inwieweit und in welcher Art und Weise der Gruß dargestellt werden darf oder nicht. Dabei muss in der Debatte zwischen politischer, ideologischer, soziologischer und der sprachlichen Ebene unterschieden werden. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass nicht nur nach 1945 der „Deutsche Gruß“ eng mit dem Sprachwandel verwoben ist, sondern, dass auch die Einführung des Grußes eine Form von Sprachwandel darstellt, wie zu zeigen sein wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Sprachwandel
- 3 Der Heilsbegriff
- 4 Die Funktion des Grußes
- 4.1 Grußverhalten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts
- 4.2 Der „Deutsche Gruß“ und die Nationalsozialistische Ideologie
- 5 1933: Der Wandel der Intension über die Extension
- 6 1945: Der Wandel der Extension über die Intension?
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den „Deutschen Gruß“ hinsichtlich dessen Herkunft und die sprachwandeltheoretischen Aspekte der Einführung 1933 und des Verbots 1945. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Sprachwandels durch die Analyse von Theorien von Herrmann Paul und Armin Burkhardt. Die Arbeit betrachtet den „Deutschen Gruß“ in seiner sprachlich-funktionalen Ebene und untersucht die Entstehung und Entwicklung des Grußes in einem diachronen Verlauf.
- Theoretischer Sprachwandel nach Herrmann Paul und Armin Burkhardt
- Entwicklung des Heilsbegriffes
- Soziolinguistische Aspekte des Grußens
- Einführung des „Deutschen Grußes“ als sprachliche Handlung
- Verbot des „Deutschen Grußes“ als sprachliche Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des „Deutschen Grußes“ ein und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Die Arbeit konzentriert sich auf die sprachlichen Veränderungen, die durch die Einführung und das Verbot des Grußes entstanden sind. Sie erläutert die Bedeutung des Sprachwandels und die Relevanz der Untersuchung des „Deutschen Grußes“ im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie.
- Theoretischer Sprachwandel: Dieses Kapitel präsentiert die Theorien zum Sprachwandel von Hermann Paul und Armin Burkhardt. Es werden die verschiedenen Ansätze zum Sprachwandel und deren Relevanz für die Untersuchung des „Deutschen Grußes“ erläutert.
- Der Heilsbegriff: Dieses Kapitel befasst sich mit der sprachlichen Geschichte des Heilsbegriffes. Es untersucht die Entwicklung des Begriffes im Laufe der Zeit und die Bedeutung des Heilsbegriffes für die Verwendung des Grußes „Heil Hitler!“.
- Die Funktion des Grußes: Dieses Kapitel beleuchtet die sprachliche und soziologische Bedeutung des Grußes und des Grüßens. Es analysiert die Funktion des Grußes in der Gesellschaft und die Rolle des Grußes im Kontext des Sprachwandels.
- 1933: Der Wandel der Intension über die Extension: Dieses Kapitel untersucht die Einführung des „Deutschen Grußes“ als konkrete Handlung des Sprachwandels. Es analysiert die sprachlichen Veränderungen, die durch die Einführung des Grußes entstanden sind, und die politischen und ideologischen Hintergründe der Einführung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit untersucht den Sprachwandel am Beispiel des „Deutschen Grußes“ im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie. Die Schlüsselbegriffe sind: Sprachwandel, „Deutscher Gruß“, „Heil Hitler!“, Heilsbegriff, Intension, Extension, ideologiebedingter Sprachwandel, historisch-soziologischer Kontext, Herrmann Paul, Armin Burkhardt.
- Citar trabajo
- Lennart Ehlbeck (Autor), 2023, Politisch motivierter Sprachwandel im Deutschen und der „Deutsche Gruß", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351818