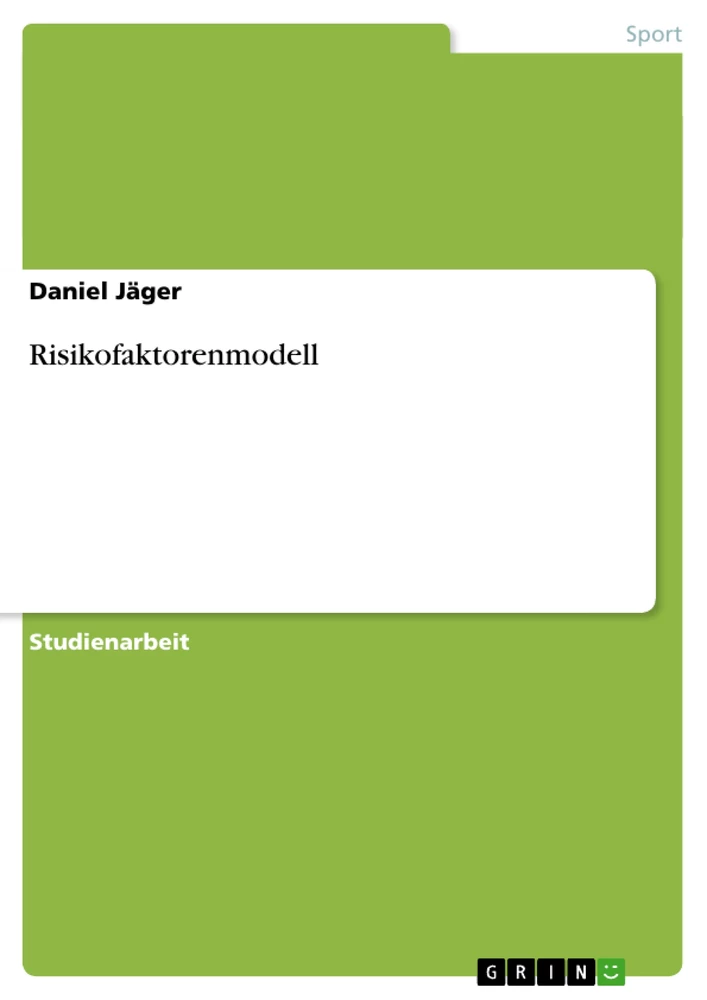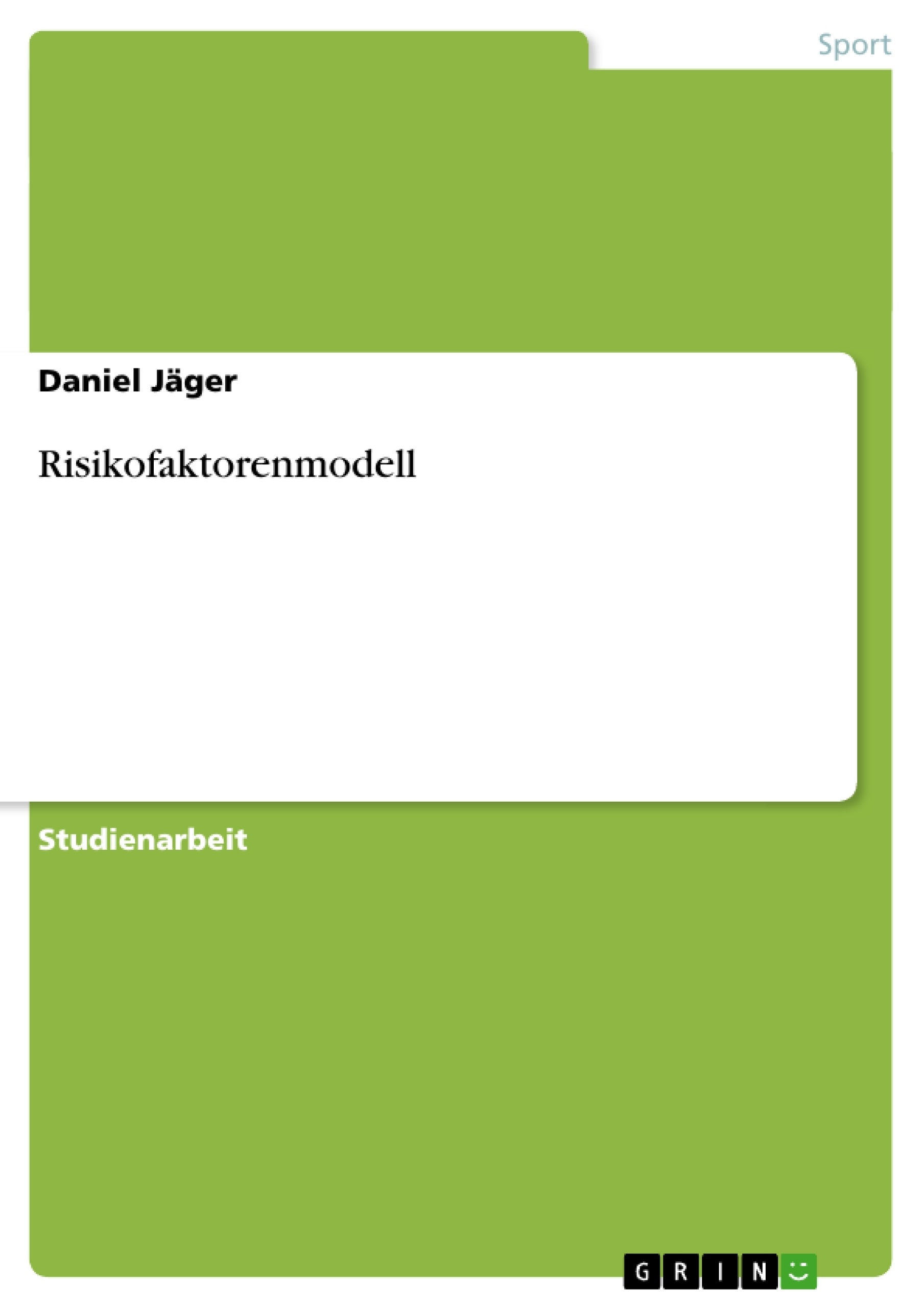Anfang des 20-sten Jahrhunderts erlebte die Medizin ein Wandel. Die klassischen Infektionskrankheiten wurden durch degenerative Erkrankungen, so genannten Zivilisationskrankheiten, abgelöst. An die Stelle von Krankheitsursachen rückte der Begriff der Risikofaktoren. Die Medizin richtete sich neu aus und arbeitet fortan vorwiegend präventiv.
Entscheidend für diese Entwicklung waren zum einen die fortschreitende Industrialisierung und damit verbundene einseitige Belastungen des menschlichen Körpers in Arbeit und Freizeit, zum anderen die Entdeckung des Penicillins (1928 von A.Fleming), welches erfolgreich gegen die Verbreitung von Infektionskrankheiten eingesetzt werden konnte.
Die präventive Ausrichtung der Medizin wurde durch die Gründung des Deutschen Sportärztebundes 1912 gestärkt. Körperliche Aktivität, Bewegung und Sport nehmen fortan eine zentrale Rolle in der Präventivmedizin ein. Neben den sehr viel bekannteren Aufgaben der Sportmedizin im Zusammenhang mit Leistungs- und Hochleistungssport (z.B. Doping), ist der primäre Arbeitsbereich der Sportmedizin, gesundheitsfördernde Auswirkungen von Bewegung und Präventivmedizin, in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Die Bezeichnung Sportmedizin ist hierbei allerdings auch irreführend, so dass überlegt wird, das Fachgebiet Bewegungs- und Sportmedizin zu nennen. Hierin wird deutlicher, dass versucht werden soll, alle Bewegungs- und Sportbezogenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit zu fördern und Krankheiten bzw. Unfälle zu vermeiden. (vgl. Banzer et. al., 1998, S. 18 & Knoll, 1997, S. 21-23)
Die Erkenntnisse der Präventivmedizin wurden im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Modellen systematisiert. Hierzu zählen die zwei folgenden Modelle.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Phasenmodell einer Bewegungsorientierten Prävention
3 Risikofaktorenmodell
3.1 Grundlagen des Risikofaktorenmodells
3.2 Risikofaktoren
3.3 Risikofaktorenmodell
4 Kritik am Risikofaktorenmodell
5 Zusammenfassung
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Anfang des 20-sten Jahrhunderts erlebte die Medizin ein Wandel. Die klassischen Infektionskrankheiten wurden durch degenerative Erkrankungen, so genannten Zivilisationskrankheiten, abgelöst. An die Stelle von Krankheitsursachen rückte der Begriff der Risikofaktoren. Die Medizin richtete sich neu aus und arbeitet fortan vorwiegend präventiv.
Entscheidend für diese Entwicklung waren zum einen die fortschreitende Industrialisierung und damit verbundene einseitige Belastungen des menschlichen Körpers in Arbeit und Freizeit, zum anderen die Entdeckung des Penicillins (1928 von A.Fleming), welches erfolgreich gegen die Verbreitung von Infektionskrankheiten eingesetzt werden konnte.
Die präventive Ausrichtung der Medizin wurde durch die Gründung des Deutschen Sportärztebundes 1912 gestärkt. Körperliche Aktivität, Bewegung und Sport nehmen fortan eine zentrale Rolle in der Präventivmedizin ein. Neben den sehr viel bekannteren Aufgaben der Sportmedizin im Zusammenhang mit Leistungs- und Hochleistungssport (z.B. Doping), ist der primäre Arbeitsbereich der Sportmedizin, gesundheitsfördernde Auswirkungen von Bewegung und Präventivmedizin, in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Die Bezeichnung Sportmedizin ist hierbei allerdings auch irreführend, so dass überlegt wird, das Fachgebiet Bewegungs- und Sportmedizin zu nennen. Hierin wird deutlicher, dass versucht werden soll, alle Bewegungs- und Sportbezogenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit zu fördern und Krankheiten bzw. Unfälle zu vermeiden. (vgl. Banzer et. al., 1998, S. 18 & Knoll, 1997, S. 21-23)
Die Erkenntnisse der Präventivmedizin wurden im Laufe der Zeit in unterschiedlichen Modellen systematisiert. Hierzu zählen die zwei folgenden Modelle.
2 Phasenmodell einer Bewegungsorientierten Prävention
Dieses Modell unterteilt die Gesundheitsprävention in drei bzw. vier. Bereiche.
Der Bereich der primären Prävention wird als Kernphase des „Phasenmodells der Prävention“ gesehen. Hierunter ist „die Förderung der Gesundheit durch Erfassung und Ausschalten schädigender Faktoren in einem Stadium, in dem noch keine … gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen“( Banzer et. al., 1998, S. 19), zu verstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, die Gesundheitsbildung zu fördern. Der Einzelne soll Gesundheitsorientiertes Wissen und Verhalten, besonders im Bereich Sport und Bewegung, erlernen. Hierzu zählen zum Beispiel Ernährungsberatung, Informationen zur Material- und Kleidungsauswahl und Trainingsberatung. Die Verbreitung dieses Wissens wird für jede Altersstufe (Bsp. Kindergarten, Schule, Betrieb) angestrebt.
Die sekundäre Prävention ist der Bereich, in dem noch keine subjektiven Beschwerden wahrgenommen werden. Oft können bereits vorhandenen Krankheitssymptome durch Vorsorgeuntersuchungen festgestellt und, auf derartige Diagnosen aufbauend, behandelt werden. Ziel ist es die Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten zu vermeiden.
Der Übergang von der Prävention zur Therapie bzw. Rehabilitation wird als tertiäre Prävention bezeichnet. Die eingetretenen Störungen der Gesundheit sind möglichst vollständig beseitigt werden. Dies geschieht durch ein, auf Heilungsvorgänge und medizinische Maßnahmen abgestimmtes, Bewegungs- und Sportprogramm.
Das dreistufige Präventionsmodell wird in neueren Arbeiten um eine vierte Stufe erweitert.
Die quartäre Prävention soll z.B. die Risiken einer medizinischen Überversorgung oder von Bewegung und Sport erkennen. Besonders Todesfälle bei bekannten Sportlern stehen immer wieder im Blickpunkt der Medien. Es geht in diesen Fällen darum, herauszubekommen, ob der Tod bzw. Unfall durch den Sport verursacht wurde oder nur zufällig mit diesem zusammen viel.
Die Anzahl der Sportunfälle bzw. Sporttoten muss dabei stets in Abhängigkeit zur Sportart gesehen werden. Besonders hohe Werte erreichen hierbei die Sportarten Motorsport, Luftsport, Schießen, Reiten, Tauchen und Kanufahren. Zahlen über Unfälle oder Tote sind am aussagekräftigsten, wenn man sie als „Vergleich der relativen jährlichen Unfallhäufigkeit pro 1000 Fachverbandsmitgliedern“ (Banzer et. al., 1998, S. 120) bestimmt. Bei der Unfallhäufigkeit liegen die Ballsportarten Basketball, Handball, Fußball und Volleyball an der Spitze. (vgl. Banzer et. al., 1998, S. 19-21)
[...]
- Quote paper
- Daniel Jäger (Author), 2005, Risikofaktorenmodell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135169