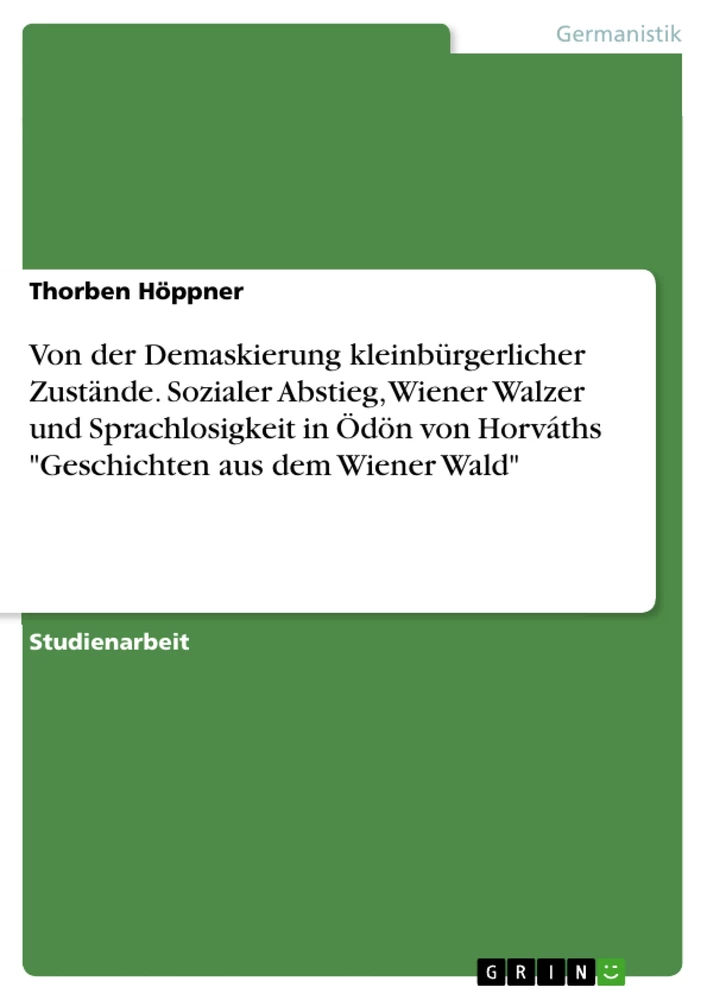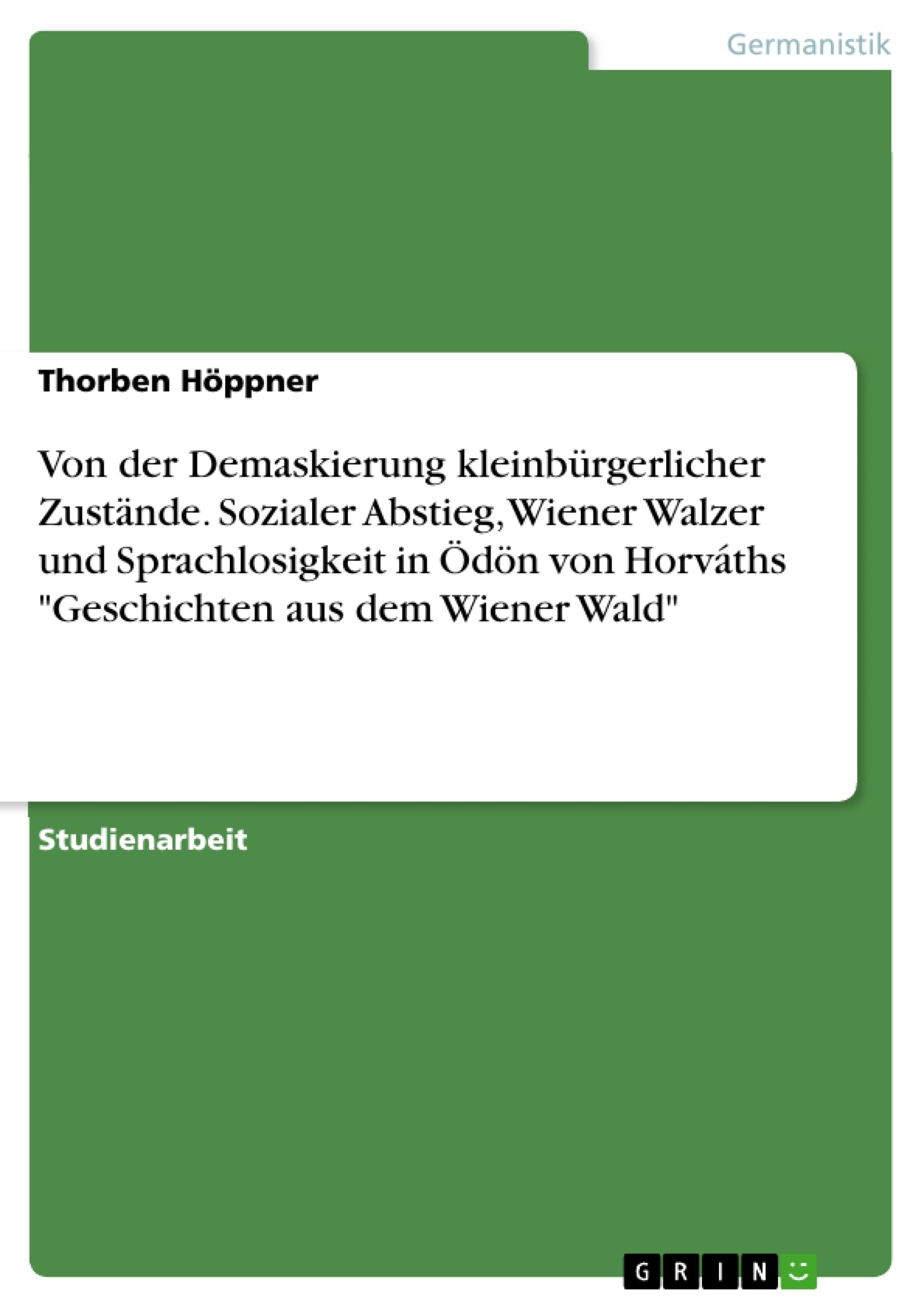Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald" revolutionierten das Wiener Volksstück und sind auch darüber hinaus in vielerlei Hinsicht bemerkenswert: Was bedeutet der dokumentarische Anspruch Horváths, welchen dieser selbst in seiner "Gebrauchsanweisung für Schauspieler" darlegt, für das Personal des Stücks? Wie wird das von Horváth proklamierte dramatische Grundmotiv des Kampfes zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein inszeniert? Welche Rolle spielt dabei die Sprache der Figuren, welche Rolle spielt dabei womöglich auch die (Walzer-)Musik, auf die der Titel des Stücks, als Anlehnung an den berühmten Walzer von Johann Strauss (Sohn), verweist?
Um diesen Fragen nachzugehen, nimmt diese Arbeit zunächst eine allgemeine Kontextualisierung des Figurenpersonals vor den zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründen des Stücks vor, um darauf aufbauend die Funktionalisierung von Sprache und Musik einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Besondere Analyseschwerpunkte der Arbeit liegen schließlich einerseits auf dem von den Figuren gesprochenen ‚Bildungsjargon‘ sowie andererseits auf der wiederkehrenden Regieanweisung ‚Stille‘. Speziell die Korrespondenz zwischen allgemeinhin krisenhafter Sprache (‚Bildungsjargon‘) und krisenhafter Dialogizität (‚Stille‘) wird dabei in Hinblick auf den von Horváth proklamierten ‚Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein‘ untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Horváths Geschichten aus dem Wiener Wald - Von einer Genrerevolution und dem Kampf verschiedener Bewusstseinszustände
- Kleinbürgertum, kleinbürgerliche Figuren, Bildungsjargon: Haltlosigkeit und soziale Schwellenzustände
- Alfred, Marianne, der soziale Abstieg und ein dualistisches Standesbewusstsein
- Von Nicht-Verstehen und Dummheit – Bildungsjargon als Sprachkrise
- Der Versuch einer heilen Welt: Wiener Walzer, Wiener Lieder und das ,goldene Wiener Herz.
- \"Stille\": Uneigentliches, das Eigentliche, und die finale Demaskierung kleinbürgerlicher Zustände
- Fazit: Sprachliches Versteckspiel, gesellschaftskritisches Sprachspiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ und analysiert die Genrerevolution des Stücks sowie die Darstellung des Kleinbürgertums in der späten Weimarer Republik. Die Arbeit zielt darauf ab, die sprachlichen und gesellschaftskritischen Aspekte des Stücks zu beleuchten.
- Genrerevolution des Volksstücks
- Darstellung des Kleinbürgertums und der sozialen Schwellenzustände
- Die Rolle von Sprache und „Bildungsjargon“
- Die Bedeutung von „Stille“ und das Verhältnis von Bewusstsein und Unterbewusstsein
- Gesellschaftskritik und die Demaskierung kleinbürgerlicher Zustände
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Genrerevolution, die Horváth mit „Geschichten aus dem Wiener Wald“ vollzieht. Das Stück stellt eine neue Form des Volksstücks dar, die durch eine kritische Auseinandersetzung mit den traditionellen Genrekonventionen und einen dokumentarischen Anspruch geprägt ist.
Das zweite Kapitel analysiert das Kleinbürgertum und seine Darstellung im Stück. Horváth zeichnet ein Bild der sozialen Schwellenzustände und der geistigen Armut des Kleinbürgertums, die durch wirtschaftliche Instabilität und die Weltwirtschaftskrise verstärkt werden. Die Figuren Alfred und Marianne werden als Beispiele für den sozialen Abstieg und die Herausforderungen des Kleinbürgertums beleuchtet.
Der dritte Abschnitt untersucht die Rolle von Sprache und „Bildungsjargon“ in den „Geschichten aus dem Wiener Wald“. Horváth verwendet die Sprache seiner Figuren, um ihre mangelnde Bildung, ihre Denkweise und die Widersprüche zwischen dem Anspruch und der Realität aufzuzeigen. Die Sprachkrise des Kleinbürgertums wird in diesem Kapitel durch die Analyse des „Bildungsjargons“ erörtert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Bedeutung von „Stille“ im Stück. Horváth setzt „Stille“ als Regieanweisung ein, um die Uneigentlichkeit und die finale Demaskierung der kleinbürgerlichen Zustände zu verdeutlichen. „Stille“ steht in diesem Kontext auch für den Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, der durch das sprachliche und gesellschaftskritische Spiel des Stücks dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit umfassen die Genrerevolution des Volksstücks, die Darstellung des Kleinbürgertums, die Rolle von Sprache und „Bildungsjargon“, die Bedeutung von „Stille“, der Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, die gesellschaftskritische Funktion des Stücks und die Demaskierung kleinbürgerlicher Zustände. Die Arbeit befasst sich auch mit dem Kontext der späten Weimarer Republik, der Weltwirtschaftskrise und dem dokumentarischen Anspruch von Horváths Werk. Wichtige Figuren sind Alfred, Marianne und der Zauberkönig.
- Quote paper
- Thorben Höppner (Author), 2022, Von der Demaskierung kleinbürgerlicher Zustände. Sozialer Abstieg, Wiener Walzer und Sprachlosigkeit in Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1351246