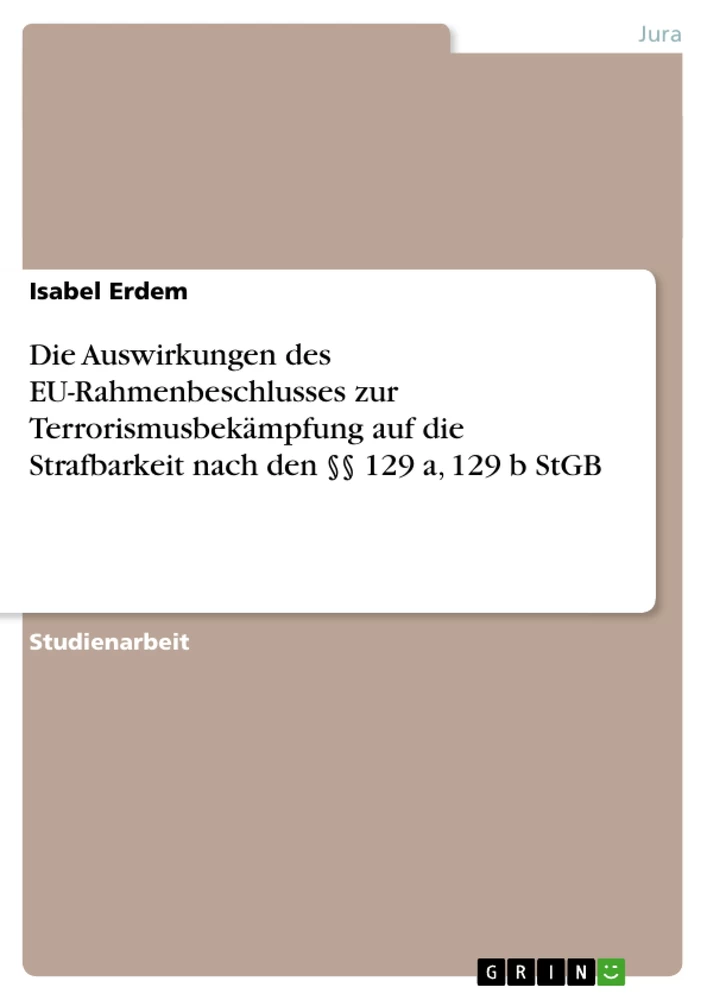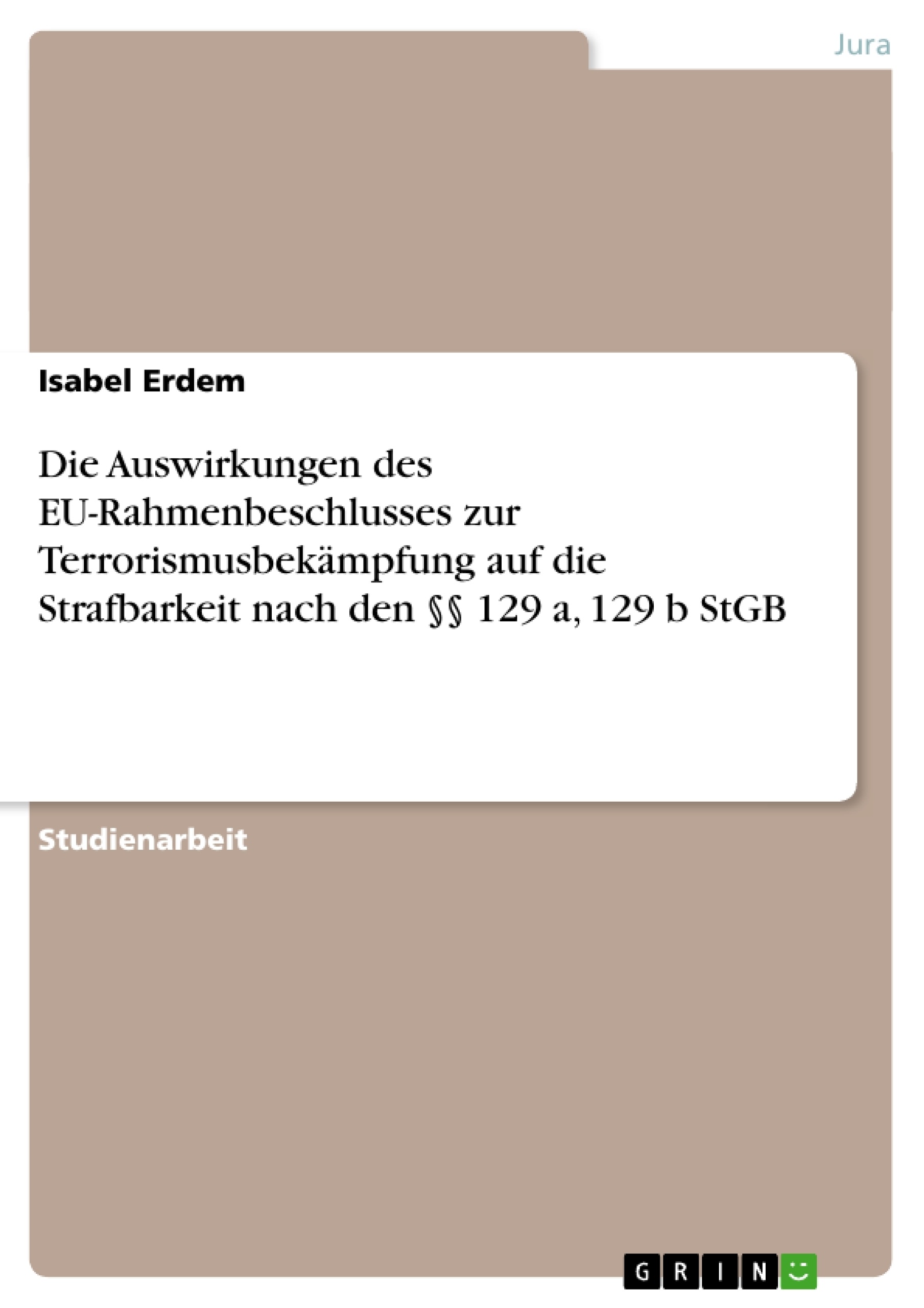Der Begriff Terrorismus kommt vom Lateinischen terror, was Furcht oder Schrecken bedeutet. Eine universal anerkannte Definition gibt es bisher nicht, sie erscheint aufgrund der politischen Komponente des Begriffs auch kaum möglich. Ein „Terrorist“ wird vielleicht aus anderer Perspektive als Freiheitskämpfer wahrgenommen. In manch einem inner- oder zwischenstaatlichen Konflikt bezeichnet eine Seite ihre Gegner als terroristisch – und umgekehrt.
Ziel des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung der EU vom 13.6.2002 ist die staatenübergreifende Angleichung der Definition terroristischer Straftaten sowie die Etablierung einer umfassenden Strafbarkeit, die die besondere Schwere dieser Taten widerspiegelt.
Wie sehr die Auffassungen von „terroristischen“ Aktivitäten bereits auf nationaler Ebene voneinander abweichen können, zeigen jüngste Verfahren nach § 129 a StGB - z.B. jenes im Vorfeld des G8-Gipfels, bei dem die Bundesanwaltschaft mehr als 40 Wohnungen durchsuchen ließ. Der BGH erklärte die Durchsuchungen für rechtswidrig und widersprach der terroristischen Qualität der ggf. geplanten Straftaten.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkung des europäischen Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung auf die Strafbarkeit nach den deutschen §§ 129 a/ b StGB. Als Grundlage der Erörterung wird zunächst eine überblicksartige Darstellung der deutschen Straftatbestände und des betreffenden Rahmenbeschlusses geliefert. Sodann werden die Einflüsse des letzteren auf die deutsche Strafbarkeit untersucht. Die Vorgaben
des Rahmenbeschlusses haben in erster Linie zu einer Veränderung des Wortlauts der deutschen Straftatbestände geführt. Insbesondere widmet sich die Arbeit jedoch der Frage
nach seiner Bedeutung für die deutschen Strafgerichte. Dabei wird auf die Problematik der jüngst vom EuGH postulierten Pflicht zur rahmenbeschlusskonformen Auslegung eingegangen, die den Vereinigungsbegriff der § 129 a/ b StGB betreffen könnte. Die mit
einer solchen Auslegung einhergehende Ausweitung der Strafbarkeit nach §§ 129 a/ b StGB soll kritisch dargestellt und an rechtsstaatlichen Prinzipien überprüft werden. Zum Abschluss wird in einer weiterführenden Betrachtung auf die Frage der Einhaltung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung durch Deutschland eingegangen, dabei werden Lösungsansätze zur Erfüllung der europäischen Verpflichtungen unter Beachtung einer rechtsstaatlichen Strafgesetzlichkeit aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- A) Die Strafbarkeit nach §§ 129 a/b StGB
- 1. Entstehungsgeschichte und Entwicklung des § 129 a StGB
- a] Einführung als Qualifikationstatbestand zu § 129 StGB
- b] Verschärfung durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 19.12.1986
- c] Abschaffung der Sympathiewerbung durch das 34. StÄG vom 22.8.2002
- d] Modifikationen in Folge des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung
- e] Überblick Tatbestand des § 129 a StGB in seiner aktuellen Fassung
- 2. Die Strafbarkeit nach § 129 b StGB
- a] Einführung durch das 34. Strafrechtsänderungsgesetz vom 22.8.2002
- b] Internationale Reichweite des Tatbestandes
- c] Ermächtigung des Bundesjustizministeriums als Verfolgungsvoraussetzung
- 3. Einordnung in das deutsche Strafrechtssystem – Probleme der Strafbarkeit
- a] Schutzgut der §§ 129 a/b StGB
- b] Hohe Strafbarkeit im Vorfeld einer konkreten Rechtsgutsverletzung
- c] Gewichtung der Tatbeiträge
- d] Unbestimmtheit des Tatbestandes
- e] Besondere Probleme des § 129 b StGB
- B) Der Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung vom 13. 6. 2002
- 1. Beschlussfassung
- 2. Inhalt des Rahmenbeschlusses
- a] Definitionen
- 1) Terroristische Straftaten
- 2) Terroristische Vereinigung
- b] Vorgaben bzgl. strafbarer Handlungen
- c] Mindestvorgaben bzgl. Höchstrafen
- d] Sonstige Vorgaben
- 3. Einordnung in die europäische Terrorismusbekämpfung
- C) Auswirkungen des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung auf die Strafbarkeit nach §§ 129 a/b StGB
- 1. Generelle Wirkung von EU-Rahmenbeschlüssen im Strafrecht
- a] Bedeutung für die nationale Rechtsetzung (Strafgesetzgeber)
- b] Bedeutung für die deutsche Rechtsprechung (Strafjustiz)
- 1) Pflicht zur rahmenbeschlusskonformen Auslegung aus EU-Vertrag?
- 2) Pflicht zur rahmenbeschlusskonformen Auslegung aus dem Grundgesetz?
- 2. Die Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung durch den deutschen Gesetzgeber
- 3. Bedeutung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung für die Rechtsprechung – Die Auslegungsproblematik der §§ 129 a/b StGB
- a] Folgen einer RB-konformen Auslegung für die Strafbarkeit der §§ 129 a/b StGB
- b] Überprüfung des Resultats am Grundgesetz
- c] Bedeutung für die deutschen Strafgerichte
- D) Weiterführende Darlegungen und Ausblick
- 1. Verstoß gegen den Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung
- 2. Vermeidung des Verstoßes durch die deutsche Rechtsprechung
- 3. Korrektur des Verstoßes durch den Gesetzgeber
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen des EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung auf die Strafbarkeit nach den §§ 129a und 129b StGB. Ziel ist es, die generelle Wirkung von EU-Rahmenbeschlüssen im deutschen Strafrecht zu analysieren und die konkreten Auswirkungen auf die genannten Paragraphen zu beleuchten.
- Entwicklung und aktuelle Fassung der §§ 129a und 129b StGB
- Inhalt und Bedeutung des EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung
- Auswirkungen des Rahmenbeschlusses auf die Auslegung und Anwendung der §§ 129a und 129b StGB
- Konformität der deutschen Rechtsprechung mit dem EU-Rahmenbeschluss
- Grundrechtliche Aspekte der Strafbarkeit nach §§ 129a und 129b StGB im Lichte des EU-Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
A) Die Strafbarkeit nach §§ 129 a/b StGB: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entstehungsgeschichte, Entwicklung und den aktuellen Stand der Strafbarkeit nach §§ 129a und 129b StGB. Es analysiert die einzelnen Tatbestände, ihre Schutzgüter und die damit verbundenen Herausforderungen im deutschen Strafrechtssystem. Besonderes Augenmerk liegt auf der Problematik der Vorfeldstrafbarkeit, der Gewichtung der Tatbeiträge und der potentiellen Unbestimmtheit der Tatbestände. Die Entwicklung der Paragraphen wird detailliert nachgezeichnet, von der ursprünglichen Einführung bis hin zu den Modifikationen durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz und den EU-Rahmenbeschluss. Der Fokus liegt auf der systematischen Einordnung der Paragraphen in das deutsche Strafrecht und der Analyse ihrer rechtlichen Problematik.
B) Der Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung vom 13. 6. 2002: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem EU-Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung. Es beschreibt die Beschlussfassung, den Inhalt des Beschlusses (einschließlich Definitionen von terroristischen Straftaten und Vereinigungen sowie Vorgaben zu strafbaren Handlungen und Strafhöhen), und ordnet ihn in den Kontext der europäischen Terrorismusbekämpfung ein. Die Analyse konzentriert sich auf die zentralen Bestimmungen des Rahmenbeschlusses und deren Bedeutung für die Harmonisierung des europäischen Strafrechts im Bereich der Terrorismusbekämpfung.
C) Auswirkungen des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung auf die Strafbarkeit nach §§ 129 a/b StGB: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Auswirkungen des EU-Rahmenbeschlusses auf die Strafbarkeit nach §§ 129a und 129b StGB. Es untersucht die generelle Wirkung von EU-Rahmenbeschlüssen im deutschen Strafrecht, sowohl auf die Gesetzgebung als auch auf die Rechtsprechung. Die zentrale Frage ist, inwieweit die deutsche Rechtsprechung zur rahmenbeschlusskonformen Auslegung verpflichtet ist und welche Folgen sich daraus für die Strafbarkeit nach §§ 129a und 129b StGB ergeben. Die Analyse umfasst die Prüfung der Konformität mit dem Grundgesetz und berücksichtigt die grundrechtlichen Aspekte wie das Analogieverbot, das Rückwirkungsverbot, das Bestimmtheitsgebot und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Schlüsselwörter
EU-Rahmenbeschluss, Terrorismusbekämpfung, §§ 129a, 129b StGB, Strafbarkeit, Vorfeldstrafbarkeit, Rechtsprechung, Grundgesetz, EU-Recht, Analogieverbot, Rückwirkungsverbot, Bestimmtheitsgebot, Verhältnismäßigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Auswirkungen des EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung auf die Strafbarkeit nach §§ 129a und 129b StGB
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen des EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung vom 13. Juni 2002 auf die Strafbarkeit nach den §§ 129a und 129b StGB des deutschen Strafgesetzbuches. Der Fokus liegt auf der Analyse der generellen Wirkung von EU-Rahmenbeschlüssen im deutschen Strafrecht und deren konkreten Auswirkungen auf die genannten Paragraphen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der §§ 129a und 129b StGB, den Inhalt und die Bedeutung des EU-Rahmenbeschlusses, die Auswirkungen des Beschlusses auf die Auslegung und Anwendung der §§ 129a und 129b StGB, die Konformität der deutschen Rechtsprechung mit dem EU-Rahmenbeschluss und die grundrechtlichen Aspekte der Strafbarkeit im Lichte des EU-Rechts.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptteile: A) Die Strafbarkeit nach §§ 129a/b StGB (inklusive Entstehungsgeschichte, aktuelle Fassung und rechtliche Problematik); B) Der EU-Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung (Beschlussfassung, Inhalt und Einordnung in die europäische Terrorismusbekämpfung); C) Auswirkungen des Rahmenbeschlusses auf die Strafbarkeit nach §§ 129a/b StGB (generelle Wirkung von EU-Rahmenbeschlüssen, Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber und Auslegungsproblematik); D) Weiterführende Darlegungen und Ausblick (Verstöße gegen den Rahmenbeschluss und deren Vermeidung/Korrektur).
Welche Rechtsfragen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Schutzgüter der §§ 129a/b StGB, die Problematik der Vorfeldstrafbarkeit, die Gewichtung von Tatbeiträgen, die potentielle Unbestimmtheit der Tatbestände, die Bedeutung der rahmenbeschlusskonformen Auslegung im deutschen Recht (Pflicht zur konformen Auslegung aus EU-Vertrag und Grundgesetz), und die Konformität der deutschen Rechtsprechung mit dem Grundgesetz unter Berücksichtigung von Grundrechten wie dem Analogieverbot, dem Rückwirkungsverbot, dem Bestimmtheitsgebot und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: EU-Rahmenbeschluss, Terrorismusbekämpfung, §§ 129a, 129b StGB, Strafbarkeit, Vorfeldstrafbarkeit, Rechtsprechung, Grundgesetz, EU-Recht, Analogieverbot, Rückwirkungsverbot, Bestimmtheitsgebot, Verhältnismäßigkeit.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende des Rechts, Wissenschaftler, die sich mit Strafrecht und EU-Recht befassen, sowie für alle, die sich für die Rechtsfragen der Terrorismusbekämpfung interessieren.
Wo finde ich den vollständigen Text der Seminararbeit?
Der vollständige Text der Seminararbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses FAQ dient lediglich als Zusammenfassung des Inhalts.
- Quote paper
- Isabel Erdem (Author), 2009, Die Auswirkungen des EU-Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung auf die Strafbarkeit nach den §§ 129 a, 129 b StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135112