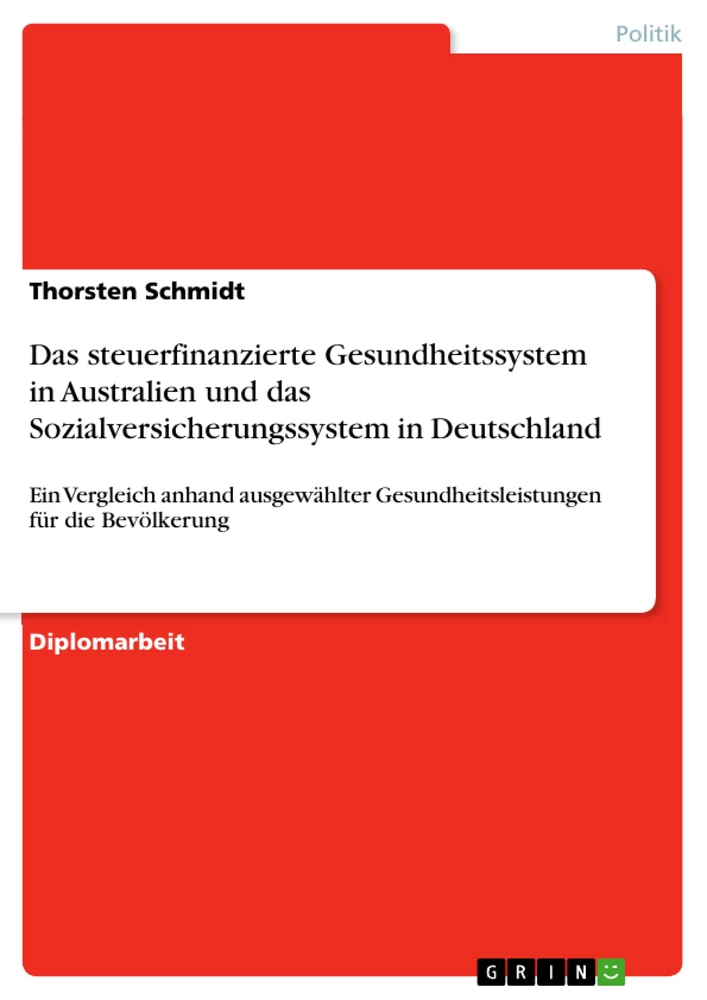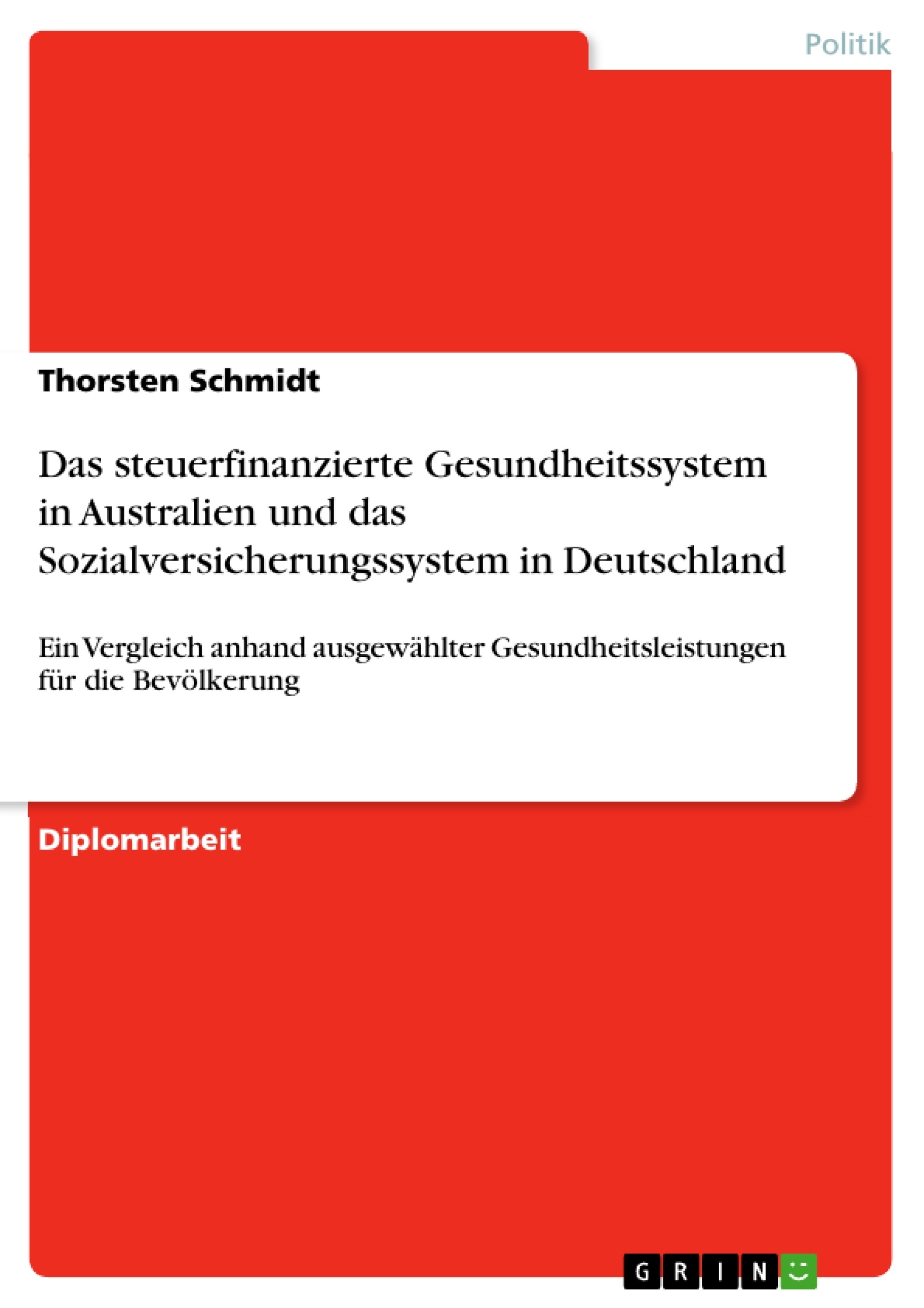Gesundheitssysteme können sich hinsichtlich des Aufbaus und der Organisation sowie hinsichtlich der Finanzierung und Ausgaben voneinander unterscheiden. Davon abhängig werden Gesundheitsleistungen für die Bevölkerung auf unterschiedliche Art und Weise erbracht. In dieser Arbeit werden die Gesundheitssysteme in Australien und Deutschland im Rahmen der Krankenversicherung miteinander verglichen. Dabei soll herausgestellt werden, welche Vor- und Nachteile das steuerfinanzierte Gesundheitssystem in Australien gegenüber dem deutschen Sozialversicherungssystem aufweist. Bei einem Vergleich von unterschiedlichen Gesundheitssystemen müssen zunächst die zu vergleichenden Gesundheitssysteme sowie ihre Bevölkerung umfassend betrachtet werden. Deshalb werden zu Beginn die Grunddaten der Gesundheitssysteme erläutert, wobei zunächst anhand ausgewählter Kriterien die Bevölkerungen beider Länder gegenübergestellt werden. Weiterhin werden die grundsätzlichen System- und Finanzierungsstrukturen betrachtet.
Anschließend wird die Gesundheitsversorung in beiden Ländern anhand der dafür ausgewählten Gesundheitsleistungen ambulante ärztliche Versorgung, stationäre Versorgung und Arzneimittelversorgung dargestellt. Diese Gesundheitsleistungen wurden deshalb ausgewählt, da sie ein umfassendes Leistungsspektrum innerhalb der Gesundheitsversorgung abdecken, was sich auch in den Ausgaben beider Länder widerspiegelt.
Daraufhin werden die ausgewählten Gesundheitsleistungen beider Gesundheitssysteme miteinander verglichen. Da die Gesundheitsleistungen in ein komplexes System integriert sind, wird vorab ein kurzer Vergleich der Systemstrukturen angestellt. Innerhalb dieses Vergleiches lassen sich bereits Vor- und Nachteile beider Systeme ableiten. Der Fokus der Betrachtung liegt insgesamt auf der Bedeutung für die Bevölkerungen.
Abschließend werden explizit die Vor- und Nachteile des australischen Gesundheitssystems dargestellt. Des Weiteren wird in einem kurzen Ausblick vorgestellt, welche Elemente in das deutsche System übernommen werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grunddaten der Gesundheitssysteme
- 2.1 Grunddaten der Bevölkerungen
- 2.1.1 Bevölkerungsentwicklung und Altersaufbau
- 2.1.2 Lebenserwartung
- 2.1.3 Gesundheitszustand
- 2.2 Aufbau und Organisation des australischen Gesundheitssystems
- 2.3 Finanzierung und Ausgaben des australischen Gesundheitssystems
- 2.4 Aufbau und Organisation des deutschen Gesundheitssystems
- 2.4.1 Gesetzliche Krankenversicherung
- 2.4.2 Private Krankenversicherung
- 2.4.3 GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
- 2.5 Finanzierung und Ausgaben des deutschen Gesundheitssystems
- 2.1 Grunddaten der Bevölkerungen
- 3 Gesundheitsversorgung in Australien
- 3.1 Ambulante ärztliche Versorgung
- 3.1.1 Versorgungsstruktur
- 3.1.2 Medicare
- 3.1.3 Private Zusatzversicherung
- 3.2 Stationäre Versorgung
- 3.2.1 Versorgungsstruktur
- 3.2.2 Medicare und private Zusatzversicherung
- 3.3 Arzneimittelversorgung
- 3.3.1 Versorgungsstruktur
- 3.3.2 Medicare
- 3.3.3 Private Zusatzversicherung
- 3.1 Ambulante ärztliche Versorgung
- 4 Gesundheitsversorgung in Deutschland
- 4.1 Ambulante ärztliche Versorgung
- 4.1.1 Versorgungsstruktur
- 4.1.2 Gesetzliche Krankenversicherung
- 4.1.3 Private Krankenversicherung
- 4.2 Stationäre Versorgung
- 4.2.1 Versorgungsstruktur
- 4.2.2 Gesetzliche Krankenversicherung
- 4.2.3 Private Krankenversicherung
- 4.3 Arzneimittelversorgung
- 4.3.1 Versorgungsstruktur
- 4.3.2 Gesetzliche Krankenversicherung
- 4.3.3 Private Krankenversicherung
- 4.1 Ambulante ärztliche Versorgung
- 5 Gesundheitssysteme im Vergleich
- 5.1 Ambulante ärztliche Versorgung
- 5.2 Stationäre Versorgung
- 5.3 Arzneimittelversorgung
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des steuerfinanzierten Gesundheitssystems in Australien im Vergleich zum sozialversicherungspflichtigen System in Deutschland. Der Fokus liegt auf ausgewählten Gesundheitsleistungen und deren Auswirkungen auf die jeweilige Bevölkerung.
- Vergleich der Grunddaten der Gesundheitssysteme beider Länder.
- Analyse des Aufbaus und der Organisation der Gesundheitssysteme.
- Untersuchung der Finanzierung und Ausgaben in Australien und Deutschland.
- Detaillierte Betrachtung der ambulanten, stationären und pharmazeutischen Versorgung.
- Gegenüberstellung und Vergleich der beiden Systeme.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung sowie die Methodik der Untersuchung. Es wird der Vergleich des australischen und des deutschen Gesundheitssystems begründet und der Fokus auf ausgewählte Gesundheitsleistungen gelegt.
2 Grunddaten der Gesundheitssysteme: Dieses Kapitel präsentiert grundlegende demografische Daten beider Länder, inklusive Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur und Lebenserwartung. Es werden außerdem relevante Kennzahlen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung beider Länder betrachtet und verglichen, um einen ersten Vergleichsrahmen für die weiteren Analysen zu schaffen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den demografischen Daten bilden die Grundlage für die spätere Analyse der Unterschiede in den Gesundheitssystemen.
3 Gesundheitsversorgung in Australien: Hier wird das australische Gesundheitssystem detailliert beschrieben, mit Fokus auf die ambulante, stationäre und Arzneimittelversorgung. Die Rolle von Medicare, der staatlichen Krankenversicherung, und privaten Zusatzversicherungen wird eingehend untersucht. Beispiele für die Versorgungspraxis und die damit verbundenen Kosten werden präsentiert. Es werden die Stärken und Schwächen des Systems im Detail beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf den jeweiligen Versorgungsbereichen liegt.
4 Gesundheitsversorgung in Deutschland: Analog zu Kapitel 3 wird hier das deutsche Gesundheitssystem analysiert, mit einem Schwerpunkt auf der Rolle der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung. Die ambulante, stationäre und Arzneimittelversorgung werden detailliert beschrieben und anhand von konkreten Beispielen illustriert. Die Unterschiede zur australischen Versorgung werden angedeutet, ohne explizite Vergleiche vorwegzunehmen. Der Schwerpunkt liegt auf den Mechanismen und den Auswirkungen der jeweiligen Versicherungsmodelle.
5 Gesundheitssysteme im Vergleich: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Vergleich der australischen und deutschen Gesundheitssysteme in Bezug auf die ambulante, stationäre und Arzneimittelversorgung. Die jeweiligen Stärken und Schwächen der Systeme werden gegenübergestellt, wobei die Auswirkungen auf die Bevölkerung im Mittelpunkt stehen. Es werden die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Australisches Gesundheitssystem, Deutsches Gesundheitssystem, Steuerfinanzierung, Sozialversicherung, Medicare, Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung, Ambulante Versorgung, Stationäre Versorgung, Arzneimittelversorgung, Bevölkerungsgesundheit, Kostenvergleich, Gesundheitsausgaben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vergleich des australischen und deutschen Gesundheitssystems
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht das australische und das deutsche Gesundheitssystem. Der Fokus liegt auf den Vor- und Nachteilen des steuerfinanzierten Systems Australiens im Vergleich zum sozialversicherungspflichtigen System Deutschlands. Ausgewählte Gesundheitsleistungen und deren Auswirkungen auf die jeweilige Bevölkerung stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich der Grunddaten beider Gesundheitssysteme, eine Analyse des Aufbaus und der Organisation, eine Untersuchung der Finanzierung und Ausgaben, sowie eine detaillierte Betrachtung der ambulanten, stationären und pharmazeutischen Versorgung in beiden Ländern. Ein abschließender Vergleich der beiden Systeme wird präsentiert.
Welche Länder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Gesundheitssystem Australiens mit dem Gesundheitssystem Deutschlands.
Welche Aspekte der Gesundheitsversorgung werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die ambulante, stationäre und die Arzneimittelversorgung in beiden Ländern. Dabei wird die Rolle von Medicare (Australien), der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung (Deutschland) eingehend untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einführung, Grunddaten der Gesundheitssysteme, Gesundheitsversorgung in Australien, Gesundheitsversorgung in Deutschland, Gesundheitssysteme im Vergleich und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Vergleichs.
Welche demografischen Daten werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur und Lebenserwartung in Australien und Deutschland. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung wird ebenfalls betrachtet, um einen Vergleichsrahmen zu schaffen.
Welche Rolle spielen die Finanzierungssysteme?
Die Arbeit analysiert die Finanzierung und Ausgaben der Gesundheitssysteme in beiden Ländern. Dabei wird die Bedeutung der Steuerfinanzierung in Australien und der Sozialversicherung in Deutschland herausgearbeitet.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Ergebnisse werden in Form von Kapitelzusammenfassungen und einem detaillierten Vergleich der beiden Systeme präsentiert. Die Stärken und Schwächen beider Systeme werden gegenübergestellt, wobei die Auswirkungen auf die jeweilige Bevölkerung im Fokus stehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Australisches Gesundheitssystem, Deutsches Gesundheitssystem, Steuerfinanzierung, Sozialversicherung, Medicare, Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung, Ambulante Versorgung, Stationäre Versorgung, Arzneimittelversorgung, Bevölkerungsgesundheit, Kostenvergleich, Gesundheitsausgaben.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Gesundheitssystemen.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Thorsten Schmidt (Author), 2008, Das steuerfinanzierte Gesundheitssystem in Australien und das Sozialversicherungssystem in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/135074