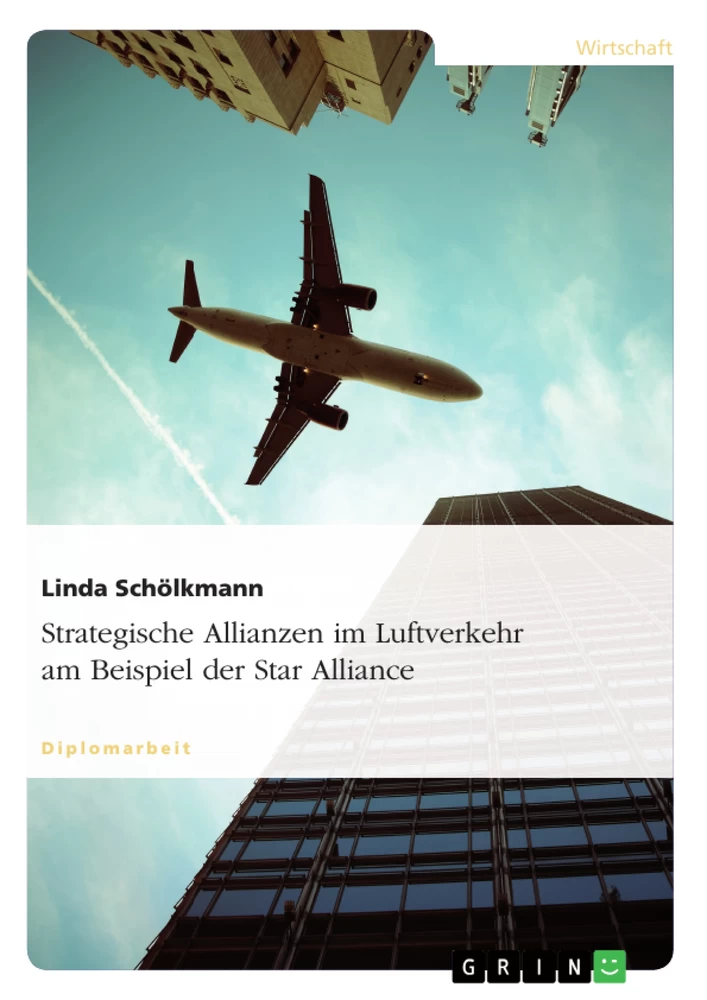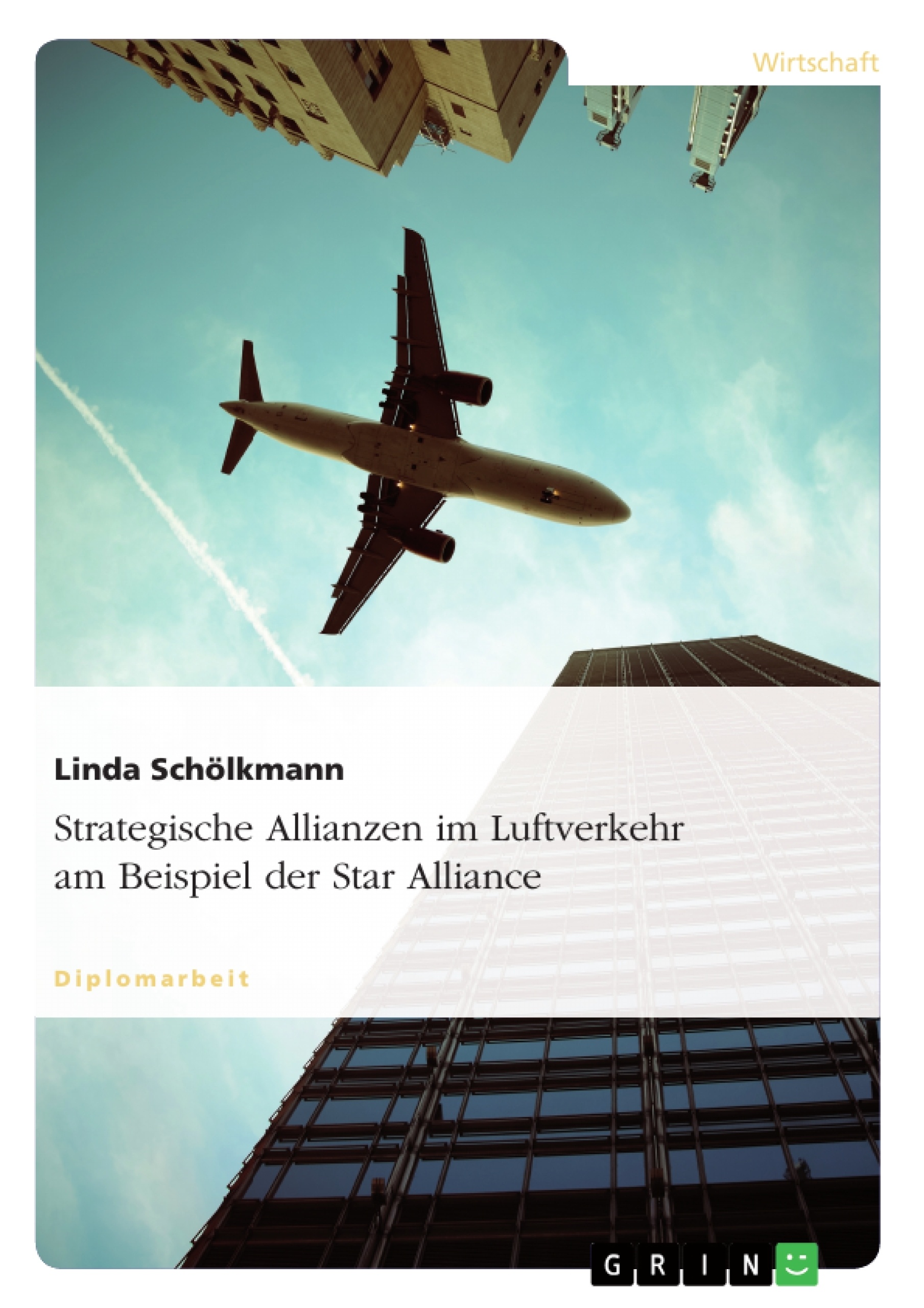Unter dem Titel „Kartelluntersuchung gegen Lufthansa“ berichtet die Financial Times Deutschland am 20.04.2009 von Untersuchungen der EU-Kommission gegen mehrere Fluggesellschaften des Luftverkehrsbündnisses Star Alliance.
„Die Kooperation sei bei Flugverbindungen zwischen Europa und Nordamerika intensiver als die sonst übliche, teilte die EU-Kommission am Montag mit.
Deshalb leiteten die Wettbewerbshüter eine Kartelluntersuchung ein.“ Ähnliche Verfahren seien bereits auch gegen mehrere Fluggesellschaften der anderen beiden großen Flugallianzen Oneworld und Skyteam eingeleitet worden. Falls den Gesellschaften eine Wettbewerbsbeschränkung durch kartellmäßige Absprachen nachgewiesen werden kann, drohen hohe Bußgelder, „im Extremfall bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes“.
Der Artikel belegt, welche Bedeutung strategische Allianzen im globalen Luftverkehrsmarkt innerhalb der letzten Jahre gewonnen haben. Auf der Basis bestehender Fachliteratur sowie unter Auswertung neuester (elektronischer) Publikationen und Presseartikeln soll die vorliegende Diplomarbeit hierzu systematisch die Hintergründe am Beispiel der strategischen Allianz „Star Alliance“ aufzeigen.
Ausgehend von den Grundlagen des Luftverkehrsmarktes werden mögliche Kooperationsformen im Luftverkehr vorgestellt, speziell vertiefend die Unternehmensverbindung „Strategische Allianz“. Hierzu wird in Folge exemplarisch die Entwicklung der „Star Alliance“ vorgestellt, die sich als Marktführer unter den konkurrierenden Flugallianzen positioniert hat. In einer Schlussbetrachtung erfolgt neben einer Beurteilung und Bewertung der Star Alliance, die Einschätzung der weiteren Entwicklung in diesem Sektor.
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung
2 Der Luftverkehrsmarkt
2.1 Die Entwicklung des Luftverkehrmarktes
2.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs
2.3 Die Veränderungen der rechtlich-politischen Rahmenbedingungen
3 Unternehmensverbindungen im Luftverkehr
3.1 Ziele und Motivation einer Unternehmensverbindung
3.2 Formen der Unternehmensverbindung im Luftverkehr
3.2.1 Alleingang
3.2.2 Akquisition und Fusion
3.2.3 Airlinespezifische Kooperationen
3.2.4 Strategische Allianzen
4 Strategische Allianzen im Luftverkehr
4.1 Ziele strategischer Airline-Allianzen
4.1.1 Absatzmarktgerichtete Ziele
4.1.2 Unternehmensgerichtete Ziele
4.1.3 Maßnahmen zur Zielerreichung
4.2 Arten strategischer Airline-Allianzen
4.3 Gründung und Ausbau strategischer Airline-Allianzen
4.3.1 Strategische Zieldefinition
4.3.2 Partnerevaluierung
4.3.3 Kooperationsvertrag
4.3.4 Integrationsvorbereitung
4.3.5 Inbetriebnahme
4.4 Organisationsstruktur strategischer Allianzen
4.5 Nutzenbetrachtung strategischer Allianzen
4.5.1 Vor- und Nachteile aus Sicht der beteiligten Unternehmen
4.5.2 Vor- und Nachteile aus Sicht der Kunden
5 Strategische Allianz – Star Alliance
5.1 Geschichte und Entwicklung
5.2 Zielsetzungen
5.3 Einordnung im Luftverkehrsmarkt
5.4 Aufbau und Organisation der Star Alliance GmbH
5.5 SWOT- Analyse der Star Alliance
6 Schlussbetrachtung
6.1 Beurteilung und Bewertung der Star Alliance
6.2 Bewertung und Einschätzung der zukünftigen Entwicklung strategischer
Allianzen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Linda Schölkmann
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1 Prognose über die weltweite Entwicklung des Luftverkehrs von 1985 – 2025
Abbildung 2 Prognose über die weltweite Entwicklung des Luftfrachtverkehrs von 1996 – 2026
Abbildung 3 Arten von Unternehmungsverbindungen
Abbildung 4 Goodwill-Aktion im Rahmen der Star Alliance
Abbildung 5 Connection Code Sharing
Abbildung 6 Vorteile eines Netzwerkes
Abbildung 7 Marktanteile der Allianzen am Gesamtmarkt nach Flugzeugen (Stand 2008)
Abbildung 8 Entwicklungsschritte beim Aufbau strategischer Allianzen
Abbildung 9 Kriterien und Gewichte der Evaluation potentieller Allianzpartner
Abbildung 10 Alliance Market Share 2008
Abbildung 11 Star Alliance Route Network
Abbildung 12 Capacity Shares between Traffic Areas
Abbildung 13 Star Alliance Organisationsstruktur Linda Schölkmann Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Unter dem Titel „Kartelluntersuchung gegen Lufthansa“ berichtet die Financial Times Deutschland am 20.04.2009 von Untersuchungen der EU-Kommission gegen mehrere Fluggesellschaften des Luftverkehrsbündnisses Star Alliance. „Die Kooperation sei bei Flugverbindungen zwischen Europa und Nordamerika intensiver als die sonst übliche, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Deshalb leiteten die Wettbewerbshüter eine Kartelluntersuchung ein.“1 Ähnliche Verfahren seien bereits auch gegen mehrere Fluggesellschaften der anderen beiden großen Flugallianzen Oneworld und Skyteam eingeleitet worden. Falls den Gesellschaften eine Wettbewerbsbeschränkung durch kartellmäßige Absprachen nachgewiesen werden kann, drohen hohe Bußgelder, „im Extremfall bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes“.
Der Artikel belegt, welche Bedeutung strategische Allianzen im globalen Luftverkehrsmarkt innerhalb der letzten Jahre gewonnen haben. Auf der Basis bestehender Fachliteratur sowie unter Auswertung neuester (elektronischer) Publikationen und Presseartikeln soll die vorliegende Diplomarbeit hierzu systematisch die Hintergründe am Beispiel der strategischen Allianz „Star Alliance“ aufzeigen. Ausgehend von den Grundlagen des Luftverkehrsmarktes werden mögliche Kooperationsformen im Luftverkehr vorgestellt, speziell vertiefend die Unternehmensverbindung „Strategische Allianz“. Hierzu wird in Folge exemplarisch die Entwicklung der „Star Alliance“ vorgestellt, die sich als Marktführer unter den konkurrierenden Flugallianzen positioniert hat. In einer Schlussbetrachtung erfolgt neben einer Beurteilung und Bewertung der Star Alliance, die Einschätzung der weiteren Entwicklung in diesem Sektor.
2 Der Luftverkehrsmarkt
2.1Die Entwicklung des Luftverkehrmarktes
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist eine rasante Entwicklung des internationalen Luftverkehrs zu verzeichnen, in der sich das Transportmedium Flugzeug zu einem Massenverkehrsträger entwickelt hat. Die Globalisierung der Märkte begünstigt und erfordert die Expansion der weltweiten Luftfahrtindustrie. Technischer Fortschritt, ein erhöhter Mobilitätsbedarf und das sich dynamisch verändernde Konsumverhalten der Menschen haben seit Beginn der 60er Jahre den Wachstumsschub im Luftverkehr verstärkt. Nach Angaben der WTO verzeichnet allein der Passagierverkehr zwischen 1960 – 2000 ein durchschnittliches Wachstum von 9 % und auch der Frachttransport glänzt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10% zwischen 1997 – 2004.2 Ausnahmen des kontinuierlichen Wachstums ergaben sich aus politisch-ökonomischen Sondersituationen wie der ersten Ölkrise 1973, der weltweiten Rezession 1980, dem zweiten Golfkrieg 1990/91 sowie den Terroranschlägen des 11.Septembers 2001 in den Vereinigten Staaten, welche jeweils zu drastischen Umsatzeinbrüchen in der Luftverkehrsbranche führten. Das dennoch enorme Wachstum hat im Wesentlichen 4 Gründe:
- Eine durch technologische Entwicklungen bedingte Produktivitäts-steigerung, die konsequenterweise zu einer Senkung der Flugpreise führte.
- Eine zunehmende internationale Vernetzung der nationalen Volkswirt-schaften, die zu einem Nachfrageanstieg nach Geschäftsreisen und Frachttransporten führte.
- Ein steigendes Realeinkommen der Bevölkerung der Industrieländer, welches die Nachfrage nach Privatreisen ermöglichte, sowie eine politische Liberalisierung des Luftverkehrs, welche in vielen
Verkehrsgebieten eine Verbesserung des Angebots und eine deutliche Absenkung der Flugpreise zur Folge hatte.3
Die Wachstumsentwicklung erscheint nach Expertenmeinung ungebrochen. Auf Grund der kontinuierlich zunehmenden internationalen Verflechtung wirtschaft-licher Tätigkeiten und eines zusätzlichen Anstiegs des Reiseverkehrs, geht die International Civil Aviation Organization (ICAO) von einem weiteren zukünftigen Wachstum des internationalen Luftverkehrs aus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Prognose über die weltweite Entwicklung des Luftverkehrs von 1985 – 2025
Quelle: ICAO4
Nach Prognosen des Flugzeugherstellers Boeing werden im Passagierverkehr vor allem China, Südost-Asien sowie Südamerika mit Wachstumsraten von bis zu 8% zu den Spitzenreitern im internationalen Vergleich gehören. Nordamerika und Europa hingegen, welche zu den aufkommensstärksten Verkehrsgebieten weltweit zählen, können danach immer noch ein prognostiziertes Wachstum Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance von rund 5% verzeichnen.5 Grund für die unterschiedlich hohen Entwicklungsraten sind die ungleichen Wirtschaftsstadien jener Länder. So ist der Luftverkehrsmarkt in Nordamerika und Europa bereits in seinem Reifestadium angelangt, was mit einer hohen Wettbewerbsintensität einhergeht, welche die Fluggesellschaften an Stelle von Expansion vorrangig zu Konsolidierung bewegt.
Prognosen für den Luftfrachtmarkt sehen als Wachstumsursache hier vor allem die zunehmende Intensivierung weltwirtschaftlicher Transaktionen in den nächsten 20 Jahren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Prognose über die weltweite Entwicklung des Luftfrachtverkehrs von 1996 – 2026, Quelle: Airbus6
Die Marktentwicklung und ihre Ursachen stellten die Luftverkehrsgesellschaften vor neue Herausforderungen: Wachstum und Flexibilität wurden zur Voraussetzung für langfristige Wettbewerbsfähigkeit. So entstanden differenzierte Geschäftsmodelle wie die der Network- und Low-Cost-Airlines, die Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance eine segmentierte Marktdurchdringung ermöglichen. Der internationale Wettbewerbsdruck erfordert zudem permanente Kostendegression und Produktivitätssteigerung. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und strategische Wettbewerbsvorteile realisieren und ausbauen zu können, entschlossen sich viele Fluggesellschaften zur Bildung von strategischen Allianzen mit Wettbewerbern. Damit einhergehend fand eine Neuausrichtung des Wettbewerbs statt: im globalen Langstreckenmarkt konkurrieren nun vorrangig Airline-Allianzen um Marktanteile. Auch in den nationalen und regionalen Kurzstreckenmärkten gewinnen strategische Luftverkehrsallianzen zunehmend an Bedeutung. Neben Kooperationen zwischen Regional-fluggesellschaften ist vor allem eine Allianzbildung zwischen großen internationalen Linienfluggesellschaften und Regionalcarriern zu verzeichnen.
2.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs
Nach Maurer bezeichnet der Luftverkehr die Gesamtheit aller „Vorgänge, die der Ortsveränderung von Personen, Fracht und Post auf dem Luftweg dienen“.7 Damit erfüllt er folgende Funktionen:
I. Wirtschaftliche Funktion
Eine wichtige Grundvoraussetzung einer internationalen Volkswirtschaft ist ein funktionierendes Luftverkehrssystem, welches zeitliche und räumliche Distanzen überwindet, indem es Personen und Güter zeitsparend über große geographische Entfernungen transportiert. Dies ermöglicht den schnellen Warentransport zwischen Absatz- und Bezugsmärkten sowie die zeitnahe Erreichung von Verhandlungspartnern und Reisezielen.8 Hierbei steht vor allem die Zeitersparnis im Vordergrund des Güter- und Personenverkehrs, während die Kostenersparnis durch die Nutzung alternativer Transportmittel eine untergeordnete Rolle spielt. Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance Quantitativ ist die ökonomische Bedeutung des Luftverkehrs nicht eindeutig bestimmbar, da die durch Personenbeförderung und Gütertransport ausgelösten Wirkungen vielschichtig sind. Der Gesamtbeitrag zur Bruttowertschöpfung setzt sich hierbei aus folgenden Effekten zusammen:9
1. Direkte Effekte umfassen die Leistungen der Luftverkehrswirtschaft (Flugdienste, Flughäfen und öffentliche Dienste) sowie die der Luftfahrtindustrie (Flugzeughersteller, Ausrüstung, Triebswerke).
2. Indirekte Effekte entstehen durch die Auftragsvergabe der Luftverkehrs-und Luftfahrtunternehmen an Lieferanten sowie durch die Anbieter luftverkehrsbezogener Leistungen (Reisebüros, Autovermietungen, etc.).
3. Induzierte Effekte ergeben sich durch die Konsumnachfrage der im Luftverkehr Beschäftigten sowie der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen durch die im Luftverkehr tätigen Unternehmen und Behörden.
4. Katalysierte Effekte entstehen durch die günstigen Reise-, Liefer- und Exportmöglichkeiten in Flughafennähe, welche eine Vielzahl von in- und ausländischen Unternehmen dazu bewegt, sich nahe der Luftverkehrs-knotenpunkte anzusiedeln.
Das kontinuierliche Wachstum der Luftfahrtindustrie erzeugt wiederum Wachstumsimpulse in anderen Wirtschaftssektoren, welche mittelbar oder unmittelbar mit der Luftverkehrswirtschaft verbunden sind. Dies wiederum generiert neue Arbeitsplätze, sodass laut Statistiken im Jahr 2002 rund eine Dreiviertel Million Beschäftigte im Rahmen der Luftverkehrswirtschaft tätig waren.10
II. Gesellschaftliche Funktion
Der Luftverkehr begünstigt das stetig wachsende Mobilitätsstreben der Bürger im geschäftlichen und privaten Bereich und fördert gleichzeitig die politischen Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance und gesellschaftlichen Verflechtungen internationaler Volkswirtschaften. Somit wird der Luftverkehr als gesellschaftliches und staatliches Integrationsmittel verstanden, welches zur allgemeinen Völkerverständigung beiträgt.11
III. Technologische Funktion
Technische Innovationen haben seit den sechziger Jahren zu deutlichen Produktivitätssteigerungen im Luftverkehr geführt, indem leistungsfähigere und sicherere Fluggeräte neben Kapazitätssteigerungen auch zu geringeren Umweltbelastungen beitragen. Als technologisch hoch entwickelter Industriezweig verfügt die Luftfahrtindustrie über nahezu alle zukunftsträchtigen Technologiebereiche, deren Forschungsergebnisse wiederum in andere Wirtschaftsektoren transferiert werden können.12
IV. Politische Funktion
Die Förderung und Weiterentwicklung des Luftverkehrs dient auf nationaler Ebene der Sicherstellung eines effizienten Verkehrskonzeptes, welches die verschieden Verkehrsträger systematisch integriert. Auf internationaler Ebene begünstigt die Luftfahrt die Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft und ermöglicht die politische Präsenz in anderen Staaten. Zwar ist die national-politische Bedeutung des Luftverkehrs auf Grund von Liberalisierungs- und Deregulierungsbestrebungen zurückgegangen, jedoch liegt es im Interesse eines jeden Staates verkehrstechnisch möglichst unabhängig zu sein.13
V. Umweltpolitische Funktion
Der Flugverkehr belastet die Umwelt grenzüberschreitend durch Lärm, Abgasemissionen und Ressourcenverbrauch. Das gestiegene Klimabewusst-sein der Menschen sowie gesetzliche Vorschriften stellen die Luftfahrtindustrie daher vor neue Herausforderungen: die Entwicklung von energiesparenderen, emissionsärmeren und Lärm reduzierenden Fluggeräten wird unerlässlich. Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus reagieren auf die neuen Anforderungen durch technologische Innovationen und die Einführung Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance unternehmensübergreifender Umweltstandards. Erst im Februar 2009 hat Boeing das international anerkannte Umweltzertifikat ISO 14001 erhalten, welches die Verpflichtung eines Unternehmens impliziert, seine Umweltleistung kontinuierlich zu erfassen sowie zu verbessern.14 Airbus, ebenfalls Inhaber des Umweltzertifikates, hat mit der Entwicklung des A380 das größte zivile Verkehrsflugzeug geschaffen, welches neben einer reduzierten CO2-Emission auch Treibstoff sparender und Lärm bewusster operiert.15 Die Entwicklung der ökonomisch-ökologischen Kompatibilität wird somit in Zukunft auch weiterhin von den technologischen Fortschritten der Luftfahrtindustrie abhängig sein.
2.3 Die Veränderungen der rechtlich-politischen Rahmenbedingungen
Mit der Konferenz von Chicago 1944 wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine grundlegende Neuordnung des internationalen Luftverkehrs eingeleitet. Auf Grund von unterschiedlichen Ausgangslagen der Luftfahrtindustrie in den USA und Europa konnte man sich nicht auf eine multilaterale Vereinbarung von kommerziellen Verkehrsrechten einigen, sodass zunächst die Lufthoheitstheorie als grundlegendes Prinzip der internationalen Luftfahrt manifestiert wurde. In Folge dessen wurde der internationale Linienflugverkehr durch eine Vielzahl von bilateralen Verträgen geregelt, welche noch heute das fragmentierte Bild der Luftverkehrsindustrie prägen.16 Der Luftverkehr wurde dabei vor allem durch national-politische Interessen geprägt, was zu einer außergewöhnlichen Protektionismusdichte und zahlreichen wettbewerbshemmenden Regulierungen führte, welche die selbstregulierenden Marktmechanismen außer Kraft setzten und noch heute die Entwicklung effizienter Industriestrukturen hemmen.17
Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance Erste Deregulierungsbestrebungen sind Anfang der siebziger Jahre in den USA zu verzeichnen und werden durch den Airline Deregulation Act von 1978 realisiert, indem wettbewerbshemmende Markteintrittsbarrieren und Regularien konsequent abgebaut werden. Infolge der verbesserten Wettbewerbssituation waren eine allgemeine Absenkung des Flugpreisniveaus, ein verbessertes Leistungsangebot, eine erhöhte Produktivität der Fluggesellschaften sowie eine effizientere Marktstruktur zu verzeichnen. Eine ähnliche Liberalisierungs-bewegung zeichnete sich ab 1987 auch in Europa ab. Um die Grundlagen für ein wettbewerbsgeleitetes Marktsystem zu schaffen, entwickelten die Länder der Europäischen Gemeinschaft einen dreistufigen Liberalisierungsplan, welcher bis Januar 1993 realisiert werden sollte. Hierzu zählten unter anderem die völlige Tariffreiheit, der Wegfall von Kapazitätsbeschränkungen sowie die freie Ausübung der Verkehrsrechte innerhalb der Gemeinschaft.18 Einen weiteren Vorstoß im Liberalisierungsprozess erzielten die USA und Europa mit dem am 30. März 2008 in Kraft getretenen Open-Skies-Abkommen. Hiernach kann jede Fluggesellschaft der USA und der 27 EU-Staaten selbst entscheiden, welche transatlantischen Strecken sie zu welchen Tarifen fliegt. Experten-meinungen zufolge wird dadurch die Passagierzahl zwischen Europa und den USA bis 2013 um rund 26 Millionen steigen.19
Auch in weiteren Teilen der Welt wie in Asien, Afrika und Lateinamerika werden Anstrengungen unternommen, die industriellen Strukturen nach europäischem und amerikanischem Vorbild zu verändern, indem sich die Unterzeichner weiterer Open-Skies-Abkommen gegenseitig uneingeschränkten Marktzugang einräumen und somit ihren Luftverkehr schrittweise liberalisieren.
Ein weiterer wichtiger Trend in der Luftverkehrsbranche ist die zunehmende Privatisierung von Luftverkehrsgesellschaften. Nach Angaben von Boeing ist in den letzten20 Jahren ein deutlicher Rückgang von staatlichen Kapital-beteiligungen an den ehemaligen Flag-Carriern zu vernehmen, was wiederum zu deutlichen Gewinnsteigerungen bei den entsprechenden Unternehmen führte. Auf der anderen Seite sind weiterhin staatliche Interventionen in der Luftverkehrsindustrie durch die Gewährung von Subventionen zu verzeichnen. Die finanziellen Staatshilfen werden dabei teils heftig kritisiert, da sie unprofitable Fluggesellschaften künstlich am Leben erhalten und es dadurch zu Wettbewerbsverzerrungen im Luftverkehrsmarkt kommt.
Neben der Privatisierung von Fluggesellschaften ist eine verstärkte Konsolidierung der Luftverkehrsindustrie zu verzeichnen. Durch die Liberalisierung der Märkte kommt es auf nationaler Ebene zu einer erhöhten Akquisitions- und Fusionsrate, während im internationalen Rahmen die vermehrte Bildung strategischer Allianzen zu beobachten ist. Dies ist unter anderem auf die Nationality-Rule zurückzuführen, welche impliziert, dass Verkehrsrechte nur jenen Luftverkehrsgesellschaften erteilt werden, die mehrheitlich im Eigentum von inländischen natürlichen oder juristischen Personen sind.20 Die Veränderung der Besitzverhältnisse durch die Übertragung der Kapitalmehrheit an eine ausländische Gesellschaft würde somit zu einem partiellen Verlust bestimmter Verkehrsrechte der akquirierten Airline führen.21
Die Veränderungen der rechtlich-politischen Rahmenbedingungen im Luftverkehr haben folglich zu einem enormen wettbewerbswirtschaftlichen Wandel geführt. War die internationale Luftverkehrsbranche bis 1978 noch deutlich von wettbewerbshemmenden Regulierungen und national-politischem Protektionismus geprägt, so war der Weg mit der Unterzeichnung des Airline Deregulation Act vom damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter hin zu einer offenen Wettbewerbspolitik geebnet. Im Zuge der Deregulierungs- und Liberalisierungsprozesse kam es Anfang der achtziger Jahre in den USA zu einer hohen Zahl von Markteintritten. Langfristig konnten sich jedoch nur die effektivsten Wettbewerber am Markt durchsetzen, sodass es zu einer Vielzahl von Zusammenschlüssen, Übernahmen und Konkursen unprofitabler Fluglinien kam.22 Diese Tendenz ist ebenfalls in anderen liberalisierten Luftverkehrs-gebieten zu verzeichnen, wobei der hohe Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche die Luftverkehrsgesellschaften dazu zwingt, neue Wettbewerbs- und Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance Wachstumsstrategien zu entwickeln, um Wettbewerbsvorteile ausbauen und die eigene Marktposition verteidigen zu können.
Die steigende Anzahl an Konsolidierungen innerhalb der Luftverkehrsbranche führt dabei in Richtung eines oligopolistischen Marktes, in dem lediglich wenige große Unternehmen den Markt dominieren und im Rahmen der strategischen Allianzen in Wettbewerb miteinander treten. Die durch die Kooperation realisierten Verbundvorteile führen wiederum zu einer Erhöhung der Markteintrittsbarrieren neuer Linienfluggesellschaften, indem Allianzpartner gegenüber den jungen Unternehmen bereits über eine beachtliche Marktmacht, rentable Slots, einen hohen Bekanntheitsgrad sowie einen großen Kundenstamm verfügen. Lediglich Nischenanbieter wie Low-Cost-Carrier und Charterfluggesellschaften konnten sich auf Grund ihres divergenten Geschäftsmodells in den letzten Jahren erfolgreich am Markt etablieren.
Um einen restriktiven Wettbewerb und damit verbundene Kundennachteile wie Preisabsprachen innerhalb der Allianzen zu vermeiden, haben die Aufsichts-behörden folglich ihr Augenmerk verstärkt auf das Wettbewerbsverhalten der strategischen Allianzen zu richten.23
3 Unternehmensverbindungen im Luftverkehr
3.1Ziele und Motivation einer Unternehmensverbindung
Ein häufig zu beobachtendes Phänomen innerhalb vieler Wirtschaftssysteme ist das Bestreben zahlreicher Unternehmen, sich mit anderen Organisationen zusammenzuschließen. Die Internationalisierung der Märkte und der damit einhergehende steigende Wettbewerbsdruck zwingen viele Unternehmen dazu, neue Wettbewerbs- und Wachstumsstrategien zu entwickeln, um langfristig ihre wirtschaftliche Existenz gegenüber der Konkurrenz absichern zu können.
In der Fachliteratur versteht man unter einer Unternehmensverbindung „die Vereinigung bestehender rechtlich und wirtschaftlich selbständiger Unternehmen mit dem Zweck gemeinschaftlicher Aufgabenerfüllung“.24
Die wesentlichen Ziele und Motive von Unternehmensverbindungen sind dabei folgende:25
- Erhöhung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit: Durch die Zusammenlegung gleichartiger Tätigkeiten zweier oder mehrerer Unternehmen entstehen auf Grund der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen Kostenvorteile. Der sogenannte „Synergieeffekt“ besagt, dass die Zusammenfassung bisher getrennter Bereiche mehr wert ist als die Summe der Teile.
- Skalen- und Größenvorteile: Infolge der Ausweitung der Produktionsmenge sinken auf Grund der Fixkostendegression die Kosten pro Einheit.
- Wachstum: Ein organisches Wachstum ist häufig nur in jungen Märkten möglich. In reiferen Märkten wie dem Luftverkehrsmarkt sind Unternehmen vorrangig auf anorganisches Wachstum in Form von Unternehmensverbindungen angewiesen.
- Risikominderung: Durch die Risikoaufteilung auf mehrere Partner soll das Unternehmensrisiko bei der Entwicklung neuer Produkte und Märkte in gerechter Weise auf die beteiligten Organisationen verteilt und somit minimiert werden.
- Absatzsteigerung: Durch die gemeinsame Nutzung von Absatzkanälen und Marketingmaßnahmen kann der Vertrieb effizienter gestaltet werden. Ebenfalls ist eine Ergänzung des Absatzprogramms durch den Verkauf von Cross-Selling-Produkten möglich.
- Beschaffungsoptimierung: Das gemeinschaftliche Auftreten der verbundenen Unternehmen erhöht deren Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten und damit die Möglichkeit der Durchsetzung verbesserter Vertragskonditionen.
- Marktzugang: Unternehmenszusammenschlüsse können dazu dienen, administrative, wirtschaftliche und technische Markteintrittsbarrieren zu überwinden, um somit strategisch neue Märkte zu erschließen.
Strategische Allianzen im Luftverkehr, dargestellt am Beispiel der Star Alliance
- Wettbewerbsreduktion: Das Eingehen von Unternehmensverbindungen reduziert den Wettbewerbsdruck, indem bisherige Konkurrenten zu Partnern werden.
3.2 Formen der Unternehmensverbindung im Luftverkehr
Zur Erreichung langfristiger Unternehmensziele steht einem Unternehmen grundsätzlich die Möglichkeit des isolierten Vorgehens oder des Eingehens von Unternehmensverbindungen zur Verfügung.26 Der Unternehmenszusammen-schluss in einem oder mehreren ökonomischen Tätigkeitsbereichen erfolgt hierbei durch rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen, die sich folglich zu größeren Organisationseinheiten zusammenschließen. Die verfolgten Ziele der beteiligten Unternehmen bestimmen hierbei die Intensität, Richtung, Dauer und Rechtsform der Verbindung.
In Hinblick auf die Richtung der Zusammenschlüsse erfolgt eine Differenzierung in:27
- Horizontale Verbindungen: Zwei oder mehrere Unternehmen derselben Handels- oder Produktionsstufe schließen sich mit dem vorrangigen Ziel der Wettbewerbsbeschränkung zusammen.
- Vertikale Verbindungen: Es erfolgt eine Vereinigung mit vor- oder nach-
gelagerten Produktions-/Handelsstufen. Im Vordergrund steht hierbei die Sicherung der Absatz- und Beschaffungsmärkte.
- Diagonale Verbindungen: Unternehmen verschiedener Branchen schließen sich mit dem Ziel zusammen, ihr wirtschaftliches Risiko durch die Diversifikation ihrer Geschäftsbereiche zu reduzieren.
Je nach Intensitätsgrad werden Unternehmensverbindungen in Kooperationen und Konzentrationen unterschieden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Arten von Unternehmungsverbindungen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sterzenbach und Conrady28
Im Rahmen des Luftverkehrs sind folgende wettbewerbspolitische Unternehmensstrategien von übergeordneter Bedeutung: Alleingang, Akquisition und Fusion, Branchen- (d.h. airline-) spezifische Kooperationen sowie strategische Allianzen.
3.2.1Alleingang
Mit der strategischen Wahl des Alleingangs entscheidet sich ein Unternehmen für die autonome Realisierung seiner Geschäftsziele und genießt dabei die größtmögliche wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Marktposition soll durch internes Wachstum gefestigt oder ausgebaut werden, ohne dabei auf externe Synergien zurückzugreifen. Unternehmen, die im relevanten Markt agieren und nach gleichen oder ähnlichen Zielen streben, werden als unmittelbare Konkurrenz betrachtet.29 Die Strategie des Alleingangs ist daher gerade in hart umkämpften Märkten wie dem Luftverkehrsmarkt eine gut zu überlegende und risikoreiche Entscheidung. Neben dem hohen Expansionsdruck ist die Luftverkehrsbranche von einer äußerst hohen Nachfrageelastizität bei gleichzeitig unelastischem Angebot abhängig. Dies wiederum führt nicht selten zu drastischen Umsatzeinbrüchen und Verlusten in Zeiten von wirtschaftlicher Rezession oder politisch-ökonomischen Sondersituationen wie den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001.
Luftverkehrsgesellschaften, die sich für einen strategischen Alleingang entscheiden, leiden nicht selten unter einer schwachen Marktposition, einem Mangel an finanziellen Mitteln um die hohen Fixkosten zu decken, sowie mangelndem Know-how um sich gegenüber ihren Wettbewerbern zu behaupten. Dies führt letztendlich dazu, dass unprofitable Fluggesellschaften ihre Strategiewahl ändern und zur langfristigen Existenzsicherung Unternehmensverbindungen mit ihren Wettbewerbern eingehen. Ein Beispiel hierfür sind die derzeitigen Übernahmeverhandlungen der Austrian Airlines AG (AUA) mit der Deutsche Lufthansa AG. Nachdem die AUA im vergangenen Jahr einen Verlust von über 400 Millionen Euro erlitten hatte, war die Deutsche Lufthansa AG die einzige Airline, die ein bindendes Angebot für die Übernahme abgegeben hatte. Vollzogen wurde der Kauf bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, da die kartellrechtliche Prüfung des Konsolidierungsbestrebens noch nicht abgeschlossen ist.30
Es gibt dennoch in beschränktem Umfang Möglichkeiten, sich in Form einer gezielten Nischenstrategie im Alleingang am Markt zu behaupten.31 Das Geschäftsmodell der Low-Cost-Airlines erweist sich hierbei als äußerst effizient. Eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur, Konzentration auf die Kernleistung („No frills“) sowie strikte Kundenorientierung sind Bestandteil der Low-Cost-Modelle und ermöglichen die Umsetzung der autonomen Unternehmensführung.
Dennoch lässt sich die strategische Entscheidung des Alleingangs als durchaus risikoreich einschätzen und ist daher im internationalen Luftverkehr nur für Nischenanbieter effizient und langfristig erfolgsträchtig.
3.2.2 Akquisition und Fusion
Unter Akquisition versteht man die mehrheitliche oder vollständige Übernahme der Kapitalanteile eines anderen Unternehmens. Die Übernahme kann dabei freundlich, d.h. im gegenseitigen Einverständnis, oder feindlich erfolgen. Das übernommene Unternehmen bleibt weiterhin bestehen, jedoch wird die wirtschaftliche Verfügungsgewalt auf die übernehmende Gesellschaft übertragen.32
Bei der Fusion handelt es sich um die Verschmelzung von mindestens zwei rechtlich selbständigen Unternehmen durch Aufnahme oder Neubildung. Bei der Verschmelzung durch Neubildung geben die Unternehmen ihre Selbständigkeit auf und bilden ein neues Unternehmen. Erfolgt eine Aufnahme, so wird das Vermögen des einen Unternehmens auf das andere übertragen.33 Von allen anderen Formen der Unternehmungszusammenschlüsse unter-scheidet sich die Fusion vor allem dadurch, dass zumindest eine Unternehmung ihre rechtliche Selbständigkeit verliert und eine tatsächliche Rechtseinheit der sich verschmelzenden Unternehmen geschaffen wird.34
Fusionen und Akquisitionen müssen sich dabei an konkreten strategischen und operativen Zielen orientieren wie Expansion, Stärkung der Marktposition sowie
Technologie- und Know-how Transfer.35 Durch den Unternehmenszusammen-schluss lassen sich maximale Synergiepotentiale realisieren, komplementäre Stärken vereinbaren und gleichzeitig die Wettbewerbsintensität reduzieren. Jedoch sind gerade im Luftverkehr derartig irreversible Konzentrationsprozesse mit einem enormen Kapitalbedarf verbunden, der gleichzeitig ein hohes Risiko birgt, wenn erhoffte Rationalisierungsmöglichkeiten und Effizienzsteigerungen nicht erfüllt werden. Grundsätzlich erfordern erfolgreiche Akquisitionen und Fusionen eine intensive Kompatibilitätsanalyse der potentiellen Airline-Partner, das heißt die Unternehmensstrategie, Managementkultur und Finanzstruktur sind gründlich zu untersuchen.36
Internationale Akquisitionen und Fusionen im Luftverkehr spielen erst in letzter Zeit eine gewisse Rolle. Grund hierfür sind die bereits erwähnten Nationalitätenklauseln, welche die meist bilateral vereinbarten Verkehrsrechte an die Nationalität einer Luftverkehrsgesellschaft koppeln. Fluggesellschaften dürfen sich dabei nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz in ausländischem Besitz befinden. In den USA liegt die derzeitige Obergrenze möglicher ausländischer Beteiligungen bei 25%, in der EU hingegen bei 49%, wobei innerhalb der Gemeinschaft keine Nationalitätenklausel gesetzt ist. Auf Grund dieser Restriktionen sind internationale Akquisitionen und Fusionen derzeit noch von geringer Bedeutung, da dies den Verlust von Streckenrechten zur Folge hätte.37 Mit dem am 30. März 2008 in Kraft getretenen Open-Skies-Abkommen zwischen Europa und den USA erhöht sich jedoch Relevanz der Konzentrationsprozesse innerhalb der EU-Staaten, da bedingt durch ein gemeinsames EU-Mandat die Nationalitätenklauseln entfallen und somit die Verkehrsrechte für den umsatzstarken nordamerikanischen Markt erhalten bleiben.
Entsprechend der internationalen Restriktionen lassen sich Unternehmens-zusammenschlüsse insbesondere auf nationalen Märkten beobachten. In Europa waren es insbesondere British Airways, Air France und Lufthansa, die ihre Dominanz auf den Heimatmärkten in den letzten Jahren durch Akquisitionen und Fusionen stärkten. Dass Konzentrationsprozesse dabei nicht immer zum Erfolg führen, zeigt das Beispiel der Swissair. Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie investierte die schweizerische Fluggesellschaft kontinuierlich in sanierungsbedürftige Fluglinien wie Air Liberté, Sabena und LTU, welche neben dem eigentlichen Kaufpreis noch hohe Summen an zusätzlichem Restrukturierungskapital erforderten. Dies wiederum führte zu großen finanziellen Problemen der Swissair und letztlich zum Konkurs der SAir Group.
3.2.3 Airlinespezifische Kooperationen
Der Begriff Kooperation bezeichnet die freiwillige zwischenbetriebliche Zusammenarbeit, wobei die wirtschaftliche Dispositionsfreiheit der Unternehmen auf den von der Kooperation betroffenen Gebieten eingeschränkt wird, während die rechtliche Selbständigkeit gewahrt bleibt.38 Die wesentlichen Ziele einer Kooperation liegen darin, neue Märkte zu erschließen, technisches und wirtschaftliches Know-how gegenseitig zu ergänzen, Größenvorteile zu erzielen, Synergieeffekte zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen bei gleichzeitiger Reduktion des Wettbewerbs zu steigern.
Gerade in hart umkämpften Märkten wie dem Luftverkehrsmarkt sind Kooperationen daher von großer Bedeutung. In Anlehnung an Sterzenbach und Conrady sind dabei technische von kommerziellen Kooperationen zu unterscheiden:39
I. Kooperationen im technischen Bereich
- Handling Agreements: Häufig ist es für Fluggesellschaften ökonomisch nicht sinnvoll, auf einem (ausländischen) Flughafen mit eigenem Equipment und Personal vertreten zu sein. Die Fluggesellschaften beauftragen daher „Handling Agents“ mit der Abfertigung von
[...]
1 http://www.ftd.de/unternehmen/:Verdacht-auf-Wettbewerbsbeschr%E4nkung-Kartelluntersuchung -gegen-Lufthansa/502666.html [22.04.2009]
2 Vgl. http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200806_e.pdf [15.03.2009]
3 Vgl. Pompl, Luftverkehr, 2001, S.1
4 http://www.icao.int/icao/en/jr/2007/6202_en.pdf [15.03.2009]
5 Vgl. http://www.boeing.com/commercial/cmo/ [15.03.2009]
6 http://www.airbus.com/en/corporate/gmf/air-cargo-forecast/large-emerging- markets/ [15.03.2009]
7 Maurer, Luftverkehrsmanagement, 2006, S.1
8 Vgl. Pompl, Luftverkehr, 2001, S.49
9 Vgl. Pompl, Luftverkehr, 2001, S.49-50
10 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.24
11 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.24
12 Vgl. Pompl, Luftverkehr, 2001, S.52
13 Vgl. Pompl, Luftverkehr, 2001, S.55-56
14 Vgl. http://www.boeing.de/ViewContent.do?id=42923&Year=2009&aContent=Boeing% 20erreicht%20wichtiges%20Ziel%20bei%20der%20Umweltzertifizierung [18.03.2009]
15 Vgl. http://www.airbus.com/en/aircraftfamilies/a380/index2.html#2 [18.03.2009]
16 Vgl. Fritzsche, Das europäische Luftverkehrsrecht und die Liberalisierung des transatlan-tischen Luftverkehrmarktes, 2007, S.62
17 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.80
18 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.81-83
19 Vgl. http://www.zeit.de/2008/14/OpenSky?page=all [20.03.2009]
20 Vgl. http://mitarbeiter.fh-heilbronn.de/~fichert/Luftverkehr/ Folien LuftverkehrA.pdf [20.03.2009]
21 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.84
22 Vgl. Pompl, Luftverkehr, 2001, S.387
23 Vgl. http://pages.unibas.ch/wwz/stat/lehre/ss03/riphahn/Thesen3.pdf [21.03.2009]
24 Sturm, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2006, S.91
25 Vgl. Sturm, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2006, S.91
26 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.185
27 Vgl. Sturm, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2006, S.91
28 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.187,193
29 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.185
30 Vgl. http://www.manager- magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,590313,00.html und http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE52K04Y20090321 [22.03.2009]
31 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.186
32 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.186
33 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.187
34 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/fusion-f/fusion-f.htm [22.03.2009]
35 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.187
36 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.188-189
37 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.189
38 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.191
39 Vgl. Sterzenbach und Conrady, Luftverkehr, 2003, S.195-204
- Quote paper
- Linda Schölkmann (Author), 2009, Strategische Allianzen im Luftverkehr am Beispiel der Star Alliance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134971