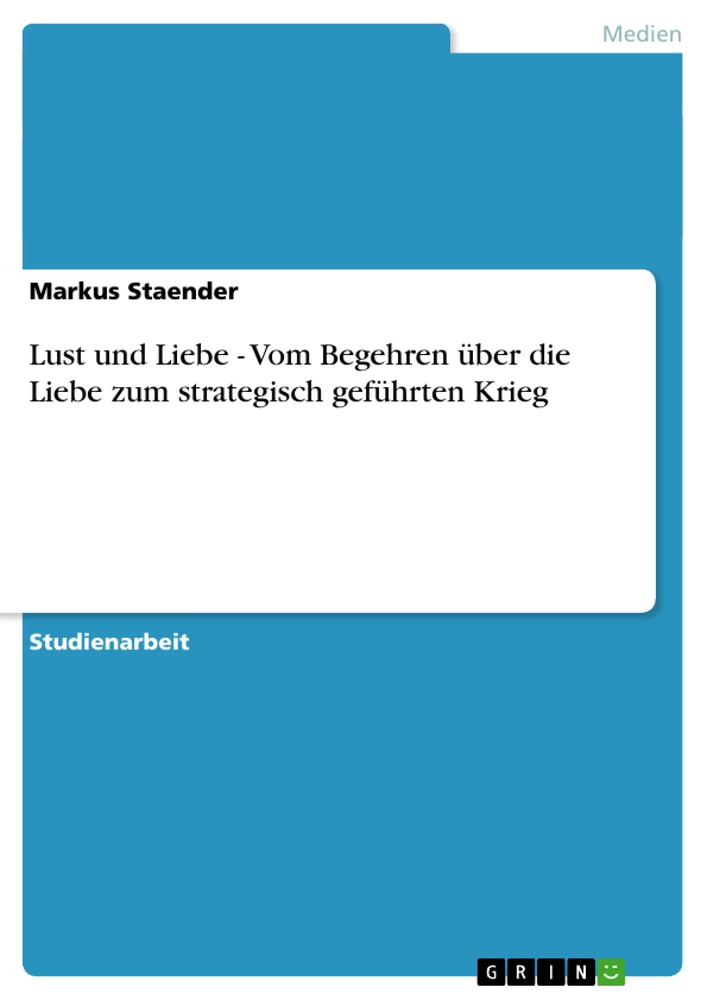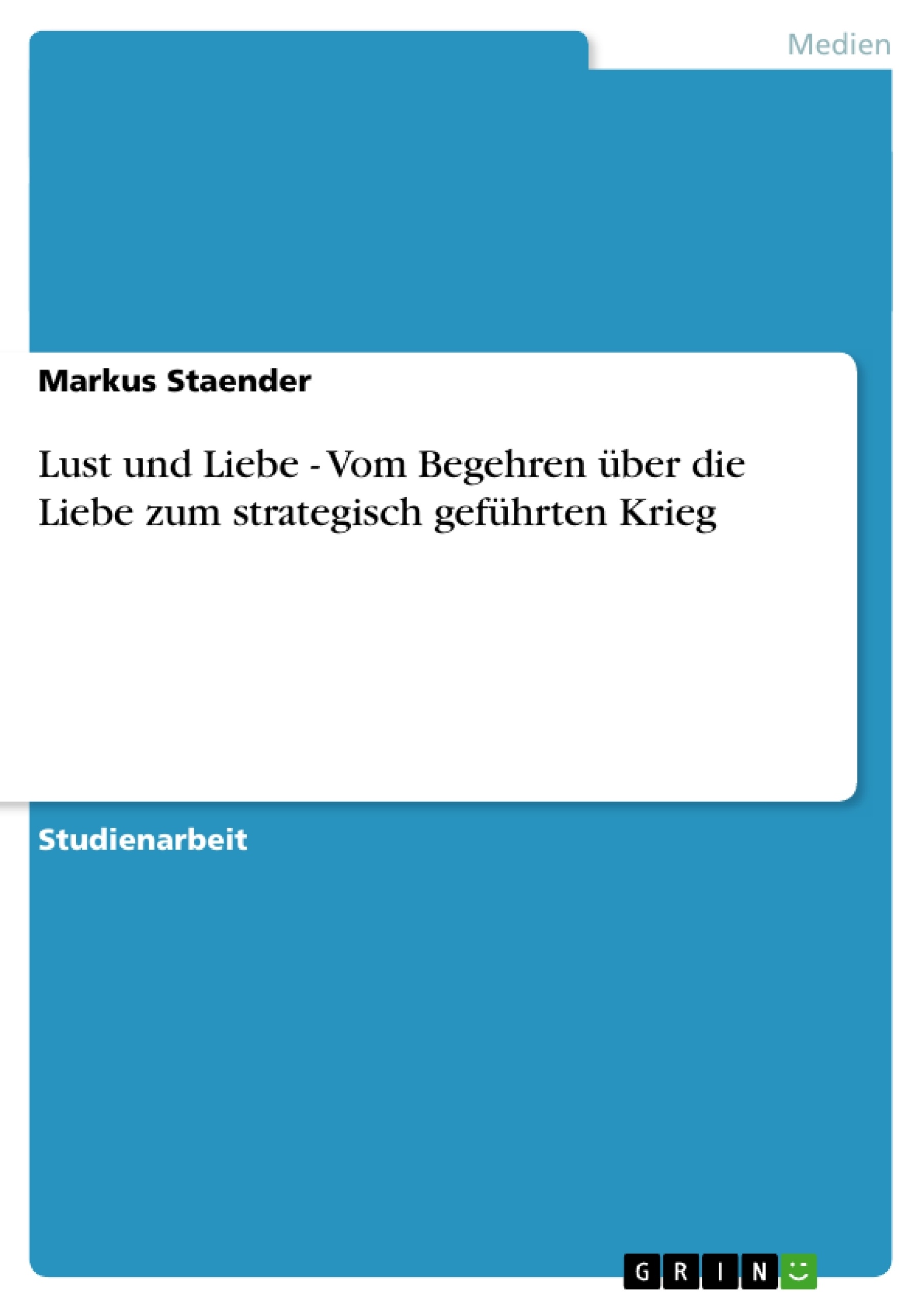Ein Leben ohne Gefühle können wir uns nicht vorstellen. Wir leiden zwar bei Zuständen wie Angst, aber auch Gefühle wie Verliebtheit und Lust können etwas Beunruhigendes haben, wenn sie uns beherrschen. Schon der Sprachgebrauch deutet auf die Macht der Gefühle: sie „ergreifen“ und „packen“ uns. Der Erlebnischarakter ist bei Gefühlen - die typischerweise gegenstandsarm und unpräzise bleiben - stärker als bei der Wahrnehmung und den kognitiven Zuständen. Sie kommen zu den Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gedanken hinzu. Besonders intensiv ist die Verbindung zwischen der Erinnerung und Gefühlen. Gefühle beeinflussen unser Verhalten und gehen mit deutlichen körperlichen Empfindungen einher.
Da die Zuordnung weitestgehend angeboren ist, sind Emotionen in gewissem Maße objektivierbar. So sind etwa der Hautwiderstand und Adrenalinspiegel beim Anblick einer Filmszene messbar. Hinzu kommen natürlich viele sozial vermittelte und auch individuelle Verhaltensweisen: so kann sich etwa Aggressivität hinter einem Lächeln verbergen.
...
I Inhaltsverzeichnis
1 Gefühle
1.1 Begriffsdifferenzierung
1.2 Philosophische Perspektive
1.3 Naturwissenschaftliche Erkenntnisse
2 Gefühle und Verstand
3 Leidenschaft
3.1 Unterschiede zwischen den Geschlechtern
3.2 Homosexualität - Anomalie oder Privileg?
3.3 Sexualverhalten
4 Grundlagen des Begehrens
4.1 Der Geruchssinn als Faktor der Anziehungskraft
4.2 Visuelle Faktoren
4.3 Die Bedeutung des sozialen Rangplatzes
4.4 Neurobiologische Grundlagen der Sexualität
5 Liebe
5.1 Partnerwahlkriterien
5.2 Verliebtheit
5.3 Liebe lernen
5.4 Treue
5.5 Mangel und Gewohnheit
5.6 Bedeutung des Anderen für das körperliche Wohlbefinden
6 Der Krieg der Geschlechter
II Literatur- und Quellenverzeichnis
II Literatur- und Quellenverzeichnis
Bartels, Andreas; Zeki, Semir: Hals über Kopf. In: Gehirn und Geist. Dossier: Bitte mit Gefühl, 01/2007. Spektrum der Wissenschaft, Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 12f
Bierhoff, Hans-Werner: Amors viele Gesichter. In: Gehirn und Geist. Dossier: Bitte mit Gefühl, 01/2007. Spektrum der Wissenschaft, Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 14f
Dawkins, Richard: Das egoistische Gen. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt. 1998
Degen, Rolf: Liebe geht nicht durch das Zwerchfell. In: Gehirn und Geist. Dossier: Bitte mit Gefühl, 01/2007. Spektrum der Wissenschaft, Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 23
Demmerling, Christoph, Landweer, Hilge: Philosophie der Gefühle – Von Achtung bis Zorn. Stuttgart. J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH. 2007
Fisher, Helen: Schluss aus und vorbei. In: Gehirn und Geist. Dossier: Bitte mit Gefühl, 01/2007. Spektrum der Wissenschaft, Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 20f
Hansen, Dörte: Wenn das Leben zur Qual wird. In: P.M. Perspektive - Liebe, Lust und Leidenschaft. 03/2007. Gruner+Jahr AG & Co KG. Hamburg. S. 64f
Hauptmeier, Carsten: Für immer und ewig? In: P.M. Perspektive - Liebe, Lust und Leidenschaft. 03/2007. Gruner+Jahr AG & Co KG. Hamburg. S. 22f
Kleinschmidt, Carola: Wo die Liebe hinfällt. In: P.M. Perspektive - Liebe, Lust und Leidenschaft. 03/2007. Gruner+Jahr AG & Co KG. Hamburg. S.
Leiber, Theodor: Glück, Moral und Liebe – Perspektiven der Lebenskunst. Würzburg. Königshausen & Neumann. 2006
Nommensen, Merret: Was die Stimmung prickeln lässt. In: P.M. Perspektive - Liebe, Lust und Leidenschaft. 03/2007. Gruner+Jahr AG & Co KG. Hamburg. S. 54f
Roth, Gerhard: Fühlen, Denke, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Suhrkamp Taschenbuch.
Rullmann, Marit; Schlegel, Werner: Frauen denken anders – Philo-Sophias 1x1. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 2001
Schmidt, Walter: Erotik als Werkzeug der Werber. In: P.M. Perspektive - Liebe, Lust und Leidenschaft. 03/2007. Gruner+Jahr AG & Co KG. Hamburg. S. 21
Schwarting, Rainer: Qullen des Verlangens. In: Gehirn und Geist. Dossier: Bitte mit Gefühl, 01/2007. Spektrum der Wissenschaft, Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 6f
Vincent, Jean-Didier: Biologie des Begehrens. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt. 1990
1 Gefühle
Ein Leben ohne Gefühle können wir uns nicht vorstellen. Wir leiden zwar bei Zuständen wie Angst, aber auch Gefühle wie Verliebtheit und Lust können etwas Beunruhigendes haben, wenn sie uns beherrschen. Schon der Sprachgebrauch deutet auf die Macht der Gefühle: sie „ergreifen“ und „packen“ uns. Der Erlebnischarakter ist bei Gefühlen - die typischerweise gegenstandsarm und unpräzise bleiben - stärker als bei der Wahrnehmung und den kognitiven Zuständen.[1] Sie kommen zu den Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gedanken hinzu. Besonders intensiv ist die Verbindung zwischen der Erinnerung und Gefühlen. Gefühle beeinflussen unser Verhalten und gehen mit deutlichen körperlichen Empfindungen einher.
Da die Zuordnung weitestgehend angeboren ist, sind Emotionen in gewissem Maße objektivierbar. So sind etwa der Hautwiderstand und Adrenalinspiegel beim Anblick einer Filmszene messbar.[2] Hinzu kommen natürlich viele sozial vermittelte und auch individuelle Verhaltensweisen: so kann sich etwa Aggressivität hinter einem Lächeln verbergen.
1.1 Begriffsdifferenzierung
Die Leidenschaften sind alles, „was das Tier oder der Mensch - im Sinne der Leideform, des Passivs – erleidet“.[3] Damit wären sie der Betätigung unserer Willenskräfte entgegengesetzt. Der Begriff der Leidenschaften wurde mit der Zeit durch den Begriff der Emotionen ersetzt: dieser beinhaltet die Vorstellung der Bewegung (movere) und geht auf Descartes zurück.
Doch Emotionen sind komplexe Zustände, die nicht allein durch Gefühle beschrieben werden können.[4] Heute bezeichnet Leidenschaft ein starkes Gefühl, das einem anderen Menschen gilt - das aus Liebe oder wegen sexueller Anziehung empfunden wird -, oder auf irgendein Objekt gerichtet ist, das uns vollständig gefangen nimmt.
1.2 Philosophische Perspektive
Die philosophische Tradition sah Gefühle lange Zeit als etwas Schlechtes: schon Platon übte - noch schärfer als Aristoteles - Kritik: es gäbe drei Seelenbegehren: die Begierden, Mut und die Vernunft. Das Geschlecht der Begierden sei von den beiden anderen im Zaum zu halten. Die Lust sei „des Schlechten stärkster Köder“.[5]
Nach Leibniz werden wir durch Gefühle „verdunkelt und unvollkommen“.[6]
Die Philosophie des 18. Jahrhunderts mit ihrer Betonung des Sinnlichen sieht Gefühle als etwas Positives. Für Kant waren sie „subjektive Urteile“ in Form von „Wohlgefallen“ oder „Missfallen“. Für Gefühle im Sinn der Leidenschaften zeigte er jedoch Verachtung: sie würden das ethische Urteil trüben. Nach Freud war das Unbewusste Ort der wilden Triebe, die den Instinkten der Tiere vergleichbar sind. Er forderte: „Es muss Ich werden“.[7]
1.3 Naturwissenschaftliche Erkenntnisse
Emotionale Zustände waren lange kein vorrangiger Gegenstand der Neurowissenschaften, da man die Gefühle im Hirnstamm ansiedelte. Was den Menschen allerdings auszeichne, sei der Neocortex, der Ort „höchster Hirnleistungen“, die eben kognitiver Art seien.[8]
Paul MacLeans Modell der „Drei Gehirne“ hatte hier erheblichen Einfluss ausgeübt: es gäbe ein Reptiliengehirn, ein frühes Säugetiergehirn und ein entwickeltes Säugergehirn: zwischen dem limbischen System und dem Neocortex würden nur wenige Verbindungen existieren. Deshalb sei es so schwer, Gefühle rational zu kontrollieren. Dieses Modell erwies sich später als falsch.
Eine bemerkenswerte Beobachtung lies sich bei Störungen des limbischen Systems bei menschlichen Patienten machen, insbesondere bei Schädigungen des Stirnlappens und der Amygdala. Der Verlust dieser Zentren lässt Menschen nicht nur ihre Gefühle verlieren: bekannte Gefahren werden nicht mehr gemieden, obwohl die Personen teilweise in der Lage sind, ihr Fehlverhalten zu beschreiben. Die Ironie an der Sache: das, was viele Philosophen gefordert hatten, nämlich die Gefühle zu unterdrücken, endete hier gerade in unvernünftigem Verhalten.
Gefühle haben ganz schlicht auch eine hohe biologische Bedeutung: sie sind mit körperlich-vegetativen Zuständen verbunden und haben damit Signalwirkung, um das Überleben zu sichern. Sie greifen motivierend in die bewusste Verhaltensplanung ein, indem sie bestimmte Verhaltensweisen befördern. Genauso unterdrücken sie aus Furcht oder Abneigung andere. Wir sehen also: „Ohne emotionalen Impulse keine Aktionen!“[9]
2 Gefühle und Verstand
Nach Thomas von Aquin leide der Mensch „unter dem Gegensatz zwischen dem Begehren der Vernunft, in dem sich der Wille manifestiere, und dem der Sinne, die den menschlichen Leidenschaften unterworfen seien“.[10] Steht der blinde Instinkt des Tieres tatsächlich in so krassem Gegensatz zur bewussten Intelligenz des Menschen? Instinkt und Vernunft sind keineswegs unvereinbar. Nach La Chambre seien allen Regungen des Begehrens zwei Urteile vorgeschaltet.[11] Erstens, die Erkenntnis, dass das Vorhaben gut, zweitens, dass es dass machbar. Dies kommt dem nahe, was heute mit den kognitiven Funktionen gemeint ist. „Ebenso wie das Computer-Gehirn ist auch das humorale Gehirn Opfer und Täter zugleich, einerseits von den Leidenschaften gebeuteltes Objekt und andererseits Organisator der eigenen Leidenschaft“.[12]
Emotionale Zustände sind Leistungen des limbischen Systems. Dieses ist hierarchisch strukturiert: auf der untersten Ebene liegen die Zentren für elementare, affektive Zustände. Sie sind der Ursprung vegetativer Reaktionen und der damit verbundenen emotionalen Zustände. Diese Ebene ist schwer bewusst zu steuern und macht zum großen Teil unsere Persönlichkeit aus. Ihre Grundzüge entstehen sehr früh, sind zum großen Teil angeboren. Die Zentren auf der mittleren Ebene der emotionalen Konditionierung, die bereits im Mutterleib arbeiten, können wir in Grenzen erfahrungsabhängig kontrollieren. Wir bewerten alles, was der Körper tut, nach den Konsequenzen und speichern dies im unbewussten emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Die größte Bedeutung hat diese Ebene in der Zeit nach der Geburt, in der besonders intensiv empfunden und bewertet wird. Das emotionale Gedächtnis lernt relativ langsam, aber nachhaltig.
Die oberste, bewusstseinsfähige Ebene für Bewertungen, die auf Wahrnehmung und autobiographischen Gedächtnisinhalten beruhen, wird durch die Erziehung stark beeinflusst und hat meist Moralvorstellungen als Ergebnis. Sie wird massiv durch die untere und mittlere Ebene beeinflusst. Einem konstitutionell oder aufgrund frühkindlicher Konditionierung ängstlichen Menschen wird die bewusste Kontrolle „von oben nach unten“ nur beschränkt möglich sein: die Langsamkeit des emotionalen Umlernens ähnelt dem impliziten, subcortikal vermittelten Lernen, wie z. B. von Fahrradfahren. Selbst wenn es bewusst erfahren wird, läuft es hauptsächlich subcortikal-implizit ab. Gefühle beherrschen also eher den Verstand als umgekehrt. Das ist auch gut so, denn unsere konditionierten Gefühle sind konzentrierte Lebenserfahrung. Ohne sie wären wir rein passive Wesen.[13]
Das Bewusstsein auf der anderen Seite ist wichtig, wenn noch keine Vorgaben im Gedächtnis abgespeichert sind und bei langfristigen Planungen. Da hier viele Gesichtspunkte und Erfahrungen miteinander kombiniert werden müssen, benötigt das Gehirn die Ebene der Verhaltenssteuerung.
„Zur Bewertung gehört das affektiv-emotionale, relativ detailarme Erfassen der gegenwärtigen Situation und der Vergleich mit dem emotionalen Gedächtnis. Dies wird begleitet vom mehr oder weniger unemotionalen detaillierten Erfassen der Sachlage mithilfe des cortico-hippocampalen Systems“.[14] Beim Abwägen der Konsequenzen kann die cortikale Aktivität die subcortikalen Antriebe unterstützen oder ihnen widersprechen. Der orbitofrontale Cortex hat eine vornehmend hemmende Wirkung auf die Amygdala. Je größer die Bedeutung des anstehenden Problems, desto wahrscheinlicher wird sich das emotionale Gedächtnis durchsetzen. Die Aufmerksamkeitssteuerung ist ein wichtiger Teil des Bewertungssystems. Ängstliche Menschen etwa wenden ihre Aufmerksamkeit oft einfach bevorzugt dem Negativen zu.
Der gerne erhobene Vorwurf des Reduktionismus zeigt seine Berechtigung, wenn man bedenkt, dass es reicht einem Schizophrenen einige Gramm eines Neuroleptikums zu verabreichen, um ihn in „einen nutzlosen Automaten“ zu verwandeln. Die großartige Maschine Mensch scheint plötzlich arg auf ihre körperliche Manifestation reduzierbar.[15]
Der Dualist Claude Bernard postulierte hingegen: „Man wird die Manifestationen unserer Seele ebenso wenig auf die groben Eigenschaften der Nervenapparate zurückführen können, wie man die wunderbaren Melodien verstehen kann, wenn man nur die Eigenschaften des Geigenholzes und der Saiten betrachtet“.[16] Auch sei der Versuch, die geistigen Funktionen in genau bestimmten Gehirnregionen zu verorten nicht mit Descartes Vorstellung des nicht räumlichen Denkens zu vereinen (Riese). Analog betonte Spinoza die Eigenständigkeit der beiden Ereignisketten. Die Lokalisierung der Gehirntätigkeit führte jedoch schließlich zur Vorstellung eines Parallelismus von Psyche und Körper.
3 Leidenschaft
„warum flöten Sie mir ständig vor, nur die Seele und die moralischen Qualitäten zählten“ (Albert Cohen: Die Schöne des Herrn)?[17]
Vielleicht ist der Weg von den Begierden zu dem was andere Liebe nennen gar nicht so weit. Oder ist es anders herum? „Alle diese Bewegungen, die unsere Seele beunruhigen, sind nichts als Verstellungen der Liebe - unsere Ängste und Wünsche, unsere Hoffnungen und Verzweiflungen, unsere Freuden und Schmerzen sind die verschiedenen Gesichter, die die Liebe annimmt, je nach dem Erfolg und Misserfolg, der ihr zuteil wird“ (Pater Sénault).[18]
Liebe ist ein Zustand, der eine Stunde oder eine Ewigkeit dauern kann. Das besondere an der erotischen Liebe ist, dass sie „die Regungen der Seele und den Drang des Fleisches“ in krassester Form verbindet. Sie ist ein Verschmelzungszustand, in dem sich „die Totalität des Geschöpfes“,[19] das „Prinzip des Einsseins im Anderssein“ verwirklicht.[20]
3.1 Unterschiede zwischen den Geschlechtern
Das Anderssein der Geschlechter zeigt sich hauptsächlich im körperlichen Erscheinungsbild und dem Verhalten. Es muss erstaunen, wie gering der Unterschied zwischen den jeweiligen Gehirnen ist. Das männliche Gehirn zeichnet sich durch einen kleinen Hypothalamuskern aus, „einige Neuronen, die Vasopressin enthalten, etwa hundert Gramm Gehirnsubstanz, eine möglicherweise ungleichmäßige Entwicklung der Gehirnhälften“.[21]
Außerdem ist der Gewichtsunterschied zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte bei der Frau weniger ausgeprägt (J. Crichton-Browne). Die Frau kann höhere sprachliche Fähigkeiten vorweisen, der Mann eine bessere räumliche Wahrnehmung. Es ist jedoch zu bedenken, dass es sich dabei nur um winzige statistische Schwankungen handelt. Die Zentren, die das jeweilige Sexualverhalten steuern, liegen beide im Hypothalamus.
Eine Applikation von Östradiol bei einer männlichen kastrierten Ratte ruft weibliches Verhalten hervor.[22] Das Gehirn bevorzugt nach der perinatalen Geschlechtsdifferenzierung normalerweise das männliche oder weibliche Zentrum. Das männliche Zentrum liegt bei der Ratte im präoptischen Feld. Dieses gehört zu einem Komplex, der am Annäherungsverhalten und der Selbststimulation beteiligt ist und die Lustseite repräsentiert. Das weibliche Zentrum liegt im ventromedianen Hypothalamus und gehört zu einem Komplex, der an den sympathischen Funktionen und am Flucht- beziehungsweise Aversionsverhalten beteiligt sein soll.[23]
Wenn das Weibchen sich also gerade nicht im Zustand der Rezeptivität befindet, empfindet es vom Männchen ausgehende Reize als aversiv. Östradiol und Progesteron wirken dieser Haltung entgegen.
3.2 Homosexualität - Anomalie oder Privileg?
Homosexualität ist eine sexuelle Orientierung, die durch Ereignisse in den Neuronen des Subjekts genauso wie durch Ereignisse in seiner kulturellen Umgebung beeinflusst wird. Man muss unterscheiden zwischen einer atypischen sexuellen Orientierung und einer Störung der sexuellen Differenzierung. Letztere führt zu einem sexuellen Diphormismus, der das körperliche Erscheinungsbild ebenso wie bestimmte Verhaltensweisen erfasst.[24] Eine anomale Geschlechtsdifferenzierung hat derweil nicht unbedingt eine atypische sexuelle Orientierung zur Folge.
Der vordere Hypothalamus ist zentral für die Geschlechtspräferenz. Homosexuelle Männer haben dort weniger Neurone als heterosexuelle, ihre Gehirne sind so gesehen „weiblicher“.[25] In einer Stichprobe von einhundert männlichen Homosexuellen war die Zahl derer, bei denen die Mutter in der Schwangerschaft ein traumatisches Erlebnis gehabt hat, größer als in einer Vergleichsgruppe (Dörner).[26] Homosexualität sei somit Ausdruck einer anomalen Verhaltensdifferenzierung und gehe auf eine unzureichende Testosteronsekretion bei Föten und Neugeborenen zurück. Ein Merkmal des männlichen Homosexuellen ist nach neueren Erkenntnissen jedoch oft ein Übermaß an Maskulinität und nicht umgekehrt.
Beim Menschen kommt noch der Aspekt der Geschlechtsidentität hinzu (J. Money). Sie wird in den ersten Lebensjahren parallel zum Spracherwerb gebildet und ist fast ausschließlich den Erziehungseinflüssen der Eltern unterworfen. Sie sei einem Menschen folglich von seinem Umfeld zugewiesen. Zu Homosexualität kommt es durch ein Zusammenwirken von Erbanlagen, hormonellen Faktoren und auch individuellen Erfahrungen.
[...]
[1] Roth, S. 285
[2] Roth, S. 286
[3] Vincent, S. 15
[4] Schwarting, S. 10
[5] Roth, S. 288
[6] Roth, S. 287
[7] Roth, S. 288
[8] Roth, S. 289
[9] Roth, S. 291
[10] Vincent, S. 13
[11] Vincent, S. 14
[12] Vincent, S. 20
[13] Roth, S. 375
[14] Roth, S. 376
[15] Vincent, S. 18
[16] Vincent, S. 17
[17] Vincent, S. 297
[18] Vincent, S. 16
[19] Vincent, S. 298
[20] Vincent, S. 299
[21] Vincent, S. 338
[22] Vincent, S. 336
[23] Vincent, S. 340
[24] Vincent, S. 342
[25] Schwarting, S. 7
[26] Vincent, S. 343
- Quote paper
- Markus Staender (Author), 2007, Lust und Liebe - Vom Begehren über die Liebe zum strategisch geführten Krieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134947