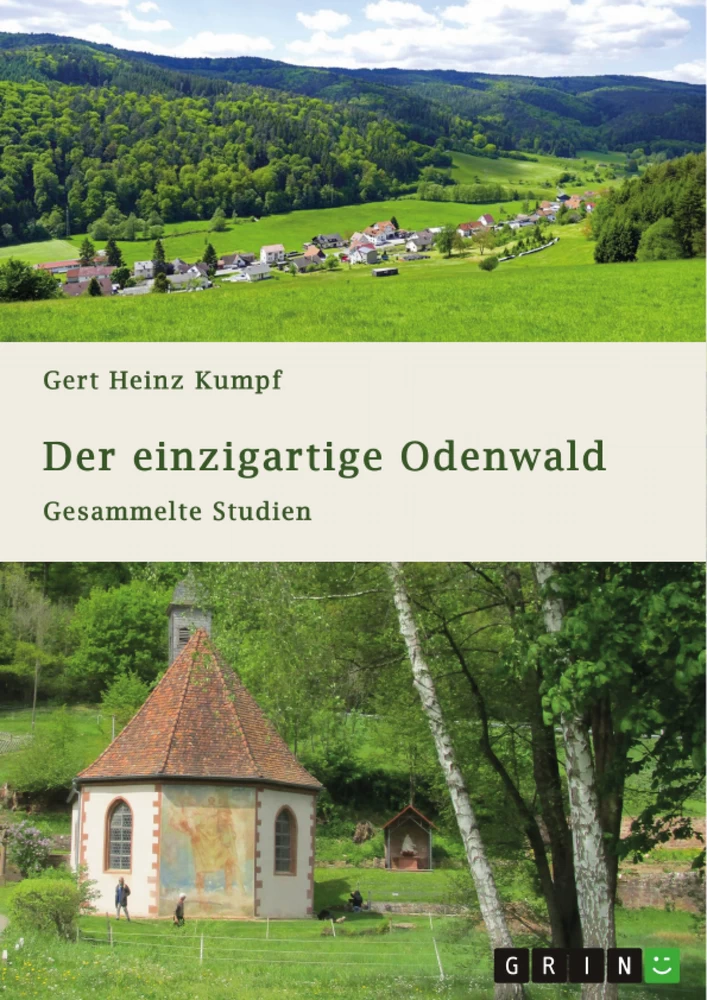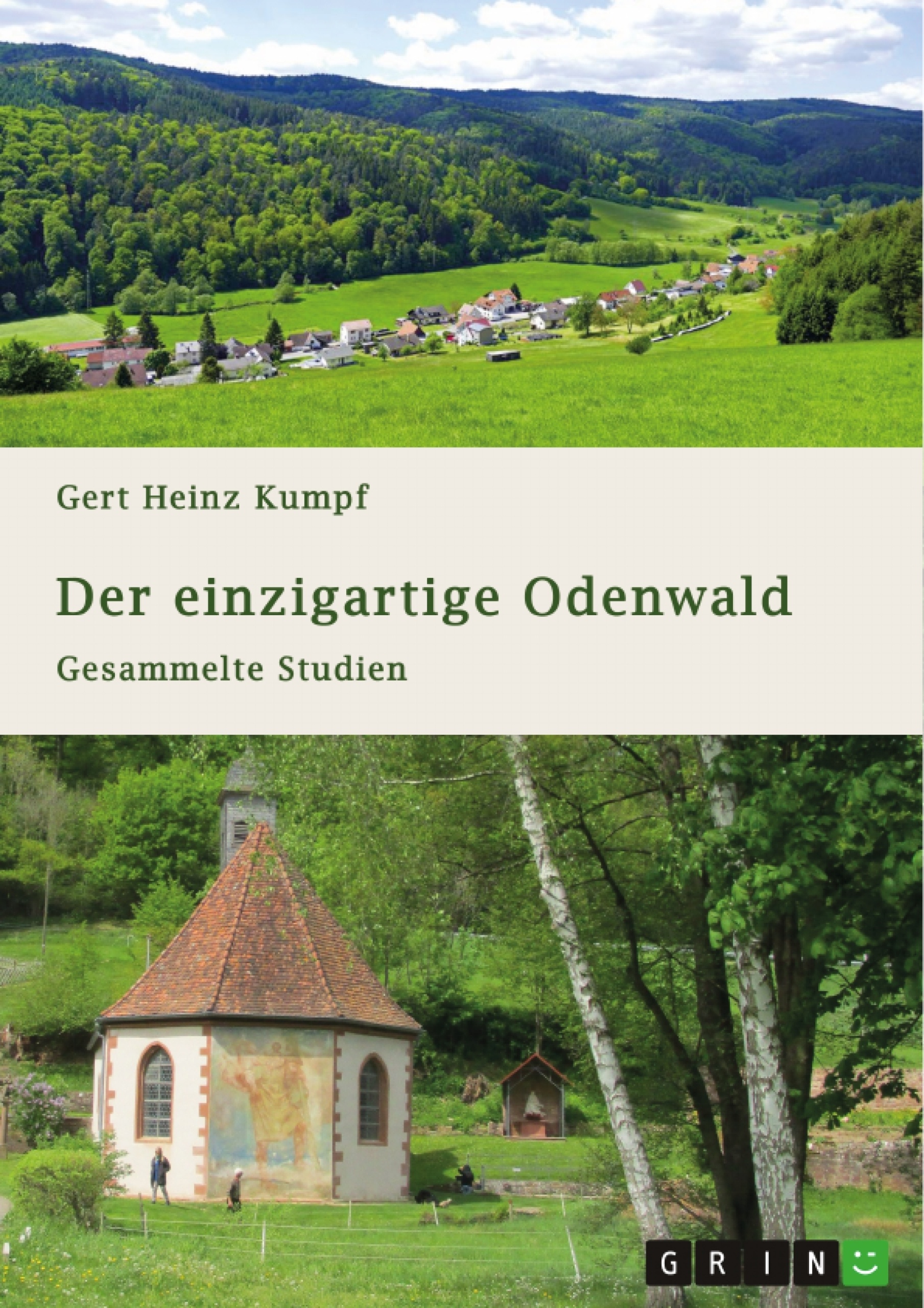Der Odenwald ist in der Schönheit seiner Wälder, Höhen, Täler und Hänge ein einzigartiges Gebirge. Jedes Tal hat seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Über viele Kilometer kann man durch einsame, ursprüngliche Buchen-Eichen-Mischwälder streifen, mit dem sauberen roten Sand unter seinen Füßen, und an glasklaren Quellen trinken.
Der Autor legt hier die gesammelten Studien seines Heimatgebirges vor. In insgesamt neun Schriften hat er sich unter verschiedenen Aspekten mit diesem Gebirgsjuwel beschäftigt. Acht dieser Schriften werden hier vorgelegt. Die Studien beginnen mit der Geographie, werden mit der Geschichte fortgesetzt und schwenken dann zur Sagenwelt, um schließlich die immer noch unerklärlichen Namen des Odenwaldes und seiner einzigen Großstadt Heidelberg kulturgeschichtlich zu durchleuchten.
Die folgenden acht Bücher sind hier zusammengefasst: „Der Odenwald ungeteilt und einzigartig. Geographische Analysen zu Abgrenzung, Entstehung, Großlandschaften, Limes, Talsystemen und Gewässernamen des Gebirges“ von 2021, „Historische Studien im Odenwald. 18 Untersuchungen von der Jungsteinzeit über fränkische Landnahme, Kolonisation der Klöster, Zenten, Bauernkrieg und Reichskreis bis zur Grafschaft Erbach“ von 2022, diese Studien wiederum sind eine überarbeitete Fassung der Texte „Der Odenwald wird besiedelt“ von 2021 und „Der Odenwald mit Zenten und Grafen“ von 2021; es folgen „Sagenkreise und Nibelungenorte im Odenwald. Eine mythologische Spurensuche“ von 2022 und „Die Nibelungensage im Home-Office. Thesen zur Sage und Protokoll einer Unterrichtseinheit zu Zeiten der Pandemie (Gymnasium Deutsch, Klasse 7) von 2020; und schließlich noch „Zum Namen der Stadt Heidelberg. Forschungen unter Einbezug von Geographie und Kulturgeschichte“ von 2023 und „Der Name des Odenwaldes. Von Odin zur Wassermutter“ von 2023.
Nicht in dieses Kompendium aufgenommen, dem Leser aber trotzdem wärmstens empfohlen, ist die kulturwissenschaftliche Forschungsarbeit „Kultplätze und heilige Berge im Odenwald. Eine matriarchale Spurensuche“, die 2023 im Kohlhammer Verlag Stuttgart erschienen ist.
Inhaltsverzeichnis
- A) Geographie und Talsysteme
- 1. Ein touristisch und politisch geteiltes Gebirge
- 2. Die Landschaftsgrenzen des Odenwaldes
- a) Westliche Landschaftsgrenze Oberrheintalebene
- b) Nördliche Landschaftsgrenze Rhein-Main-Tiefland
- c) Östliche Landschaftsgrenze Main und Bauland
- d) Südliche Landschaftsgrenze Kraichgau
- 3. Geologischer Aufbau oder Entstehung
- a) Variskisches Gebirge
- b) Paläo- und mesozoische Ablagerungen
- c) Einbruch des Oberrheingrabens
- d) Herausbildung der Schichtstufenlandschaft
- e) Flussgeschichte von Main und Neckar
- f) Pleistozäne Überformung der Landschaft
- 4. Die Großlandschaften des Gebirges
- a) Kristalliner oder Vorderer Odenwald
- b) Schichtstufe des Buntsandstein-Deckgebirges
- c) Zertalter oder Mittlerer Odenwald
- d) Hochflächen- oder Hinterer Odenwald
- e) Durchbruchstal des Neckars
- f) Kleiner Odenwald
- 5. Der römische Odenwald-Limes
- 6. Die großen Talsysteme im Odenwald
- a) Hydrologische Grundstrukturen
- b) Drei Tal-Landschaften zum Rhein
- c) Vier Tal-Landschaften zum Main
- d) Sieben Tal-Landschaften zum Neckar
- e) Quellenreichtum an der Bergstraße und kleinere Zuflüsse zu Main und Neckar
- B) Besiedlung und Herrschaftsanfänge
- 1. Erste Besiedlungsspuren im Rhein-Main-Gebiet
- a) Bandkeramische Bauern der Jungsteinzeit
- b) Kelten und Wanderung der Kimbern
- c) Römer und Alemannen
- 2. Landnahme der Franken im Odenwaldraum
- a) Fränkische Besiedlung ab 496 n. Chr.
- b) Fränkische Gaue und Gaugrafen
- c) Fränkische Königshöfe und Martinskirchen
- 3. Waldmarken des Odenwaldes
- 4. Organisation der Odenwald-Besiedlung
- a) Siedlungsträger und Rodungsperioden
- b) Benediktinischer Geist und Siedler
- c) Villikationen und Waldhufendörfer
- 5. Kolonisation des Benediktinerklosters Lorsch
- 6. Kolonisation des Benediktinerklosters Amorbach
- 7. Siedlungsträger im nördlichen Odenwald
- 8. Siedlungsträger im südlichen Odenwald
- 9. Beispiel einer Villikation: Beerfelden
- 10. Beispiele angelegter Waldhufendörfer
- 11. Herrschaftsanfänge im Odenwald
- a) Fränkischer Königshof, Sankt Michael
- b) Einhard erhält die Mark Micheklstadt
- 12. Die Schenken von Erbach
- a) Ihre Herkunft; Klostervögte von Lorsch
- b) Burg Erbach und Burgmannensiedlung
- 13. Die Zentverwaltung im Odenwald
- a) Zentgraf und Gerichtsmänner
- b) Die sechs Aufgabenbereiche der Zent
- 14. Der Bauernkrieg im Odenwald
- a) Schenk Eberhard XIII. im Bauernkrieg 1525
- b) Ein Gerichtstag im Schlosshof zu Erbach
- 15. Die Entstehung der Grafschaft Erbach
- 16. Der Odenwald im Fränkischen Reichskreis
- 17. Napoleon gestaltet den Odenwald um
- 18. Reaktion der Odenwälder auf die neuen Herren aus Hessen
- C) Sagenkreise und Nibelungenlied
- 1. Lokalsagen
- 2. Wasserfräulein
- 3. Wilde Frauen
- 4. Weiße Frauen
- 5. Karte: Mystische Frauensagen im Odenwald
- 6. Orte literarisch bearbeiteter Sagenstoffe
- a) Einhard und Imma
- b) Der Rodensteiner und das Wilde Heer
- 7. Das Nibelungenlied
- a) Gotischer, hunnischer und burgundischer Sagenkreis und die uralte Sage um Siegfried
- b) Geschichtlicher Hintergrund der Sagenhandlung
- c) Die Handschriften A, C, B und Thidrekssaga
- d) Der Name ‚Nibelungen‘ und tatsächliche Lokalitäten
- 8. Nibelungenorte im Odenwald
- a) Siegfried der Drachentöter und die Linde
- b) Siegfried als Jäger und Bärenfänger
- c) Ermordung Siegfrieds an der Odenwaldquelle
- d) Siegfrieds Grab: Worms oder Lorsch?
- e) Der Odenwald als Nibelungenland
- 9. Neue Thesen zur Nibelungensage
- 10. Die Nibelungensage im Unterricht des Gymnasiums
- D) Namenkunde und Quellheiligtümer
- 1. Im Namen entfaltet sich Kulturgeschichte
- 2. Bisherige Erklärungen des Namens Heidelberg
- 3. Drei Wege zu einer neuen Sicht
- a) Geographische Lage, Siedlungsanfänge und Raumanalyse
- b) Sprachuntersuchung des Bestimmungsworts ‚Heidel‘
- c) Namenswechsel durch christliche Mission im Frühmittelalter
- 4. Heidelberg als ‚Siedlung beim Heidenberg‘
- 5. Bisheriges zum Namen des Odenwalds
- 6. Die Bedeutung ‚Odin geweihter Wald‘
- 7. Der matriarchale Ursprung im Namen
- 8. Quellheiligtümer im Odenwald
- 9. Indoeuropäisierung Alteuropas
- 10. Der Odenwald ein ‚Quellenwald‘
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit präsentiert eine umfassende Vorschau auf das Werk "Der einzigartige Odenwald". Ziel ist es, die geographischen, historischen und mythologischen Aspekte des Odenwaldes in einer strukturierten und prägnanten Weise darzustellen, ohne dabei die Hauptargumente und Schlussfolgerungen des Gesamtwerks vorwegzunehmen.
- Geographische Abgrenzung und Entstehung des Odenwaldes
- Historische Entwicklung der Besiedlung und Herrschaftsstrukturen
- Mythologische Bedeutung und Sagenlandschaft des Odenwaldes
- Etymologische Analyse der Odenwald- und Heidelberger Namensgebung
- Bedeutung von Quellheiligtümern und matriarchalen Spuren
Zusammenfassung der Kapitel
A) Geographie und Talsysteme: Diese Studie bietet eine umfassende geographische Analyse des Odenwaldes, beginnt mit einer Kritik an der touristischen und politischen Zersplitterung des Gebirges und erarbeitet eine präzise orographische Abgrenzung. Die Entstehung des Odenwaldes wird anhand geologischer Prozesse detailliert beschrieben, von der variskischen Gebirgsbildung bis zur pleistozänen Überformung. Der Odenwald wird in sechs Großlandschaften unterteilt (kristalliner Odenwald, Buntsandstein-Schichtstufe, Mittlerer Odenwald, Hinterer Odenwald, Neckardurchbruchstal, Kleiner Odenwald), deren geomorphologische und hydrologische Besonderheiten ausführlich erläutert werden. Abschließend werden die einzigartigen Talsysteme des Odenwaldes mit ihren hydrologischen Strukturen und den Flüssen untersucht, die in Rhein, Main und Neckar münden.
B) Besiedlung und Herrschaftsanfänge: Dieser Teil der Studie untersucht die Besiedlungsgeschichte des Odenwaldes, beginnend mit frühen Spuren im Rhein-Main-Gebiet (Jungsteinzeit, Kelten, Römer, Alemannen). Die fränkische Landnahme und die Rolle der Klöster Lorsch und Amorbach bei der Kolonisation werden detailliert analysiert. Die Organisation der Odenwaldsiedlung, Villikationen und Waldhufendörfer werden anhand von Beispielen erläutert. Die Studie beleuchtet auch Herrschaftsanfänge im Odenwald (fränkischer Königshof, Einhard, Schenken von Erbach), die Zentverwaltung und den Odenwald im Bauernkrieg und Fränkischen Reichskreis. Die Auswirkungen der napoleonischen Zeit und die Reaktionen der Odenwälder Bevölkerung werden ebenfalls behandelt.
C) Sagenkreise und Nibelungenlied: Diese Arbeit erforscht die mythologische Landschaft des Odenwaldes, beginnend mit Lokalsagen, bevor sie sich ausführlich mit den Sagen um Wasserfräulein, Wilde Frauen und Weiße Frauen befasst. Dabei werden die literarischen Bearbeitungen dieser Sagenstoffe analysiert und deren Bezug zum matriarchalen Ursprung untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Nibelungenorten im Odenwald, mit einer tiefgreifenden Analyse des Nibelungenliedes, seiner historischen Hintergründe und der Frage nach den tatsächlichen Lokalitäten. Dabei werden die verschiedenen Handschriften des Nibelungenlieds und die These eines möglichen Tatorts in Hiltersklingen diskutiert.
D) Namenkunde und Quellheiligtümer: Dieser Teil der Studie widmet sich der Namensgebung von Heidelberg und dem Odenwald. Er untersucht bisherige Erklärungen des Namens Heidelberg und präsentiert einen neuen Ansatz, der geographische, sprachliche und kulturgeschichtliche Aspekte berücksichtigt. Die Bedeutung des Namens Odenwald wird ebenfalls kritisch hinterfragt, mit einer detaillierten Auseinandersetzung mit verschiedenen Deutungsversuchen und einer Schlussfolgerung basierend auf der Rolle Odins und der matriarchalen Wurzeln der Namensgebung. Die Studie schließt mit einer Betrachtung der Quellheiligtümer im Odenwald und deren Verbindung zur keltischen und vor-indoeuropäischen Kultur.
Schlüsselwörter
Odenwald, Geographie, Geologie, Besiedlung, Franken, Klöster Lorsch und Amorbach, Zent, Bauernkrieg, Grafschaft Erbach, Sagen, Nibelungenlied, Siegfried, Kriemhild, Heidelberg, Namenkunde, Quellheiligtümer, Matriarchat, Indoeuropäisierung, Wassermutter Dana, Odin.
Häufig gestellte Fragen zu "Der einzigartige Odenwald" - Inhaltsübersicht
Was ist der Gegenstand dieser umfassenden Vorschau?
Diese Vorschau präsentiert eine strukturierte und prägnante Zusammenfassung des Werks "Der einzigartige Odenwald". Sie beinhaltet Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter, um einen Überblick über die geographischen, historischen und mythologischen Aspekte des Odenwaldes zu geben, ohne den Hauptinhalt vorwegzunehmen.
Welche geographischen Aspekte werden behandelt?
Der geographische Teil umfasst die Abgrenzung des Odenwaldes, eine Kritik an der touristischen und politischen Zersplitterung, die detaillierte Beschreibung seiner geologischen Entstehung (von der variskischen Gebirgsbildung bis zur pleistozänen Überformung), die Einteilung in sechs Großlandschaften (kristalliner Odenwald, Buntsandstein-Schichtstufe, Mittlerer Odenwald, Hinterer Odenwald, Neckardurchbruchstal, Kleiner Odenwald) und eine umfassende Analyse der Talsysteme mit ihren hydrologischen Strukturen und Flüssen (Rhein, Main, Neckar).
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Der historische Teil befasst sich mit der Besiedlungsgeschichte des Odenwaldes von der Jungsteinzeit über Kelten, Römer und Alemannen bis zur fränkischen Landnahme. Die Rolle der Klöster Lorsch und Amorbach bei der Kolonisation, die Organisation der Odenwaldsiedlung (Villikationen, Waldhufendörfer), die Herrschaftsanfänge (fränkischer Königshof, Einhard, Schenken von Erbach), die Zentverwaltung, der Odenwald im Bauernkrieg und Fränkischen Reichskreis sowie die Auswirkungen der napoleonischen Zeit und die Reaktionen der Bevölkerung werden detailliert untersucht.
Welche mythologischen Aspekte werden behandelt?
Der mythologische Teil erforscht die Sagenlandschaft des Odenwaldes, einschließlich Lokalsagen, Sagen um Wasserfräulein, Wilde Frauen und Weiße Frauen. Die literarischen Bearbeitungen dieser Sagenstoffe und deren Bezug zum matriarchalen Ursprung werden analysiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Nibelungenorten im Odenwald, mit einer detaillierten Analyse des Nibelungenliedes, seiner historischen Hintergründe und der Frage nach den tatsächlichen Lokalitäten. Die verschiedenen Handschriften des Nibelungenlieds und die These eines möglichen Tatorts in Hiltersklingen werden diskutiert.
Welche Aspekte der Namenkunde werden behandelt?
Der Abschnitt zur Namenkunde untersucht die Namensgebung von Heidelberg und dem Odenwald. Bisherige Erklärungen zum Namen Heidelberg werden kritisch hinterfragt und ein neuer Ansatz unter Berücksichtigung geographischer, sprachlicher und kulturgeschichtlicher Aspekte präsentiert. Die Bedeutung des Namens Odenwald wird ebenfalls diskutiert, mit einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Deutungsversuchen und einer Schlussfolgerung basierend auf der Rolle Odins und matriarchaler Wurzeln. Die Bedeutung von Quellheiligtümern im Odenwald und deren Verbindung zur keltischen und vor-indoeuropäischen Kultur wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Odenwald, Geographie, Geologie, Besiedlung, Franken, Klöster Lorsch und Amorbach, Zent, Bauernkrieg, Grafschaft Erbach, Sagen, Nibelungenlied, Siegfried, Kriemhild, Heidelberg, Namenkunde, Quellheiligtümer, Matriarchat, Indoeuropäisierung, Wassermutter Dana, Odin.
Welche Kapitel sind im Buch enthalten?
Das Buch gliedert sich in vier Hauptkapitel: A) Geographie und Talsysteme, B) Besiedlung und Herrschaftsanfänge, C) Sagenkreise und Nibelungenlied, D) Namenkunde und Quellheiligtümer. Jedes Kapitel ist in weitere Unterkapitel unterteilt, die im detaillierten Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind.
- Quote paper
- Gert Heinz Kumpf (Author), 2023, Der einzigartige Odenwald. Gesammelte Studien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1348954