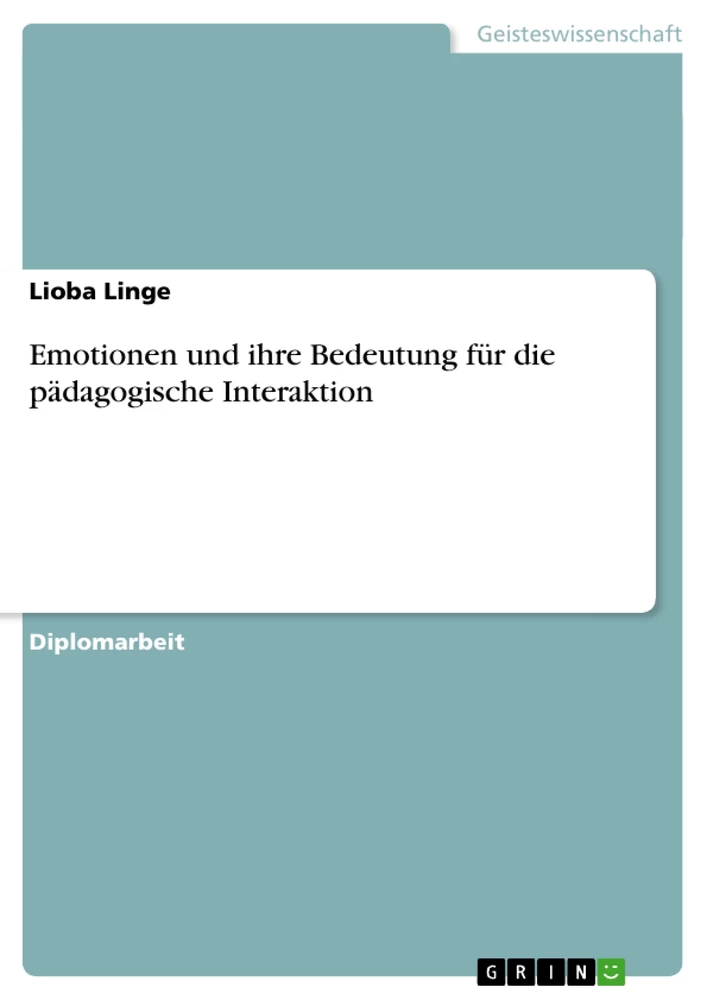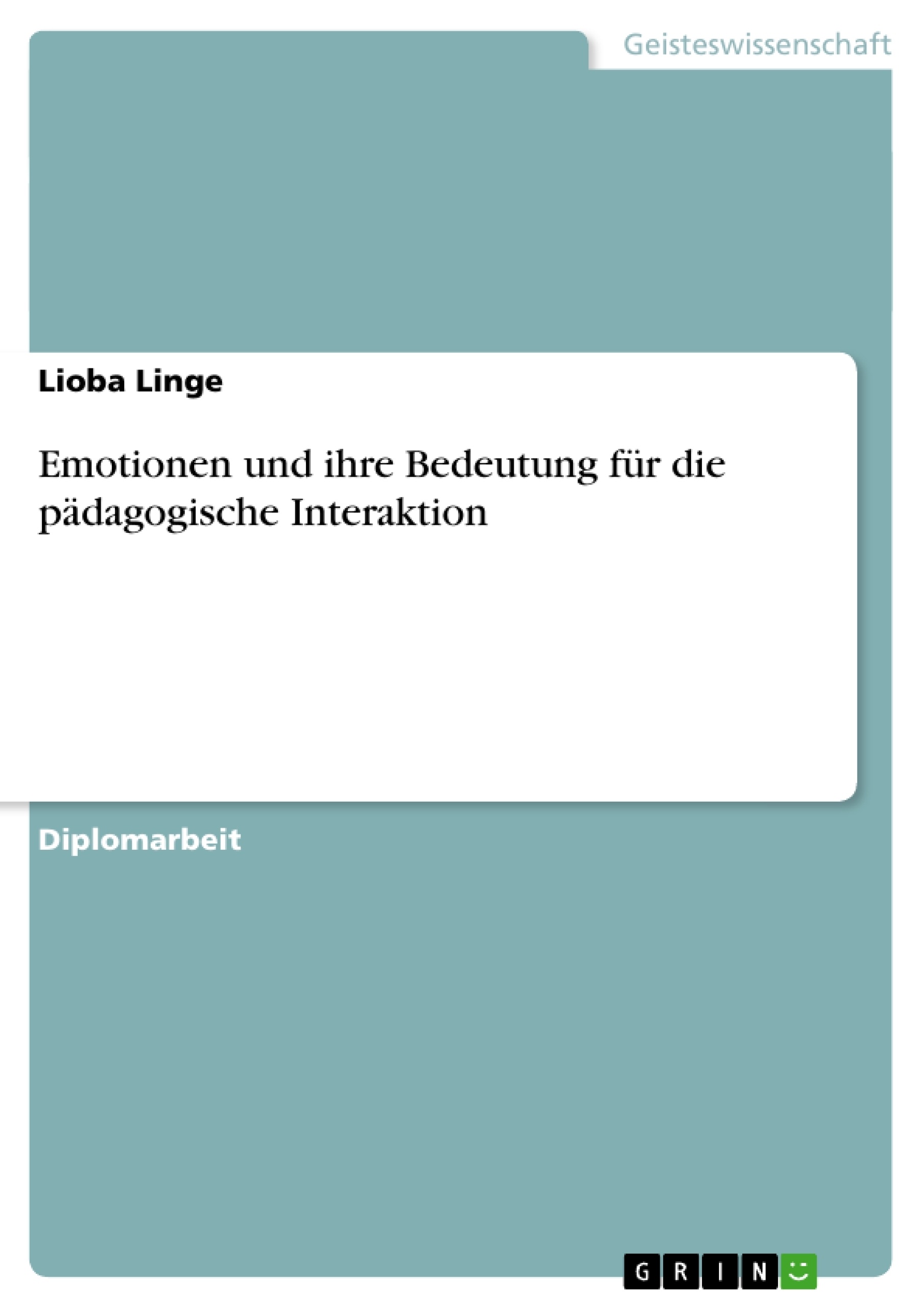In der folgenden Arbeit soll es um die Frage gehen, welche Bedeutung Emotionen für das menschliche Miteinander haben. Im Speziellen interessiert mich der Umgang mit Emotionen im pädagogischen Alltag. Meine Motivation für dieses Thema hat sich im Laufe meiner praktischen Erfahrungen durch meine Arbeit mit sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen in Hort, Jugendzentrum und Sozialer Gruppenarbeit herausgebildet. Gerade in meiner Arbeit mit Jugendlichen ist mir bewusst geworden, dass es Lebensphasen gibt, in denen die Emotionen deutlich im Vordergrund stehen. Betrachtet man die Tätigkeitsbereiche Sozialer Arbeit, so wird deutlich, dass es sich in der Regel um die Arbeit mit Menschen in Notsituationen bzw. sozial schwachen Verhältnissen handelt. Diese Lebenssituationen bringen ähnliche wie das Gefühlschaos eines Jugendlichen, verstärkte Emotionen mit sich.
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 EMOTIONEN
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Welche Emotionen gibt es?
2.2.1 Der Zorn
2.2.1.1 Der Sinn des Zorns
2.2.1.2 Unterschiede des Zorns
2.2.1.3 Risiken des Zorns
2.2.1.4 Körperliche Reaktionen
2.2.2 Der Neid
2.2.2.1 Unterschiedliche Arten von Neid
2.2.2.2 Funktionen des Neides
2.2.3 Traurigkeit
2.2.3.1 Funktion der Traurigkeit
2.2.3.2 Kulturelle Betrachtung
2.2.3.3 Traurigkeit und die anderen Emotionen
2.2.4 Die Scham
2.2.4.1 Körperliche Merkmale des Schams
2.2.4.2 Funktion des Schams
2.2.5 Eifersucht
2.2.5.1 Wie macht sich Eifersucht bemerkbar?
2.2.5.2 Kulturelle Unterschiede
2.2.5.3 Funktion der Eifersucht
2.2.6 Die Angst
2.2.6.1 Körperliche Reaktionen
2.2.6.2 Funktionen der Angst
2.2.6.3 Der Unterschied zwischen Angst und Furcht
2.2.6.4 Ängste bei Kindern
2.3 Physiologie der Emotionen
2.3.1 Anatomie und Funktion des Gehirns
2.3.1.1 Der Hypothalamus
3 EMPATHIE
3.1 Mitgefühl und prosoziales Verhalten
3.2 Der Einfluss von Erziehung auf Mitgefühl
3.3 Faktoren, die Mitgefühl und prosoziales Verhalten hemmen.
3.4 Der Umgang mit Gefühlen in der Pädagogik
3.5 Balance zwischen Nähe und Distanz
3.6 Sozialpädagogische Haltung
4 DIE EVOLUTIONSPÄDAGOGIK
4.1 Die Ursicherheit
4.2 Die Erlebnissicherheit
4.3 Die Körpersicherheit
4.4 Die Gefühlssicherheit
4.5 Die Gruppensicherheit
4.6 Die Sprachsicherheit
4.7 Die Kooperations- und Kommunikationssicherheit
4.8 Entwicklungsschwierigkeiten
5 FAZIT
6 LITERATURVERZEICHNIS
1 Einleitung
"Leider könnte es zu den
bedeutendsten Äu (3 erungen gehören, die je über Emotion gemacht wurden, da (3 [sic!] jeder wei (3 , was sie ist, bis man ihn bittet, sie zu definieren."1
In der folgenden Arbeit soll es um die Frage gehen, welche Bedeutung Emotionen für das menschliche Miteinander haben. Im Speziellen interessiert mich der Umgang mit Emotionen im pädagogischen Alltag. Meine Motivation für dieses Thema hat sich im Laufe meiner praktischen Erfahrungen durch meine Arbeit mit sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen in Hort, Jugendzentrum und Sozialer Gruppenarbeit herausgebildet. Gerade in meiner Arbeit mit Jugendlichen ist mir bewusst geworden, dass es Lebensphasen gibt, in denen die Emotionen deutlich im Vordergrund stehen. Betrachtet man die Tätigkeitsbereiche Sozialer Arbeit, so wird deutlich, dass es sich in der Regel um die Arbeit mit Menschen in Notsituationen bzw. sozial schwachen Verhältnissen handelt. Diese Lebenssituationen bringen ähnliche wie das Gefühlschaos eines Jugendlichen, verstärkte Emotionen mit sich.
Sozialpädagogen treffen in ihrem beruflichen Alltag täglich auf Menschen und treten in Interaktion mit ihnen. Demzufolge gehört es aus meiner Sicht zum sozialpädagogischen Handwerkszeug, Emotionen wahrnehmen, verstehen und deuten zu können. Sie bestimmen den beruflichen Alltag und begleiten den Betreuungsprozess.
Im Laufe meiner Arbeit möchte ich verdeutlichen, wie wichtig es ist sowohl seine eigenen als auch die Emotionen der Mitmenschen zu verstehen, um ein barrierefreie Interaktion möglich zu machen.
Beginnen werde ich meine Arbeit mit einer einleitenden Begriffsbestimmung. Im Folgenden werde ich einzelne Emotionstheorien vorstellen und in deren Beschreibung einzelne Emotionen näher erläutern und ihre Besonderheiten hervorheben.
Eine durchgehend anerkannte Begriffsbestimmung in der wissenschaftlichen Erforschung für „Emotion“ gibt es nicht. In der Literatur gibt es keine einheitliche Verwendung der Begriffe „Gefühl“ und „Emotion“. Sie werden je nach Autor unterschiedlich verwendet. Ich werde hauptsächlich auf den Begriff „Emotion“ zurückgreifen. Eine Ausnahme bildet das letzte Kapitel über das Konzept der Evolutionspädagogik, da die Autoren durchgängig den Begriff des Gefühls anwenden und ich dies bei meiner Vorstellung dieses Konzepts beibehalten habe. Da das Gehirn eine bedeutende Rolle bei der Entstehung und Verarbeitung von Emotionen spielt, habe ich diesem Gesichtspunkt den Abschluss des Kapitels der Emotionen gewidmet.
Das Gesamtkapitel der Emotionen bildet die Grundlage meiner Arbeit, auf dessen Ergebnissen das dritte Kapitel über die Empathie aufbaut. Mich hat die Frage beschäftigt, inwieweit Empathie pädagogisches Handeln unterstützen kann. Hierbei erläutere ich die Entstehung von Empathie in der Entwicklung von Kindern, deren Fördermöglichkeiten und zeige mögliche Hemmnisse auf. Des Weiteren soll es in diesem Kapitel um den Umgang mit Gefühlen in der Pädagogik gehen, den Balanceakt die sozialpädagogische Professionalität zu wahren, sowie um die fachliche Haltung des Pädagogen.
Im Zentrum des folgenden Abschnitts meiner Arbeit stelle ich das Kapitel der Evolutionspädagogik. Dieses pädagogische Konzept beschäftigt sich mit den an der Evolutionsbiologie orientierten Entwicklungsstufen des Menschen. In jeder Entwicklungsstufe werden unterschiedliche Sicherheiten und Kompetenzen erworben, die ich in den einzelnen Unterpunkten darlegen werde.
Abschließend werde ich auf Defizite in der Entwicklung eingehen.
2 Emotionen
2.1 Begriffsbestimmung
Es gibt unterschiedliche Theorien in Bezug auf Emotionen, die ich im Laufe meiner Arbeit beleuchten werde.
Ich werde die einzelnen Theorien an dieser Stelle kurz vorstellen und sie im Verlauf meiner Arbeit an Beispielen vertiefen. Meinen Schwerpunkt lege ich auf die Sicht der Evolutionspsychologie, da ich in dem abschließenden Kapitel meiner Arbeit ein pädagogisches Konzept vorstellen werde, welches auf den Erkenntnissen der Evolutionspsychologie basiert.
Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass unsere Emotionen in den Genen verankert sind. Unsere Gefühle sind nützlich, um Handlungen einzuleiten. Diese Theorie geht auf Charles Darwin (1809 – 1882) zurück. Die Evolutionspsycholo-gie bezieht eine weitere Erklärungsebene in ihre Forschungen mit ein. Es steht die zentrale Frage im Mittelpunkt der Untersuchungen, zu welchem Zweck sich eine Emotion entwickelt und gefestigt hat. Darwin erforschte den emotionalen Gesichtsausdruck des Menschen weltweit, insbesondere nach den Aspekten der Universalität, den Gemeinsamkeiten mit dem entsprechenden tierischen Emotionsausdruck und den Prinzipien der aktualgenetischen Entstehung.2
Aus Sicht der Evolutionspsychologie steht im Vordergrund menschlichen Handelns die Weitergabe der eigenen Gene. Emotionen unterstützen diesen Prozess.3
Die kognitionstheoretische Ansätze gehen davon aus, dass wir Emotionen verspüren, weil wir denken. Eine Kontrolle über unsere Gefühle bekommen wir über eine Veränderung unserer Denkstrukturen.
An allen psychischen Vorgängen sind in unterschiedlicher Intensität kognitive Prozesse beteiligt. Kognitiv orientierte Emotionsmodelle gehen davon aus, dass Emotionen Resultate gedanklicher Analysen sind. Die Intensität der wahrgenommen Emotion, die sich durch körperliche Reaktionen äußert, hängt von der subjektiven Kognition ab.4
Kulturrelativistische Emotionstheorien gehen davon aus, dass Emotionen durch das jeweilige kulturelle Umfeld geprägt werden. Hierbei gilt es zwei unterschiedliche Strömungen zu unterscheiden. Die radikalen Verfechter dieser Theorie gehen davon aus, dass es Emotionen gibt, die nur durch die jeweilige Kultur geprägt werden und in keiner anderen Kultur vorkommen. So gehen die Autoren Markus und Kitayama in ihren Forschungen davon aus, dass „amae“ eine Emotion ist, die nur in Japan vorkommt. „Amae“ bedeutet das Gefühl von Geborgenheit, welches durch eine sichere Bindung entsteht, dar. In Nordamerika und Europa gibt es für diese Emotion keinen sprachlichen Ausdruck.5
Andere kulturrelativistische Forscher gehen davon aus, dass Emotionen, wie Angst, Ärger, Freude oder Trauer zwar in allen Kulturen vorkommen, sie sich allerdings in einzelnen Eigenschaften und Ausdrucksformen unterscheiden können. So kann die jeweilige Kultur prägend sein, durch welche Situationen die einzelnen Emotionen ausgelöst werden und wie das angemessene Verhalten definiert wird. Darüber hinaus prägt die Kultur gleichfalls wie die Emotion zum Ausdruck gebracht wird.6 Auf letzteres werde ich im Kapitel der Trauer näher eingehen.
Diese unterschiedlichen Emotionstheorien grenzen sich keinesfalls voneinander ab. Es finden regelmäßige Kolloquien statt, in denen ein Austausch der einzelnen Forschungsrichtungen stattfindet. Die Anhänger der einzelnen Theorien stellen sich nicht gegenseitig in Frage, sondern begünstigen durch Sammelbände, in denen die Theorien vertreten sind, den Blick auf die Gesamtheit der Forschungen. Jede Theorie legt ihren eignen Schwerpunkt und oft verschwimmen die Grenzen.
„So geht selbst der eingefleischteste Evolutionspsychologe davon aus, da (3 [ sic! ) emotionsauslösende Situationen und die Regeln für das Ausdrücken der Emotionen von Kultur zu Kultur variieren können. Umgekehrt weisen die modernen Kulturrelativisten die Vorstellung, da (3 [ sic! ) es weltweit verbreitete Emotionen gibt, nicht von sich. Die Kognitivisten räumen ein, da (3 [ sic! ) bestimmte emotionale Reaktionen unabhängig vom Denken ausgelöst werden, und die Vertreter der psychologischen Betrachtungsweise erkennen gern an, da (3 [ sic! ) unsere Emotionen in manchen komplexen Situationen zunächst einmal davon abhängen, was wir denken.“7
2.2 Welche Emotionen gibt es?
Emotionen gibt es viele. Die einzelnen Forscher versuchten sie zu kategorisieren. Für Darwin sind Freude, Überraschung, Traurigkeit, Angst, Ekel und Zorn fundamentale Emotionen. Sie sind als Darwins „big six“ bekannt.
Paul Ekman erweitert diese Liste durch Vergnügen, Verachtung, Zufriedenheit, Verlegenheit, Stimulation, Schuldgefühl, Stolz, Genugtuung, Sinneslust, und Scham. Somit kommt er auf 16 unterschiedliche Emotionen. Er schränkt letztendlich seine Aussage wieder ein, da nicht alle aufgelisteten Emotionen die Kriterien erfüllen, die er für Emotionen festgelegt hat. Für Verachtung beispielsweise gibt es keinen universellen Gesichtsausdruck.8
Nach Ekman müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, damit eine Emotion als ´fundamental´ oder ´elementar´ bezeichnet werden kann. Diese Emotionen nennt er Basisemotionen:
„ Sie mu (3 [ sic!] abrupt einsetzen: Eine Emotion ist immer eine Reaktion auf ein Ereignis oder einen Gedanken.
Sie mu (3 [ sic!] von kurzer Dauer sein: Ein langanhaltender Zustand von Traurigkeit wird schon nicht mehr als Emotion betrachtet, sondern eher als ein Gefühl oder eine Stimmung.
Sie mu (3 [ sic!] sich von den anderen Emotionen unterscheiden, und zwar so klar, wie sich Rot von Blau absetzt. Zorn und Angst können miteinander vermischt auftreten, sind aber zwei deutlich unterschiedene Emotionen. Angst, Bangigkeit und Beklemmung hingegen gehören zur selben Familie.
Sie mu (3 [ sic!] schon bei Babys vorkommen und sich auch in diesem Alter deutlich von den übrigen Emotionen unterscheiden.
Sie mu (3 [ sic!] in einer für sie typischen Weise auf den Körper einwirken: Jede fundamentale Emotion mu (3 [ sic!] sich in charakteristischen körperlichen Reaktionen äu (3 ern. So führen Angst und Zorn beide dazu, da (3 [ sic!] das Herz schneller schlägt. Aber im Zorn steigt die Oberflächentemperatur der Finger, während sie bei der Angst sinkt. Dank moderner Untersuchungsgeräte wie dem
Positronen-Emissions-Tomographen oder dem Kernspintomographen kann man diese Unterschiede sogar im Gehirn beobachten. Bei Traurigkeit werden zum Beispiel andere Hirnzonen aktiviert als bei Freude.
Die Evolutionspsychologen legen noch auf drei weitere Kriterien wert:
Es mu (3 [sic!] auf der ganzen Welt einen typischen Gesichtsausdruck für die betreffende Emotion geben (...) Sie mu (3 ( sic! ) von universellen Lebenssituationen ausgelöst werden: Wenn ein schwerer Gegenstand auf Sie niedergesaust kommt, so wird dadurch immer und überall Angst ausgelöst, und der Verlust eines geliebten Wesens ruft stets Traurigkeit hervor.
Sie mu (3 ( sic! ) auch bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich zu beobachten sein.“9
In den folgenden Kapiteln werde ich die unterschiedlichen Basisemotionen anhand der vier Emotionstheorien beleuchten.
2.2.1 Der Zorn
2.2.1.1 Der Sinn des Zorns
Emotionen sollen uns aufs Handeln vorbereiten. Der Zorn bereitet uns offensichtlich durch die Anspannung der Armmuskeln auf einen Kampf vor. Durch die Erhöhung der Atmung und der Herzfrequenz werden die Muskeln mit Sauerstoff versorgt. Durch diese körperliche Reaktion lässt sich schnell erkennen, dass das Gegenüber zornig ist und hat die Möglichkeit eine Lösung herbeizuführen. Die Gegenemotion zu Zorn ist oftmals Angst. Auf diese Weise entwickeln sich Rangfolgen. Zorn soll nicht immer einen lebensbedrohlicher Kampf eingeleiten, sondern bestenfalls das Gegenüber erfolgreich einschüchtern. Dadurch soll die eben erwähnte Rangfolge erzielt werden. Ein lebensbedrohlicher Kampf würde dem Stärkeren zu viel Energie rauben und den Schwächeren das Leben kosten.
Die Gesamtschullehrerin Agnès berichtete, dass eine Kollegin bei Dienstbesprechungen die Eigenschaft besaß, anderen ständig ins Wort zu fallen. Eine Weile konnte Agnès ihren Zorn darüber im Zaum halten, aber eines Tages gingen ihre Emotionen mit ihr durch. Als ihre Kollegin ihr erneut ins Wort fiel, schlug Agnès mit der Faust auf den Tisch und schrie ihre Kollegin an. Das Kollegium reagierte erschrocken über diese heftige Reaktion und verfiel in Schweigen. Agnès wurde daraufhin verlegen, da mit ihr derart die Pferde durchgegangen waren und schwieg den Rest der Besprechung. Dieser Zornesausbruch hatte allerdings zur Folge, dass ihre Kollegin ihr fortan nicht mehr ins Wort fiel.
Die Geste, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, wurde durch Muskelanspannungen begünstigt. Bei Schimpansen lässt sich diese Einschüchterungsgeste ebenfalls beobachten. Um den Gegner zu beeindrucken und von ihrer Stärke zu überzeugen, trommeln sie mit den Fäusten auf den Boden.10
2.2.1.2 Unterschiede des Zorns
Zorn kann auf unterschiedliche Weise entstehen. Zum einen kann er eine unmittelbare Reaktion auf ein Geschehen darstellen.
Wird man zum Beispiel auf der Straße heftig angestoßen, folgt augenblicklich ein Gefühl des Zorns. Die `Ursituation`, dass jemand in unser Territorium einbricht, ruft eine instinktive Reaktion hervor. Biologen, die bei Versuchspersonen diese Situation untersuchten, verzeichneten die Entstehung dieses schnellen Zorns im Riechhirn. Das Riechhirn befindet sich in den ursprünglichsten Teilen unseres Gehirns und ist eine primitive Hirnpartie. Sie ist gleichfalls bei weniger hoch entwickelten Tieren zu finden.
Die andere Art von Zorn baut sich langsam auf. So zum Beispiel, wenn der Partner entgegen allen Versprechungen erneut unpünktlich ist. Diese Art von Zorn wird geprägt durch unsere unerfüllten Erwartungen. Es werden hierbei ganz andere Hirnpartien beansprucht, die sich im Laufe der Evolution zuletzt gebildet haben. Es handelt sich um die präfrontale, medioventrale Hirnrinde, den Kortex.
Diese Gehirnregion hilft uns, unseren Zorn kontrollieren zu können. Hierbei wird der Kortex, im Gegensatz zum plötzlich entstehenden Zorn, stärker durchblutet.11
2.2.1.3 Risiken des Zorns
Durch den Zorn entstehen gesundheitliche Risiken. Forscher fanden heraus, dass Choleriker ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben. Kommen weitere Risikofaktoren, wie Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, Cholesterin, sowie eine erbliche Veranlagung hinzu, steigt das Herzinfarktrisiko.
Eine Unterdrückung des Zorns ist allerdings genauso wenig gesund und belastet die Herzkranzgefäße. Besser als eine Unterdrückung des Zorns ist, eine alternative Handlungsstrategie zu entwickeln, die es ermöglicht die Emotion zu kanalisieren.
Der Zorn regelt das soziale Gefüge und lässt eine Rangordnung entstehen, die weiteren Konflikten entgegenwirkt. Die einzelnen Beziehungen innerhalb einer Gruppe müssen nicht immer wieder aufs Neue austachiert werden.
Wie wir im Kapitel „Unterschiede des Zorns“ gesehen haben, behindert der Zorn den Blick auf alternative Lösungsmöglichkeiten, wodurch Kurzschlussreaktionen entstehen können.
Ein unkontrollierter Zornesausbruch kann Beziehungsabbrüche zur Folge haben, die auf längere Sicht der Gruppe schaden.
Eine Möglichkeit mit Zorn umzugehen, ist eine defensive Position einzunehmen. Dies wirkt einem möglichen Konflikt entgegen.
Allerdings birgt der defensive Umgang mit Zorn die Gefahr seine eigenen Wünsche und Vorstellungen zu vernachlässigen. Diese Umgehensweise suggeriert den Mitmenschen eine niedrige Stellung in einem hierarchischen Gefüge und schließt somit diesen als potentiellen Konkurrenten aus.
Die Unterdrückung des Zorns rührt oft aus einer „guten Erziehung“, die uns gelehrt hat, dass unkontrollierte Emotionalität ein Zeichen von Unkultiviertheit bedeutet. Vordergründig soll eine stabile Beziehung zu den Mitmenschen aufrechterhalten werden. Dabei wird die zuvor beschriebene Vermeidungsstrategie angewandt. Es scheint also wichtig, ein Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig Zorn für sich zu finden.12
2.2.1.4 Körperliche Reaktionen
Aus Sicht der Entwicklungspsychologen sollen Emotionen eine Handlung einleiten. Hierzu ist es hilfreich, die körperlichen Reaktionen eines zornigen Menschen zu betrachten. Fragt man Menschen aus unterschiedlichen Kulturen nach körperlichen Zornsymptomen, sind die gängigsten Antworten Muskelanspannungen in den Armen, erhöhter Puls und ein verstärktes Wärmeempfinden.
In Comics wird Zorn oft durch eine Rauchwolke über dem Kopf dargestellt. Sprachlich haben Umschreibungen oft mit diesem „hitzköpfigen“ Bild zu tun: „man kocht über“ oder „schäumt vor Wut“, „jemand hat einen hitzigen Charakter“ oder „jemanden zur Weißglut bringen“.
Im Organismus beobachten Forscher ebendiese Reaktionen. Zornige Menschen ballen oft die Fäuste und spannen ihre Armmuskeln an. Das Wärmeempfinden rührt daher, dass sich die oberflächennahen Blutgefäße weiten. Eine Rötung des Gesichts ist eine daraus resultierende körperliche Reaktion. Die Hände weisen eine höhere Oberflächenstruktur auf. Weiterhin beschleunigen sich der Atemrhythmus und die Herzfrequenz. Der Blutdruck steigt, wodurch mehr Blut durch den Körper fließt, um die Muskulatur mit Sauerstoff zu versorgen. Zorn wirkt sich auf das Herz-Kreislauf-System und somit auf unsere Gesundheit aus.13
2.2.2 Der Neid
Zu Anfang scheint mir eine Begriffsdefinition wichtig, da der Neid im Alltag sprachlich allzu oft mit der Eifersucht gleichgesetzt wird. Es besteht allerdings ein grundlegender Unterschied, wie wir gleich sehen werden.
Besonders gut kann man es an der Tragödie Othello von Shakespeare erklären. Er hat jeweils den Figuren Othello und Jago die Emotionen Neid und Eifersucht auf den Leib geschrieben.
Othello, der Anführer der Mohren, wird von den Venezianern verehrt, nachdem er in den Kriegen gegen die Türken siegte. Der venezianische Edelmann Jago sieht eigentlich sich in dieser Position oder zumindest in der als Heerführer, die Othello mit dem jungen Adligen Cassio besetzt.
Aus diesem Neid heraus plant Jago eine Intrige mit dem Ziel, diese Harmonie der beiden zu zerstören. Er lässt Othello glauben, seine Frau Desdemona gehe ihm mit Cassio fremd. In Othello entwickelt sich die Angst, seine Frau verlieren zu können. Er wird von Eifersucht geplagt.
In dieser Tragödie wird deutlich, dass sich Neid auf das Glück und den Besitz anderer richten.
Eifersüchtig ist man hingegen, wenn man Angst um den Verlust des eigenen Glücks oder Besitzes.
„Ich verspüre vielleicht Eifersucht, wenn mein Nachbar aus allzu großer Nähe mit meiner Frau spricht, doch wenn ich hinterher merke, dass seine eigene Frau sehr verführerisch ist, kommt Neid in mir auf.“14
Diese beiden Emotionen treten durchaus gemischt auf. Unter Geschwistern kann man dies sehr gut beobachten. Die Ältere ist neidisch, wenn die kleine Schwester mehr Geschenke bekommt. Es entsteht gleichfalls Eifersucht, da die Ältere Angst hat die Liebe der Eltern zu verlieren.15
2.2.2.1 Unterschiedliche Arten von Neid
Der depressive Neid richtet sich nicht gegen eine andere Person. Das Glück und der Besitz anderer vergönnen wir ihnen nicht, denken aber über unsere eigenen Defizite nach. Uns wird bewusst, was wir persönlich nicht erreicht haben.16
Beim feindseligen Neid erkennen wir ebenfalls unsere Defizite, allerdings ist die Reaktion eine andere. Wir missgönnen dem anderen Besitz und Glück und beginnen ihn in ein schlechtes Licht zu rückenschlecht, um das Gleichgewicht für uns wieder herzustellen. In diesen Momenten hassen wir kurzzeitig unsere Gegenüber. Dies können durchaus auch Menschen sein, die wir sonst sehr lieben.17
Der bewundernde Neid ist freundlicher als die zuvor beschriebenen. Er leitet das Streben, gegen die Defizite anzukämpfen ein. So kann der Neid auf besondere Fähigkeiten anderer uns zwar unsere fehlenden Fähigkeiten verdeutlichen, motiviert uns in dieser Form aber, uns diese zu erarbeiten.
Wie bei allen Kategorisierungen kommt es auch hier zu Mischformen oder der Abfolge der unterschiedlichen Reaktionen. Diese sind situationsabhängig. Wir können in einem Moment unsere Schwester lieben, in einem anderen sind wir neidisch, weil sie erfolgreicher ist.18
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten19
2.2.2.2 Funktionen des Neides
Der Neid zählt nicht zu den Basisemotionen, da es keinen spezifischen Gesichtsausdruck gibt. Aus evolutionärer Sicht ist es nicht sinnvoll, anderen gegenüber seinen Neid auszudrücken. In Gruppen dient der Neid dazu, dass jeder einzelne versucht seine Vorteile auszubilden. Wer dies erfolgreich leisten kann, hat eine höhere Stellung, somit mehr Nahrung, sowie mehr Partnerinnen, um seine Gene weitergeben zu können. In Gruppen bedeuten ranghöhere Männer einen besseren Schutz und eine bessere Versorgung für die Frauen und ihre Nachkommen.
Der bewundernde Neid, der eine Entwicklung des Selbst begünstigt, scheint somit nützlicher als der aggressive Neid, der auf einen Kampf hinausläuft. Ein Kampf hätte den Verlust eines Stammesmitgliedes zur Folge, das die Gemeinschaft nicht mehr unterstützen kann.20
Der Neid bewirkt, dass die Selbstachtung in Frage gestellt wird. Die Tatsache allein, jemandem unterlegen zu sind, löst nicht gleich Neid aus. Es hängt immer davon ab, welche Gewichtung der jeweiligen Situation zugeschrieben wird.
Jemand, der schnell seekrank wird, wird auf den Besitz einer Yacht nicht neidisch sein.21
Der Neid richtet sich hauptsächlich auf Personen, die uns nahe stehen, wie Familie und Freunde. Das liegt daran, dass wir durch die Nähe zu ihnen unser Leben stets reflektieren und mit dem ihren in Konkurrenz stellen. Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass wir mit unserem Umfeld in der Regel ähnliche Ansichten teilen, ähnliche Interessen oder Ziele haben. Menschen unseres näheren Umfeldes stehen stärker in Konkurrenz zu uns als Fremde.
Ein Mädchen in der Pubertät ist eifersüchtig auf eine hübsche Klassenkameradin und nicht auf das Topmodel.
„Dies ist wohl einer der betrüblichsten Aspekte des Neides: Sein Gift kann sich innerhalb unserer vertrauten Beziehungen ausbreiten, in unseren Kontakten zu Geschwistern und Freunden, ja selbst zwischen Ehepartnern.“22
Eltern-Kind Beziehungen werden oft unbewusst durch Neid geprägt.
Der bewundernde Neid ist hilfreich und ein wesentlicher Bestandteil der Erziehung. Durch das Nachahmen der Eltern wird eine Entwicklung gefördert.
Andere Neidformen scheinen komplexer. Zum Beispiel stehen Mütter und Töchter oft in Konkurrenz. Es geht dabei um die Gunst des Vaters oder anderer Männer und kann die Mutter-Tochter Beziehung ein ganzes Leben lang begleiten. Sobald die Tochter fraulich wird, besteht die Gefahr für die Mutter in den Hintergrund zu geraten. Sie selbst verliert im Laufe der Jahre an Attraktivität. Diese Art von Neid kann in aggressiven Auseinandersetzungen enden.
Ein Beispiel für einen Vater-Sohn Konflikt tritt dann auf, wenn der Sohn das berufliche Erbe seines Vaters antritt. Ein Vater der mit viel Fleiß ein Unternehmen aufgebaut hat, seinem Sohn eine gute Ausbildung finanzieren konnte, kann unter Umständen neidisch auf die daraus gewonnen Freiheiten und Möglichkeiten des Sohnes sein.
Die Aussagen der Psychoanalytiker in Bezug auf den Ödipuskomplex werde ich in dem Kapitel über die Eifersucht einfließen lassen.23
Um das eigene Gleichgewicht wieder herzustellen, ist es hilfreich, sich die Gesamtheit der Umstände vor Augen zu führen. Neidisch sind wir auf Teilaspekte im Leben eines anderen. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass jede Biographie Faktoren aufweist, welche nicht erstrebenswert sind. Diese Denkweise gleicht unser eigenes Defizit aus und entspannt das Verhältnis zum Gegenüber.24
2.2.3 Traurigkeit
Im folgenden Kapitel werde ich mich der Emotion der Traurigkeit zuwenden. Es gibt ganz verschiedene Situationen, die diese Emotion bei einem Menschen auslöst.
Liebeskummer ist eine Emotion, die ausgelöst wird durch die Trennung, also den Verlust eines Menschen. Aus dieser Traurigkeit entwickelt sich oft eine andauernde, traurige Grundstimmung. Diese Grundstimmung kehrt in Wellen immer wieder, wenn die betroffene Person an den Verlust denkt.25
Weiter kann aus Mitgefühl anderen gegenüber Traurigkeit entstehen. Wenn wir zum Beispiel einen traurigen Film schauen, tritt diese Empathie ein. Die Szene in Bambi, in welcher ihm sein Vater erklärt, dass sie die Mutter nicht mehr wieder sehen werden, weil die Jäger sie gerade getötet haben, macht viele Menschen traurig. Bei Kindern geht es sogar manchmal so weit, dass sie diesen Film nicht mehr sehen wollen. Sie gehen damit der Situation aus dem Weg, erneut diese starke Traurigkeit zu empfinden. Die Empathie werde ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Im Verlaufe meiner Arbeit werde ich ihr ein eigenständiges Kapitel widmen.
Der Gedanke an etwas, was wir verloren haben, beispielsweise ein Haus, das wir aus finanziellen Nöten verkaufen mussten, ruft Traurigkeit in uns hervor. In diesem Fall handelt es sich um Nostalgie. Nostalgie ist griechisch und lässt sich vom Wortstamm her in nostos – die Rückkehr – und in algos – den Schmerz – aufteilen.26
In den vorangegangenen Beispielen wird deutlich, dass der Verlust über etwas oder über jemanden die Traurigkeit auslöst. Wie stark die Emotion erlebt wird, hängt davon ab, wie wertvoll das- oder derjenige für uns war. Der Verlust eines geliebten Menschen kann uns bis an unser Lebensende begleiten.27
[...]
1 LeDoux, Joseph „Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen.“ München Wien: Carl Hanser Verlag, 1998, S. 26.
2 Vgl. Otto, Jürgen O., Euler, Harald, Mandl, Heinz, „Emotionspsychologie – Ein Handbuch“ Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2000, S.45ff.
3 Vgl. ebd. S.56.
4 Vgl. Otto, Jürgen O., Euler, Harald, Mandl, Heinz, „Emotionspsychologie – Ein Handbuch“ Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2000, S.95f.
5 Vgl. Markus, H.R. und Kitamaya, S. “Culture and the self: Implications for dognition, emotion, and motivation”, Psychological Review, 98, 1991, S. 224-253, In: Otto, Jürgen O., Euler, Harald, Mandl, Heinz „Emotionspsychologie – Ein Handbuch“ Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2000, S.142.
6 Vgl. Otto, Jürgen O., Euler, Harald, Mandl, Heinz, „Emotionspsychologie – Ein Handbuch“ Psychologie Verlags Union, Weinheim, 2000, S.142.
7 Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.22.
8 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.23.
9 Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.24.
10 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.32f.
11 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.41f.
12 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.73.
13 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.29f.
14 Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.81
15 Vgl. ebd. S.80f.
16 Vgl. ebd. S.82.
17 Vgl. ebd. S.83.
18 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.84.
19 Ebd. S.85.
20 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.97f.
21 Vgl. ebd., S.85f.
22 Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”,3. Auflage 2008, München, S.87.
23 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München, S.87.
24 Vgl. ebd S. 89f.
25 Vgl. ebd. S.149.
26 Vgl. Francois Lelord, Christophe André, „Die Macht der Emotionen”, 3. Auflage 2008, München,S.148ff
27 Vgl.ebd. S.151.
- Quote paper
- Lioba Linge (Author), 2009, Emotionen und ihre Bedeutung für die pädagogische Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134884