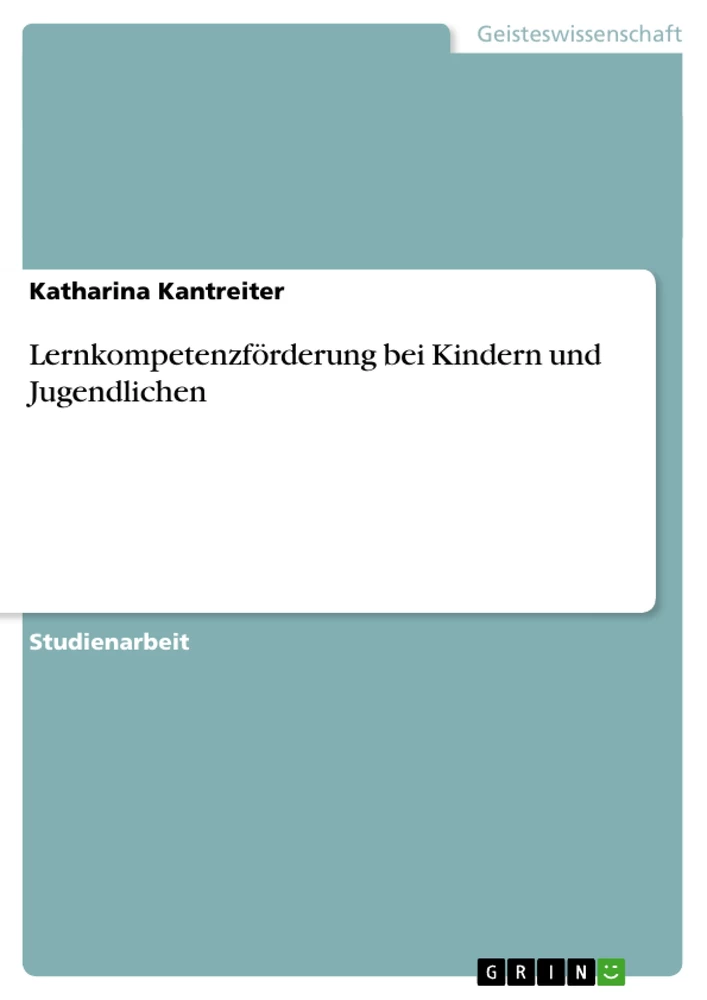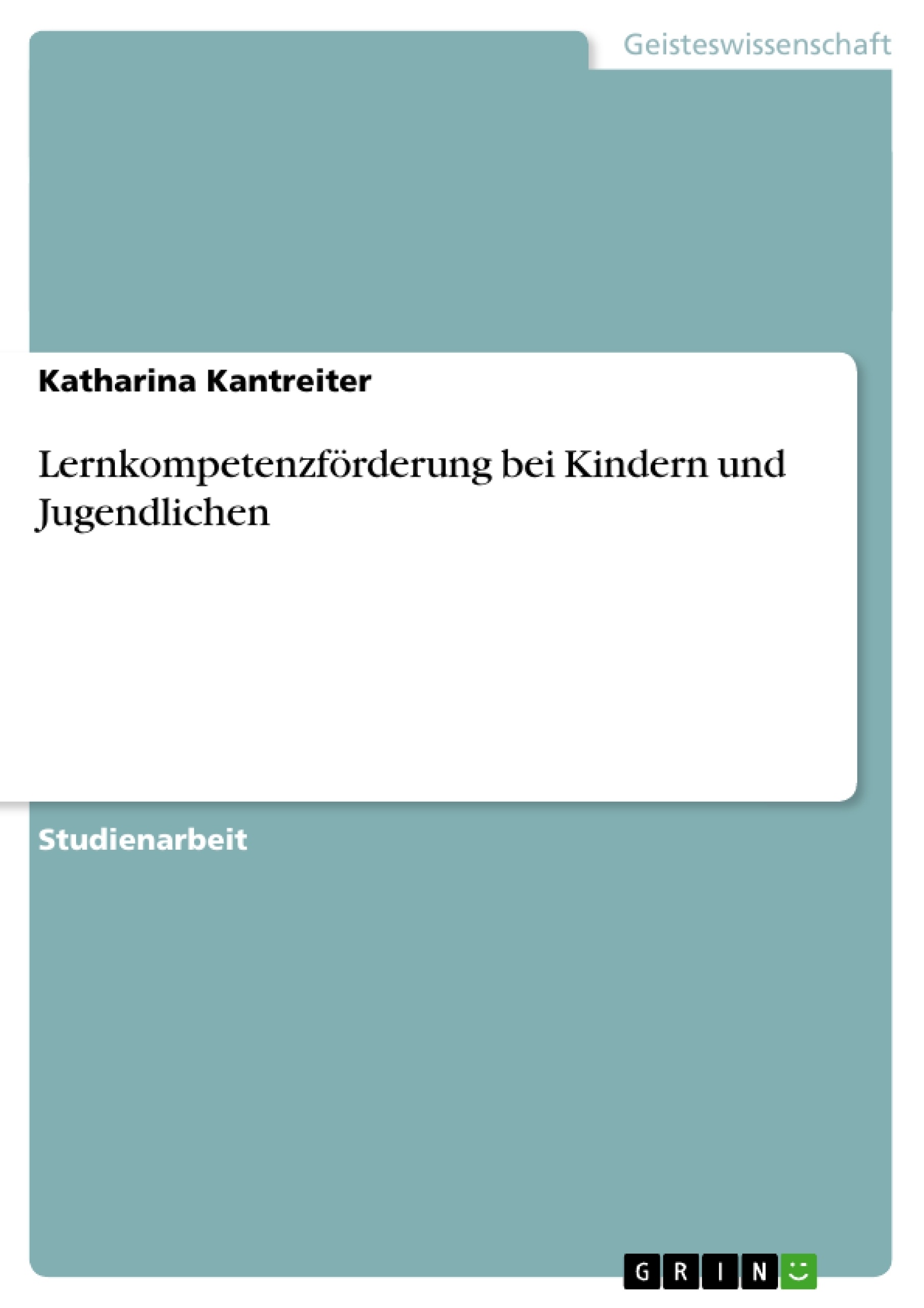Im Rahmen der Kognitiven Wende um 1960 entwickelt sich innerhalb der psychologischen Wissenschaft ein Trend von einer behavioristischen zu einer kognitiven Denkweise. Während im Behaviorismus mit dem Modell der ,Black Box’ nur objektiv messbare Verhaltensweisen erfasst werden, berücksichtigt die kognitivistische Sichtweise physiologische Vorgänge im Menschen. Wissenschaftler beschäftigen sich zunehmend mit der Erforschung von Gedächtnisleistungen. Damit wird das Reiz- Reaktionsschema des Behaviorismus durch die Informationsverarbeitungsprozesse ergänzt. Eine wichtige Rolle für die Wende zum Kognitivismus spielt die Entwicklungstheorie Jean Piagets. Er beschreibt Lernvorgänge als Austauschprozess zwischen Individuum und Umwelt. Der Lernende entwickelt abhängig von seinem Alter seine kognitiven Strukturen und Schemata aus. Das Wissen um die damit verbundenen Erkenntnisse legt einen wichtigen Grundstein für die beginnende Bildungsexpansion.
Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft benötigt jeder Mensch die Fähigkeit lebenslang zu lernen, also Lernkompetenz. Seit den 70iger Jahre werden verschiedenste Trainings zur Förderung von Lernkompetenzen entwickelt. Nun stellt sich die Frage, welches Training die Lernkompetenz von Kindern und Jugendlichen effektiv fördert. Ziel dieser Ausarbeitung ist es anhand eines Vergleichs zweier ausgewählter Förderprogramme, dem ,,Reciprocal Teaching‘’ nach Brown/Palincsar und dem ,,Programm zur Vermittlung kognitiver Fähigkeiten’’ nach Lauth, die jeweiligen Stärken und Schwächen darzustellen und ihre Sinnhaftigkeit für die praktische Anwendung kurz zu diskutieren.
Die Begriffklärung geht ausschließlich auf den Bereich der Psychologie und Pädagogik ein und schließt andere Definitionsbereiche aus. Die dargestellten Modelle können nur kurz erläutert werden. Diese Ausarbeitung verzichtet auf eine historische Betrachtung in der Entwicklung der Lernkompetenzförderung sowie auf Theorien zur kognitiven Entwicklung des Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 3. Fördermodelle
- 3.1. „Reciprocal Teaching“ nach Brown und Palincsar
- 3.2. Das Selbstinstruktionstraining nach Lauth
- 3.3. Vergleich beider Programme
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Förderung von Lernkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist der Vergleich zweier Förderprogramme – „Reciprocal Teaching“ und das Selbstinstruktionstraining nach Lauth – um deren Stärken und Schwächen sowie deren praktische Anwendbarkeit zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf kognitionspsychologischen Grundlagen und betrachtet die Bedeutung von Gedächtnisleistungen und Informationsverarbeitungsprozessen für erfolgreiches Lernen.
- Definition und Abgrenzung von Lernen und Lernkompetenz
- Vorstellung und Analyse des „Reciprocal Teaching“-Programms
- Vorstellung und Analyse des Selbstinstruktionstrainings nach Lauth
- Vergleich der beiden Programme hinsichtlich ihrer Effektivität und Anwendbarkeit
- Diskussion der Bedeutung von Lernkompetenzförderung im Kontext der Wissensgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Lernkompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen ein und beschreibt den Wandel von behavioristischen zu kognitivistischen Denkweisen in der Psychologie. Sie hebt die Bedeutung von Gedächtnisleistungen und Informationsverarbeitungsprozessen hervor und betont den Einfluss von Jean Piagets Entwicklungstheorie. Das Ziel der Arbeit wird als Vergleich zweier Förderprogramme definiert, um deren Stärken und Schwächen für die Praxis zu evaluieren. Die Limitationen der Ausarbeitung bezüglich historischer Betrachtungen und umfassender Theorien zur kognitiven Entwicklung werden klar benannt.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Lernen und Kompetenz. Lernen wird als Anpassungsprozess an die Umwelt durch wiederholte Erfahrungen definiert, wobei Informationsverarbeitungsprozesse im Gedächtnis eine zentrale Rolle spielen. Kompetenz wird als die Fähigkeit beschrieben, Probleme zu lösen und Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Lernkompetenz wird detailliert anhand einer Definition der SPD Hessen erläutert und umfasst Aspekte wie die Organisation des Lernprozesses, das Bewusstsein für eigene Lernbedürfnisse und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Schließlich wird der Begriff der Förderung als Unterstützung und Hilfe bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen definiert.
3. Fördermodelle: Dieses Kapitel präsentiert zwei Fördermodelle zur Entwicklung von Lernkompetenz. Es wird zunächst das „Reciprocal Teaching“ nach Brown und Palincsar vorgestellt, welches auf vier Eckpfeilern basiert: Ausbildung exekutiver Metakognition, die Zone der nächsten Entwicklung, Anleitung durch Experten und entdeckendes Lernen. Weitere Details zu den anderen Fördermodellen werden in den folgenden Unterkapiteln behandelt, welche jedoch im Rahmen dieser Gesamtkapitelzusammenfassung nicht einzeln referiert werden.
Schlüsselwörter
Lernkompetenz, Lernkompetenzförderung, Kinder, Jugendliche, Kognitionspsychologie, Gedächtnis, Informationsverarbeitung, Förderprogramme, „Reciprocal Teaching“, Selbstinstruktionstraining, Vergleich, Effektivität, Praxisanwendung, Wissensgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Förderung von Lernkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Förderung von Lernkompetenz bei Kindern und Jugendlichen und vergleicht zwei Förderprogramme: „Reciprocal Teaching“ und das Selbstinstruktionstraining nach Lauth. Der Fokus liegt auf der Analyse der Stärken und Schwächen beider Programme sowie deren praktischer Anwendbarkeit.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf kognitionspsychologischen Grundlagen und betrachtet die Bedeutung von Gedächtnisleistungen und Informationsverarbeitungsprozessen für erfolgreiches Lernen. Der Einfluss von Jean Piagets Entwicklungstheorie wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Förderprogramme werden verglichen?
Verglichen werden das „Reciprocal Teaching“-Programm nach Brown und Palincsar und das Selbstinstruktionstraining nach Lauth. Die Arbeit analysiert deren jeweilige Ansätze und Effektivität.
Wie wird „Reciprocal Teaching“ beschrieben?
„Reciprocal Teaching“ basiert auf vier Eckpfeilern: Ausbildung exekutiver Metakognition, die Zone der nächsten Entwicklung, Anleitung durch Experten und entdeckendes Lernen. Die Arbeit beschreibt diese Eckpfeiler detailliert.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Definition und Abgrenzung von Lernen und Lernkompetenz, die Vorstellung und Analyse der beiden Förderprogramme, ein Vergleich ihrer Effektivität und Anwendbarkeit sowie die Diskussion der Bedeutung von Lernkompetenzförderung im Kontext der Wissensgesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, Begriffsklärung, den Fördermodellen (inkl. detaillierter Beschreibung von „Reciprocal Teaching“ und dem Selbstinstruktionstraining), einer Schlussbetrachtung, einem Literaturverzeichnis und einer Liste von Internetquellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Lernkompetenz, Lernkompetenzförderung, Kinder, Jugendliche, Kognitionspsychologie, Gedächtnis, Informationsverarbeitung, Förderprogramme, „Reciprocal Teaching“, Selbstinstruktionstraining, Vergleich, Effektivität, Praxisanwendung und Wissensgesellschaft.
Welche Limitationen werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit benennt Limitationen bezüglich historischer Betrachtungen und umfassender Theorien zur kognitiven Entwicklung.
Wie wird Lernen definiert?
Lernen wird als Anpassungsprozess an die Umwelt durch wiederholte Erfahrungen definiert, wobei Informationsverarbeitungsprozesse im Gedächtnis eine zentrale Rolle spielen.
Wie wird Kompetenz definiert?
Kompetenz wird als die Fähigkeit beschrieben, Probleme zu lösen und Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Lernkompetenz wird detailliert anhand einer Definition der SPD Hessen erläutert und umfasst Aspekte wie die Organisation des Lernprozesses, das Bewusstsein für eigene Lernbedürfnisse und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden.
- Quote paper
- Katharina Kantreiter (Author), 2008, Lernkompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134870