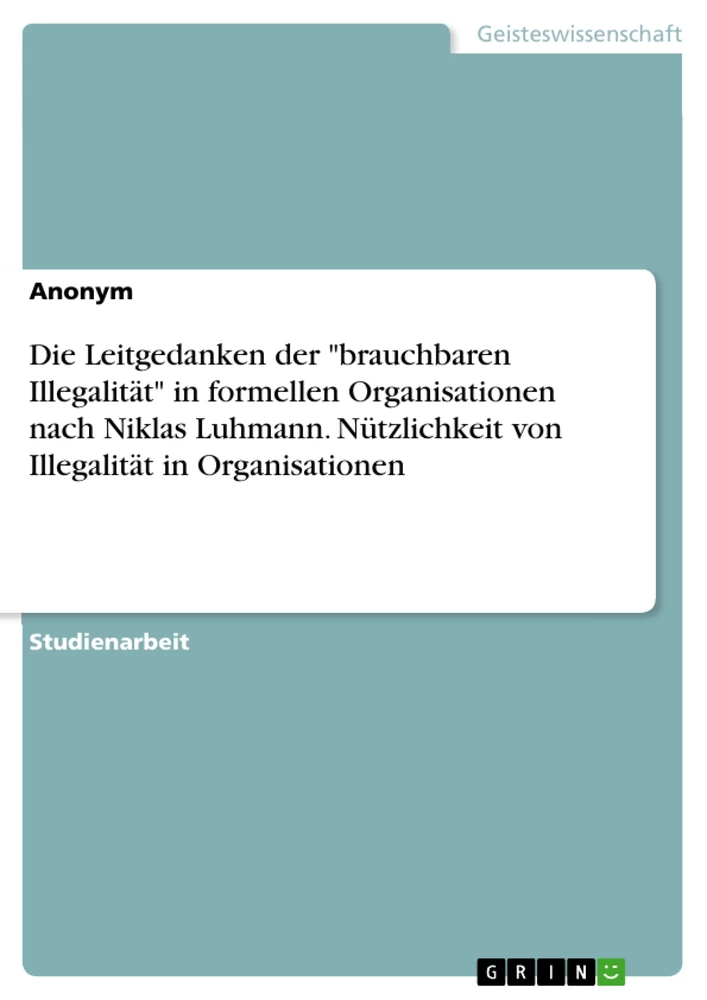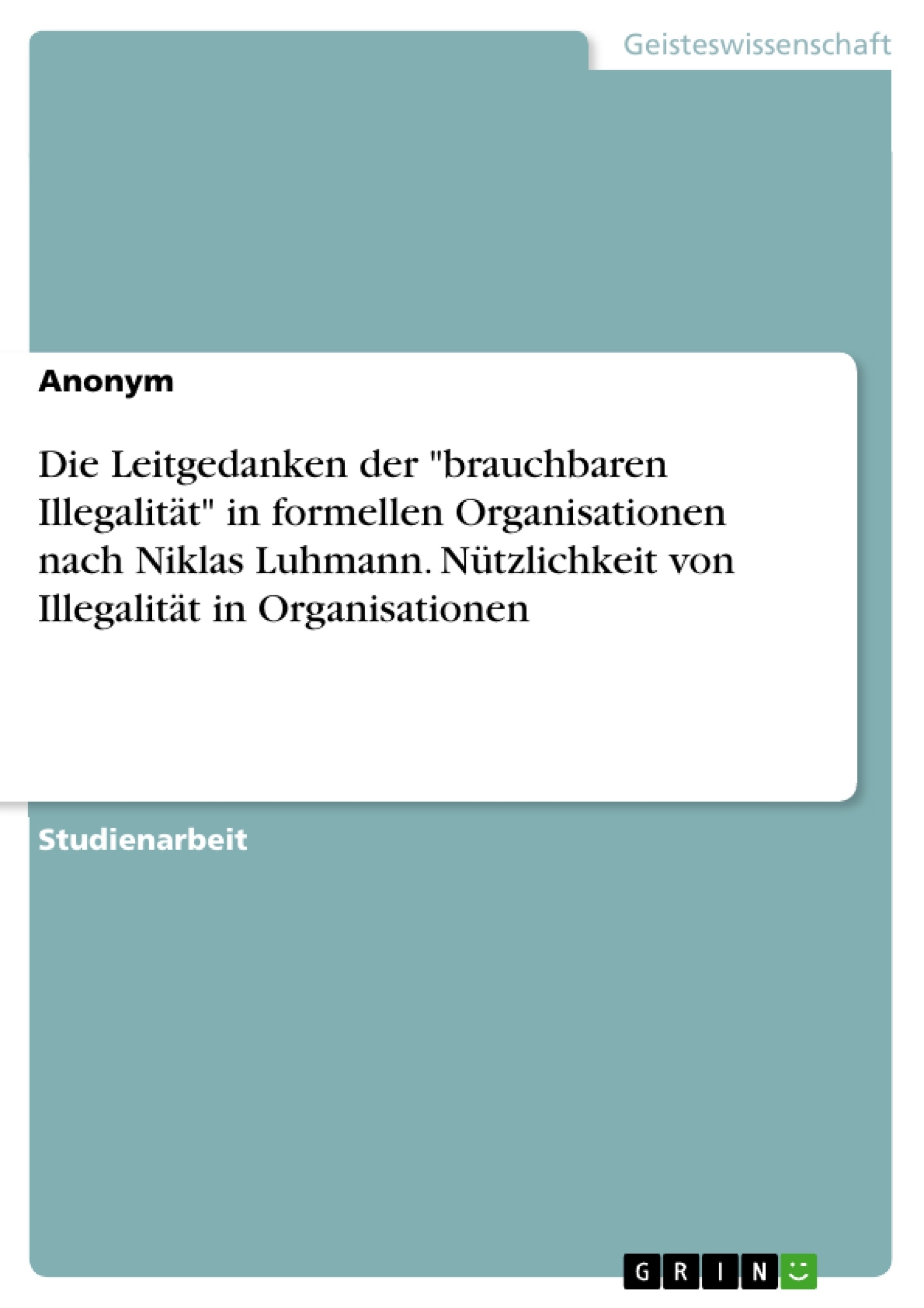Kann es in abweichenden, illegalen und nicht standesgemäßen Verhalten, sogar positive Elemente geben? Was bedeutet dies nun für eine Organisation? Laut Niklas Luhmann gibt es im Hintergrund formeller Organisationen auch informelle Organisationen. Daher möchte ich mit Niklas Luhmann der Frage nachgehen, ob Illegalität benutzt wird und somit auf sein Konzept der "brauchbaren Illegalität" eingehen.
Zu Beginn wird Luhmanns Systemtheorie anhand formaler Organisationen als Ausgangspunkt kurz vorgestellt und erläutert. Den wichtigsten Teil stellt dann die Interpretation der "brauchbaren Illegalität" dar. Im Fokus steht, was man aus dem Illegalen nutzen kann, wann es "nützlich" wird und welche Abläufe dahinter stecken. Wann ist Abweichung schädlich und wann ist sie vorteilhaft für die Organisation? Wer entscheidet darüber, und warum missachten Vorgesetzte Regeln und Normen und erklären sich? Unter welchen Umständen entsteht diese Illegalität überhaupt? Bevor die Arbeit schließlich mit einer Zusammenfassung abschließt, soll der Begriff der "brauchbaren Illegalität" auf ein praktisches Beispiel angewendet werden.
Rückblickend hat vermutlich jeder oder jede einmal gegen etablierte Normen gehandelt, beispielsweise wenn er oder sie sich als Kind traute, einen Lutscher zu stehlen, in der Straßenbahn kein Ticket zu kaufen oder über eine rote Ampel gelaufen ist. Das sind natürlich "Kleinigkeiten", aber sie machen deutlich, dass Eskapismus ein Teil unseres Lebens ist. Werden nun Unternehmen, Institutionen, Verbänden, Behörden und einer Vielzahl weiterer Organisationsformen betrachtet, so kann festgestellt werden, dass diese durch zahlreiche Verordnungen, Richtlinien und einen hohen Formalisierungsgrad gekennzeichnet sind. Regeln, Vorschriften und Standards werden kodifiziert und es wird erhofft, dass das niemand diesen Normen abweicht. Ist es überhaupt möglich Abschweifungen zu verhindern? Noch wichtiger: Müssen alle informellen Dinge blockiert werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Formelle Organisation - formelle, informelle und brauchbare Illegalität?
- 2.1 Formale Organisation und Verfahren
- 3. Nützliche illegale Handlungen am Beispiel der Unternehmensorganisationsberatung
- 3.1 Ausgangspunkt: Unternehmen und empirische Ansätze
- 3.2 Brauchbare Illegalität bei TFM
- 4. Abschließende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Niklas Luhmanns Konzept der „brauchbaren Illegalität“ im Kontext formeller Organisationen. Ziel ist es, die Nützlichkeit von abweichendem Verhalten zu beleuchten und die Bedingungen zu analysieren, unter denen Illegalität für eine Organisation vorteilhaft sein kann. Die Arbeit hinterfragt, wann und warum Regeln missachtet werden und wer über die Bewertung von Abweichungen entscheidet.
- Luhmanns Systemtheorie und ihre Anwendung auf formelle Organisationen
- Das Konzept der „brauchbaren Illegalität“ und seine Bedeutung
- Unterscheidung zwischen schädlicher und vorteilhafter Abweichung
- Analyse informeller Strukturen innerhalb formeller Organisationen
- Praktische Anwendung des Konzepts am Beispiel der Unternehmensberatung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „brauchbaren Illegalität“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Nützlichkeit illegalen Verhaltens in Organisationen. Ausgehend von alltäglichen Beispielen für Regelverstöße wird die Ambivalenz informeller Praktiken innerhalb formeller Strukturen herausgestellt. Der Fokus liegt auf Niklas Luhmanns Systemtheorie als theoretischem Rahmen und der Anwendung seines Konzepts auf die Praxis. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Untersuchung.
2. Formelle Organisation - formelle, informelle und brauchbare Illegalität?: Dieses Kapitel beschreibt Luhmanns Systemtheorie, insbesondere im Hinblick auf soziale Systeme und formelle Organisationen. Es erklärt, wie formelle Organisationen durch formalisierte Erwartungen und Regeln definiert sind und wie die Mitgliedschaft an deren Anerkennung gebunden ist. Der Abschnitt erläutert den Unterschied zwischen formalen und informellen Strukturen, um den Kontext für das Verständnis von "brauchbarer Illegalität" zu schaffen. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Auseinandersetzung mit abweichendem Verhalten.
3. Nützliche illegale Handlungen am Beispiel der Unternehmensorganisationsberatung: Dieses Kapitel wendet das Konzept der „brauchbaren Illegalität“ auf den Bereich der Unternehmensberatung an. Es werden empirische Ansätze und konkrete Beispiele diskutiert, um zu zeigen, wie abweichendes Verhalten unter bestimmten Bedingungen positive Auswirkungen auf die Organisation haben kann. Die Analyse des Beispiels „TFM“ illustriert die komplexen Zusammenhänge zwischen formalen Regeln, informellen Praktiken und organisationalem Erfolg. Es werden die Herausforderungen der Bewertung von Illegalität in diesem Kontext herausgestellt.
Schlüsselwörter
Brauchbare Illegalität, Niklas Luhmann, Systemtheorie, formelle Organisation, informelle Strukturen, Regelverstöße, Abweichung, Unternehmensberatung, empirische Ansätze, Organisationsstrukturen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Brauchbare Illegalität in formellen Organisationen
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Niklas Luhmanns Konzept der „brauchbaren Illegalität“ in formellen Organisationen. Sie beleuchtet die Nützlichkeit abweichenden Verhaltens und analysiert die Bedingungen, unter denen Illegalität für eine Organisation vorteilhaft sein kann. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, wann und warum Regeln missachtet werden und wer die Abweichungen bewertet.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf Niklas Luhmanns Systemtheorie, die angewendet wird, um formelle Organisationen und deren Strukturen zu analysieren. Die Systemtheorie dient als Rahmen, um das Konzept der „brauchbaren Illegalität“ zu verstehen und zu erklären.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Luhmanns Systemtheorie und ihre Anwendung auf formelle Organisationen; das Konzept der „brauchbaren Illegalität“ und seine Bedeutung; die Unterscheidung zwischen schädlicher und vorteilhafter Abweichung; die Analyse informeller Strukturen innerhalb formeller Organisationen; und die praktische Anwendung des Konzepts am Beispiel der Unternehmensberatung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über formelle Organisationen und die verschiedenen Arten von Illegalität, ein Kapitel mit einer Fallstudie zur Unternehmensberatung (mit dem Beispiel „TFM“) und abschließende Überlegungen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen vor. Das zweite Kapitel beschreibt Luhmanns Systemtheorie und den Unterschied zwischen formalen und informellen Strukturen. Das dritte Kapitel wendet das Konzept auf die Unternehmensberatung an und analysiert konkrete Beispiele. Die Arbeit endet mit zusammenfassenden Schlussfolgerungen.
Welches Beispiel wird in der Fallstudie verwendet?
Die Fallstudie analysiert „brauchbare Illegalität“ im Kontext der Unternehmensorganisationsberatung, wobei ein konkretes Beispiel namens „TFM“ verwendet wird, um die komplexen Zusammenhänge zwischen formalen Regeln, informellen Praktiken und organisationalem Erfolg zu illustrieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Brauchbare Illegalität, Niklas Luhmann, Systemtheorie, formelle Organisation, informelle Strukturen, Regelverstöße, Abweichung, Unternehmensberatung, empirische Ansätze, Organisationsstrukturen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Nützlichkeit von abweichendem Verhalten in formellen Organisationen zu untersuchen und die Bedingungen zu analysieren, unter denen Illegalität als vorteilhaft angesehen werden kann. Die Arbeit möchte ein tieferes Verständnis für die komplexen Interaktionen zwischen formalen Regeln und informellen Praktiken schaffen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Die Leitgedanken der "brauchbaren Illegalität" in formellen Organisationen nach Niklas Luhmann. Nützlichkeit von Illegalität in Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1348390