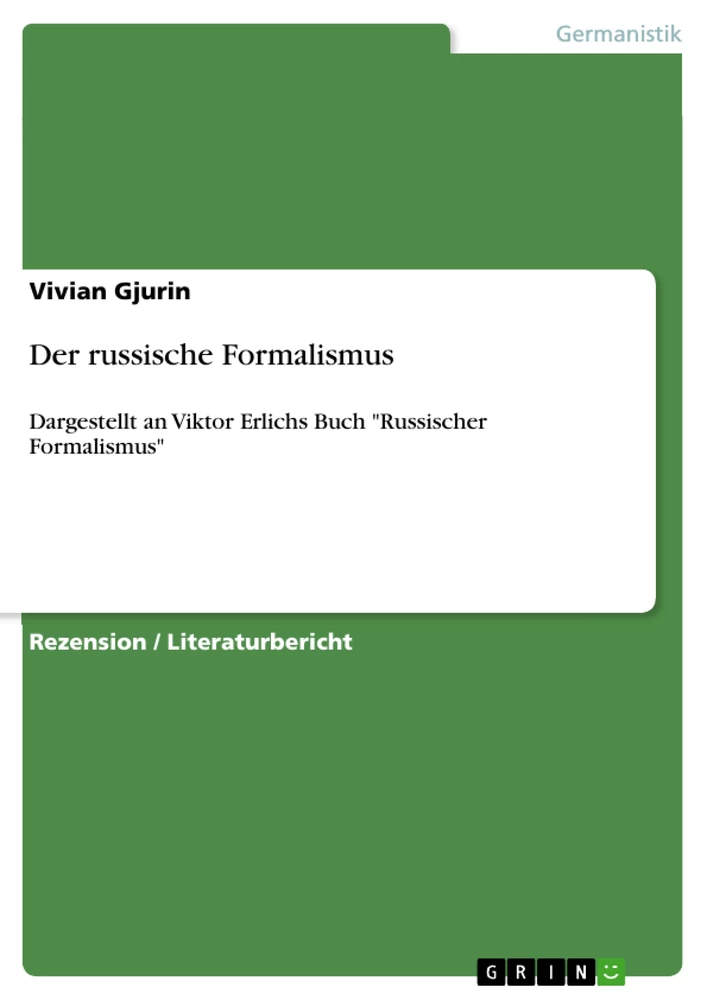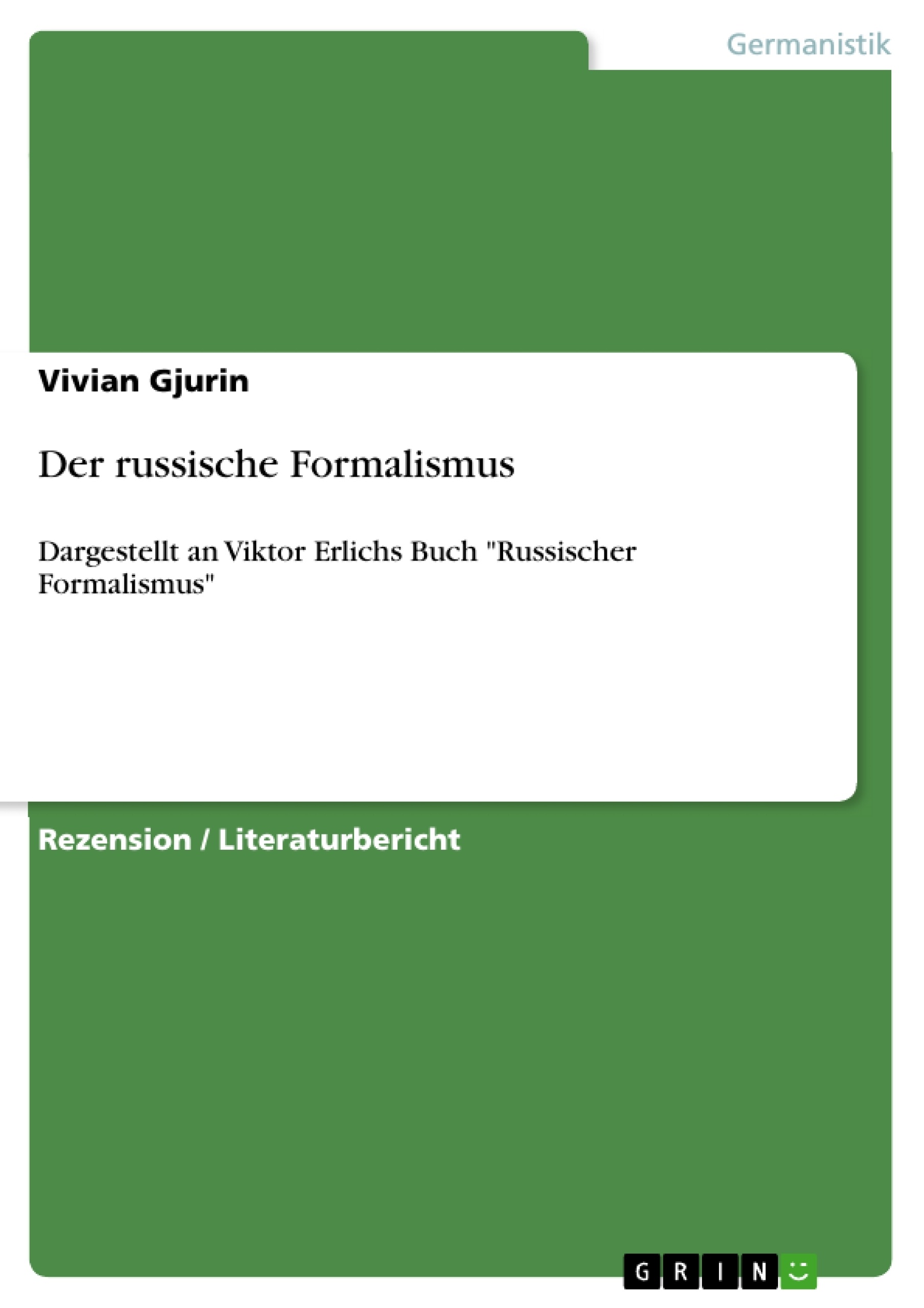„Beim Studium der Entwicklung literarischer Phänomene muss man ständig im Auge behalten, dass der Forschungsgegenstand der Literaturgeschichte nicht ist, was die Autoren sagen, sondern wie sie es sagen. Deshalb ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Literaturgeschichte, die Entwicklung von Handlungen und ... Stilen als Verkörperung des Zeitgeistes und der Persönlichkeit des Dichters zu erforschen“ Die Formalisten betrachteten Literatur als eine besondere Art der Sprachverwendung, welche die Alltagssprache intensiviert, von ihr abweicht und sie verändert. Ihr Interesse richtet sich auf die Verfahren, in denen die poetische Funktion (Jakobson) der Sprache zum Ausdruck kommt: die Eigenschaft, selbstreflexiv auf ihre formale Gestaltung zu verweisen. Mit diesem linguistisch orientierten Ansatz, der die literarischen Verfahren und Wirkungstechniken zum ausschließlichen Gegenstand der Literaturwissenschaft und zur Kennzeichnung der Literarizität überhaupt macht, wenden sich die Formalisten gegen gängige Vorstellungen von literarischen Werken als Träger von Ideen oder als realistische Widerspiegelung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die bis dato übliche Ansicht zum Verhältnis von Ausdrucksträger und Inhalt wird von ihnen umgekehrt.
Einleitung
Ich war immer der Meinung, dass „dicken“ Büchern auch eine Chance gegeben werden sollte, denn meist stellt sich heraus, dass die Anzahl der Seiten nicht sehr viel mit dem Aufwand um das Buch zu lesen und vor allem zu verstehen, zu tun hat. So auch bei dem Werk, dass ich besprechen werde. Es ist sicherlich eines der ausführlicheren über dieses Thema (noch dazu fiel mir die ungekürzte Ausgabe in die Hände). Doch ich finde, dass es trotz der Seitenanzahl und der immensen Fülle an Informationen, relativ „leicht“ zu lesen war, da prinzipiell alles erklärt wurde, bzw. es zu jedem Kapitel ein dazugehöriges Kapitel mit Anmerkungen gibt, wo weitere Erklärungen und Literaturverweise stehen. Trotzdem habe ich mich gefragt, wie ich jetzt den Inhalt dieses Buches auf vier Seiten „quetschen“ soll. Deshalb nahm ich ein zweites Buch zur Hand, wo der Formalismus in Russland auf ca.30 Seiten abgehandelt wird.[1] Ich muss zugeben, hätte ich als erstes nicht das Buch von Erlich gelesen, wäre ich bei diesem Werk teilweise etwas verwirrt gewesen und absolut überfordert. Doch trotzdem brachte mich auch dieses Werk auf der Suche nach vier Seiten präziser Besprechung nicht weiter. Deshalb beschloss ich, nur überblickmässig, Erlichs Bucheinteilung entsprechend, im ersten Kapitel die Entwicklung und das Ende des Russischen Formalismus zu schildern und im zweiten die Lehre, wobei ich in diesem aber nur versuchen werde, die grundlegende Theorie zu erklären.
I Die Geschichte
I.I Das Entstehen und die Entwicklung des Formalismus
Die Schule des Russischen Formalismus, bestehend aus Literaturkritikern und Literaturwissenschaftlern, entstand um 1915/16, erlebte in den frühen 1920-ern ihren Höhepunkt und wurde um 1930 unterdrückt.
Im Jahre 1915 gründete eine Gruppe Studenten der Moskauer Universität den „Moskauer Linguistik- Kreis“. Im darauffolgendem Jahr fanden sich in St. Petersburg einige junge Philologen und Literaturhistoriker in der „Gesellschaft zur Erforschung der poetischen Sprache“ zusammen, die bald unter dem Namen Opojaz[2] bekannt werden sollte. Am Anfang waren diese zwei Gruppen, Orte, wo junge Philologen ihre Ideen über die grundlegenden Probleme der Literaturwissenschaft ohne die Beschränkungen des offiziellen akademischen Lehrplans austauschten.
[...]
[1] Medvedev, Pavel: „Die formale Methode in der Literaturwissenschaft“, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1976
[2] ist die Abkürzung der „Gesellschaft zur Erforschung der poetischen Sprache“ auf Russisch
- Quote paper
- Mag. Vivian Gjurin (Author), 2002, Der russische Formalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134626