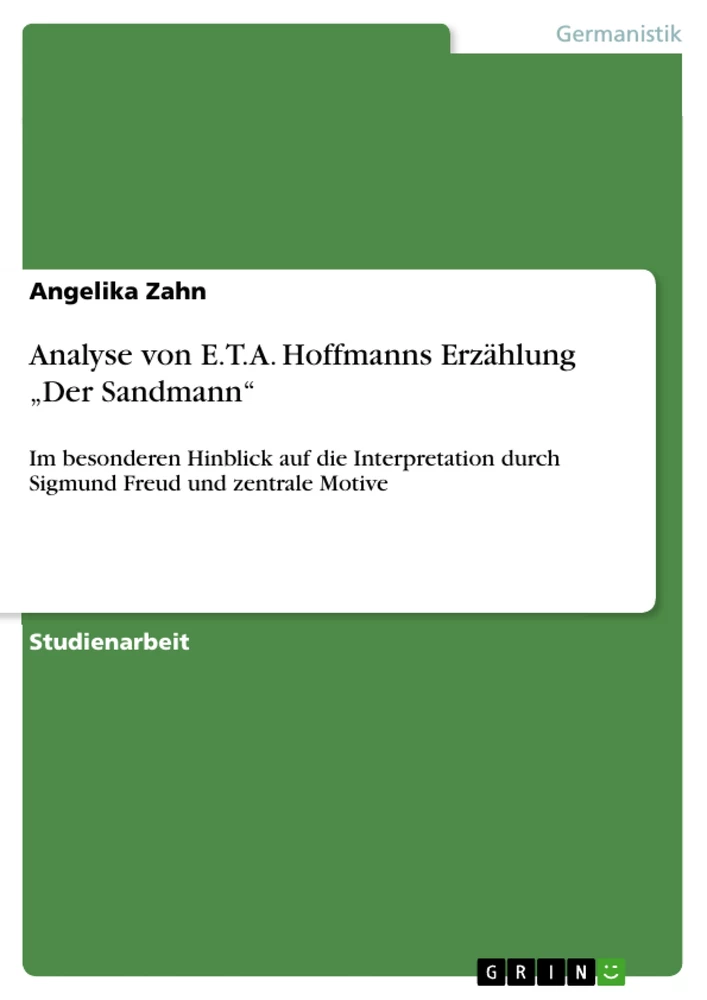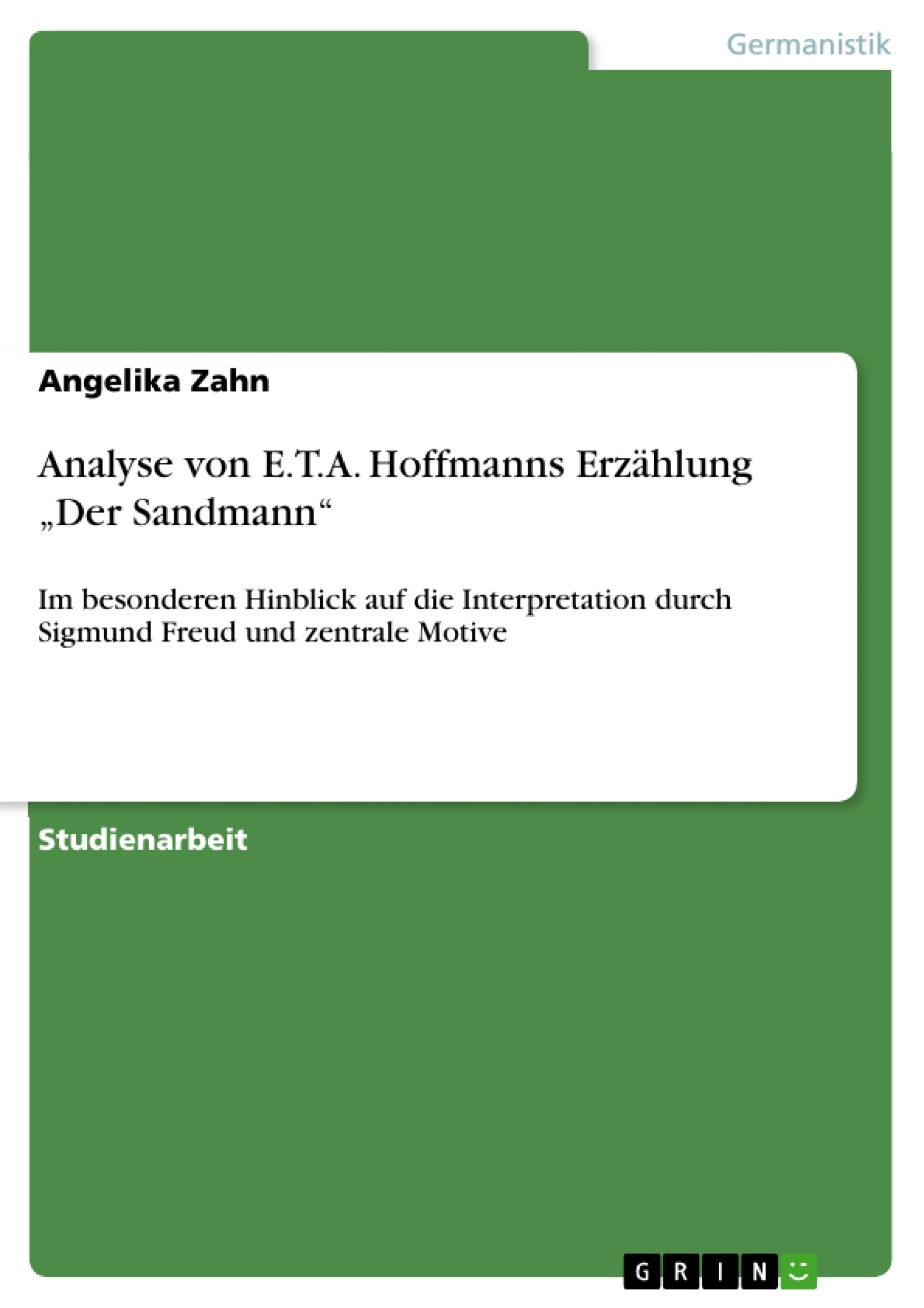Die Erzählung „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann erschien 1816 im ersten Teil des Erzählzyklus „Nachtstücke“. Im ganzen Zyklus herrscht das typisch romantische Interesse an den Nachtseiten der Natur, für das Unheimliche, Krankhafte und Verbrecherische vor. „Der Sandmann“ ist die bekannteste Erzählung der Sammlung. Sie handelt von dem Studenten Nathanael, der sich, bereits mit dem Bürgermädchen Clara verlobt, am Studienort in die Tochter eines Professors, die schöne Olimpia verliebt, bis sich herausstellt, dass diese kein Mensch, sondern ein Automat ist. Diese Täuschung und auch die wiederholte Konfrontation mit dem Schrecken seiner Kindheit, dem Sandmann, bedroht seine Identität so stark, dass sie ihn in den Wahnsinn und schließlich in den Tod treibt.
Die wohl bekannteste Analyse des „Sandmanns“ verfasste Sigmund Freud 1919 in seiner Studie über das Unheimliche und bringt hierbei die Angst vor dem Augenraub mit der Kastrationsangst in Verbindung. Die Diskussion, die daraus erwachsen ist, macht Hoffmanns erstes Nachtstück zu einer seiner meist besprochenen Erzählungen, die von vielen Interpreten unterschiedlicher wissenschaftstheoretischer Ausrichtung immer wieder neu aufgegriffen wurde.
Auf diesen Aufsatz von Freud, sowie auf verschiedene andere Interpretationsansätze soll nun hier näher eingegangen werden. Außerdem werden die zentralen Motive, von denen die Erzählung durchzogen ist und die in einer außerordentlichen Dichte vorkommen, genau untersucht und einige thematische Aspekte, wie das Automatenmotiv und die Künstlerproblematik, vorgestellt. Auch soll ein Vergleich zu der Phantastik-Definition von Todorov gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- A „Der Sandmann“ – eine vieldiskutierte Erzählung
- B Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ im besonderen Hinblick auf die Interpretation durch Sigmund Freud und zentrale Motive
- I. Sigmund Freuds „Das Unheimliche“
- 1. Versuch einer Definition des „Unheimlichen“
- 2. Die Verkörperung des „Unheimlichen“ durch Olimpia und den Sandmann
- 3. Beziehung Augenangst – Kastrationsangst
- 4. Das Doppelgängermotiv
- II. Weitere Deutungsansätze
- III. Zentrale Motive in „Der Sandmann“
- 1. Das Augenmotiv
- 2. Das Lachen
- 3. Die Treppe
- 4. Das Feuer und die Temperatur
- III. Thematische Aspekte
- 1. Der Automat
- 2. Die Künstlerproblematik
- IV. Vergleich von „Der Sandmann“ mit den Ansätzen Todorovs
- I. Sigmund Freuds „Das Unheimliche“
- C Die Rolle des Lesers bei „Der Sandmann“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“, insbesondere im Hinblick auf Sigmund Freuds Interpretation und zentrale Motive. Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Deutungsansätze zu beleuchten und die Bedeutung wichtiger Motive zu analysieren. Ein Vergleich mit Todorovs Definition von Phantastik wird ebenfalls vorgenommen.
- Freuds Interpretation des „Unheimlichen“ in Bezug auf „Der Sandmann“
- Analyse zentraler Motive wie Augen, Lachen, Treppe und Feuer
- Die Rolle des Automatenmotivs und der Künstlerproblematik
- Der Einfluss der Kindheitserfahrungen auf Nathanaels Psyche
- Die Rezeption des Textes und die Rolle des Lesers
Zusammenfassung der Kapitel
A „Der Sandmann“ – eine vieldiskutierte Erzählung: Diese Einleitung präsentiert „Der Sandmann“ als prominentes Beispiel romantischer Literatur, das sich mit dem Unheimlichen und dem Krankhaften auseinandersetzt. Sie beschreibt kurz die Geschichte von Nathanael, dessen Verstrickung in die Illusion Olimpia und die wiederkehrende Konfrontation mit dem Sandmann ihn in den Wahnsinn treiben. Die besondere Bedeutung der Freudschen Analyse und die vielfältige Rezeption der Erzählung werden hervorgehoben, um den Rahmen der folgenden detaillierten Analyse zu setzen.
B Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ im besonderen Hinblick auf die Interpretation durch Sigmund Freud und zentrale Motive: Dieser Abschnitt bildet den Kern der Arbeit und befasst sich eingehend mit Freuds Konzept des Unheimlichen und dessen Anwendung auf Hoffmanns Erzählung. Er untersucht die Verkörperung des Unheimlichen durch Olimpia und den Sandmann, beleuchtet die Verbindung von Augenangst und Kastrationsangst und analysiert weitere Deutungsansätze. Zentrale Motive werden detailliert untersucht und thematische Aspekte wie das Automatenmotiv und die Künstlerproblematik werden in den Kontext der Gesamtinterpretation eingebunden. Ein Vergleich mit Todorovs Phantastik-Theorie rundet den Abschnitt ab.
C Die Rolle des Lesers bei „Der Sandmann“: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Interaktion des Lesers mit dem Text und wie die Ambivalenz und Unsicherheit, die im Text erzeugt werden (z.B. die Frage, ob Olimpia ein Automat oder ein Mensch ist), die Interpretation und die emotionale Wirkung auf den Leser beeinflussen. Es wird untersucht, wie die offenen Fragen und die mehrdeutige Darstellung die Rezeption und das Verständnis des Textes formen und wie die emotionale Beteiligung des Lesers für das Verständnis des Unheimlichen in der Geschichte essentiell ist.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Sigmund Freud, Das Unheimliche, Augenmotiv, Automatenmotiv, Künstlerproblematik, Kastrationsangst, Phantastik, Todorov, Romantische Literatur, Interpretation, Psychoanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann", insbesondere im Hinblick auf Sigmund Freuds Interpretation und zentrale Motive. Sie beleuchtet verschiedene Deutungsansätze und analysiert die Bedeutung wichtiger Motive. Ein Vergleich mit Todorovs Definition von Phantastik wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse umfasst Freuds Interpretation des "Unheimlichen" in Bezug auf "Der Sandmann", die Untersuchung zentraler Motive wie Augen, Lachen, Treppe und Feuer, die Rolle des Automatenmotivs und der Künstlerproblematik, den Einfluss der Kindheitserfahrungen auf Nathanaels Psyche und die Rezeption des Textes und die Rolle des Lesers.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Teil A bietet eine Einleitung zu "Der Sandmann" als vieldiskutierte Erzählung. Teil B bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Erzählung detailliert unter Berücksichtigung von Freuds Interpretation und zentralen Motiven. Teil C konzentriert sich auf die Rolle des Lesers und die Interaktion mit dem Text.
Welche zentralen Motive werden untersucht?
Zentrale Motive, die im Detail untersucht werden, sind das Augenmotiv, das Lachen, die Treppe, das Feuer, das Automatenmotiv und die Künstlerproblematik. Die Verbindung zwischen Augenangst und Kastrationsangst wird ebenfalls beleuchtet.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Sigmund Freuds Konzept des "Unheimlichen" und vergleicht die Interpretation von "Der Sandmann" mit Todorovs Phantastik-Theorie. Die psychoanalytische Perspektive spielt eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielt der Leser in der Analyse?
Der Abschnitt über die Rolle des Lesers untersucht, wie die Ambivalenz und Unsicherheit im Text (z.B. die Frage, ob Olimpia ein Automat oder ein Mensch ist) die Interpretation und die emotionale Wirkung auf den Leser beeinflussen. Die offenen Fragen und die mehrdeutige Darstellung formen die Rezeption und das Verständnis des Textes.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Deutungsansätze zu "Der Sandmann" zu beleuchten, die Bedeutung wichtiger Motive zu analysieren und einen Vergleich mit Todorovs Definition von Phantastik durchzuführen. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis der Erzählung und ihrer vielschichtigen Interpretationen ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Sigmund Freud, Das Unheimliche, Augenmotiv, Automatenmotiv, Künstlerproblematik, Kastrationsangst, Phantastik, Todorov, Romantische Literatur, Interpretation, Psychoanalyse.
- Quote paper
- Magistra Angelika Zahn (Author), 2005, Analyse von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134579