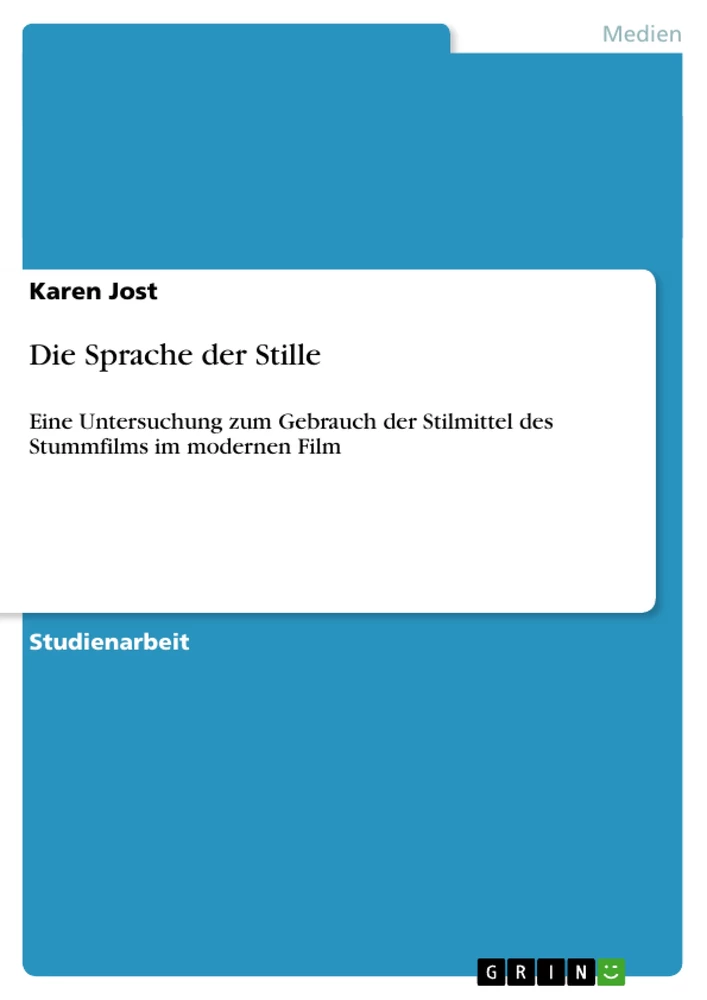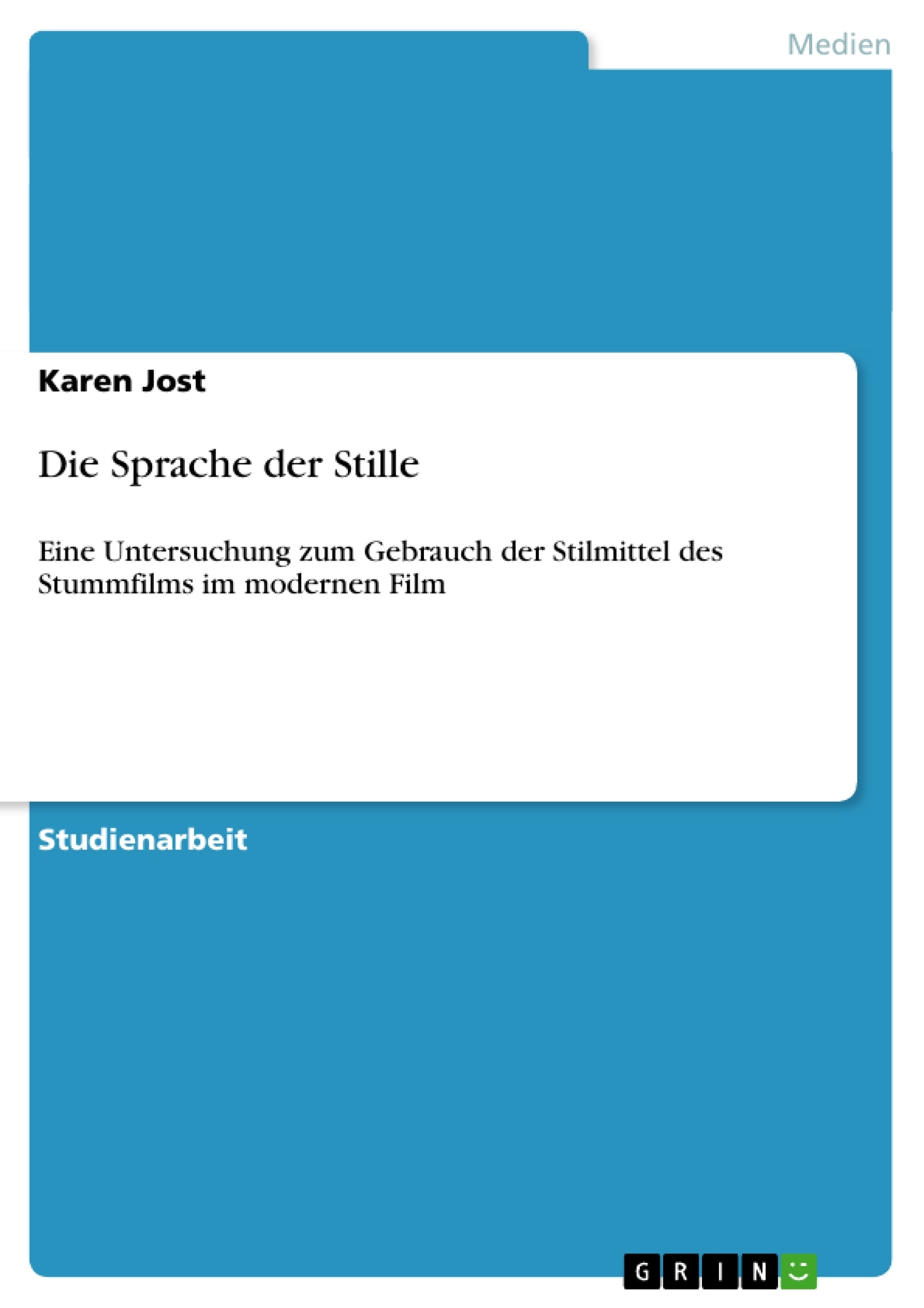Seit mittlerweile mehr als einem Jahrhundert haben die Bilder sprichwörtlich das Laufen gelernt.
Doch die Tage der euphorischen Begeisterung für ein auf der Leinwand galoppierendes Pferd
gehören lange der Vergangenheit an. Mittlerweile hat sich die siebte Kunst weit von den Problemen
der Anfangszeit entfernt und sich über die Jahre hinweg stetig neu erfunden. Machte der Film als
Erzählform zu Beginn noch den Eindruck lediglich im Schatten des Theaters zu agieren, konnte er
sich nach einiger Zeit aus dessen Schatten lösen und wurde als eigenständige Kunstrichtung
anerkannt. Der Film entwickelte Stilmittel, die allein ihm vorbehalten blieben, und konnte dadurch
Millionen von Menschen begeistern. Betrachtet man an dieser Stelle den historischen Verlauf der
Filmgeschichte, verleitet es leicht dazu zu behaupten, dass, zu Beginn der Ära Film, der Stummfilm
zu verzeichnen ist, aus welchem, mit fortschreitender Technik, der Tonfilm entstand. Doch verlief
diese Entwicklung tatsächlich so gradlinig oder gab es, während der Entwicklung vom Stummfilm
zum Tonfilm, Hürden, die nicht einzig von Seiten der Technik genommen werden mussten? Wirft
man einen Blick auf Texte, welche über die Entwicklung des Kinos berichten, trifft man mindestens
ebenso oft auf die Kritiker des Tonfilms, wie Rudolf Arnheim oder Béla Bálazs, wie auf positive
Reaktionen. Dies verleitet zu der Frage, ob es tatsächlich Disziplinen gibt, in welchen der stumme
Film dem vertonten überlegen sein könnte. Oder wurde der Stummfilm zu Recht nach dem
Erscheinen des Tonfilms beinahe vollständig verdrängt? Was sind die Raffinessen des Genres
Stummfilm und wie könnte eine zeitgerechte Produktion gestaltet sein?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Vom Stummfilm zum Tonfilm
2.1 Sprache und ihre Bedeutung im und für den Film
2.2 Ausprägungen nonverbaler Kommunikation
2.3 Definition „moderner Stummfilm“
3 Filmbeispiel: Bin-Jip
3.1 Handlung
3.2 Stilistische Mittel und Sprache im Film
3.3 Verwendung vom Sprache im Filmbeispiel
4 Fazit
Quellenverzeichnis
1 Einleitung
Seit mittlerweile mehr als einem Jahrhundert haben die Bilder sprichwörtlich das Laufen gelernt. Doch die Tage der euphorischen Begeisterung für ein auf der Leinwand galoppierendes Pferd gehören lange der Vergangenheit an. Mittlerweile hat sich die siebte Kunst weit von den Problemen der Anfangszeit entfernt und sich über die Jahre hinweg stetig neu erfunden. Machte der Film als Erzählform zu Beginn noch den Eindruck lediglich im Schatten des Theaters zu agieren, konnte er sich nach einiger Zeit aus dessen Schatten lösen und wurde als eigenständige Kunstrichtung anerkannt. Der Film entwickelte Stilmittel, die allein ihm vorbehalten blieben, und konnte dadurch Millionen von Menschen begeistern. Betrachtet man an dieser Stelle den historischen Verlauf der Filmgeschichte, verleitet es leicht dazu zu behaupten, dass, zu Beginn der Ära Film, der Stummfilm zu verzeichnen ist, aus welchem, mit fortschreitender Technik, der Tonfilm entstand. Doch verlief diese Entwicklung tatsächlich so gradlinig oder gab es, während der Entwicklung vom Stummfilm zum Tonfilm, Hürden, die nicht einzig von Seiten der Technik genommen werden mussten? Wirft man einen Blick auf Texte, welche über die Entwicklung des Kinos berichten, trifft man mindestens ebenso oft auf die Kritiker des Tonfilms, wie Rudolf Arnheim oder Béla Bálazs, wie auf positive Reaktionen. Dies verleitet zu der Frage, ob es tatsächlich Disziplinen gibt, in welchen der stumme Film dem vertonten überlegen sein könnte. Oder wurde der Stummfilm zu Recht nach dem Erscheinen des Tonfilms beinahe vollständig verdrängt? Was sind die Raffinessen des Genres Stummfilm und wie könnte eine zeitgerechte Produktion gestaltet sein?
Diese Hausarbeit wird sich im allgemeinen mit dem Gebrauch der Stilmittel des Stummfilms in einer modernen Produktion auseinandersetzen. Im engeren Sinn wird sie sich mit dem Thema Sprache im Film beschäftigen. Es soll herausgefunden werden, was die Sprache, und in diesem Zusammenhang, die Entwicklung des Tonfilms, für eine Auswirkung auf den Betrachter des Mediums Film hat. Ebenso interessant wird es sein zu untersuchen, ob ein Wegfall der Dialoge sich Film ästhetisch auswirkt. Die Arbeit unterteilt sich in drei Abschnitte. Zu Beginn wird sie sich mit Sprache und Film im allgemeinen auseinandersetzen. Als Einstieg in die Thematik dient ein kurzer Überblick zur Entwicklung des Films. Der Fokus liegt hierbei im wesentlichen auf der Reflexion der Entwicklung vom Stumm- zum Tonfilm. Hiernach wird kurz darauf eingegangen, wann die Anfänge der Tonfilmgeschichte waren und inwiefern sich der Film als Solches seitdem veränderte. Daran anschließend folgt das Thema Sprache im Film im speziellen. Welche Bedeutung hat Sprache im Film und wie wird sie vom Publikum wahrgenommen? Des weiteren soll untersucht werden, inwiefern sich die Ästhetik eines Films mit dem Gebrauch von Sprache verändert und ob die Sprache als reine, wie von technologischer Seite gern behauptet, Bereicherung für das Medium gesehen werden kann. Anschließend folgt im zweiten Teil der Arbeit die konkrete Beschäftigung mit einem Filmbeispiel. Es handelt sich bei dem Filmbeispiel um „Bin-Jip-Leere Häuser“ von Regisseur Kim Ki-duk. Ki-duk arbeitet in seinen Filmen mit, im Vergleich zu Mainstream Produktionen, außergewöhnlichen Stilmitteln. In all seinen veröffentlichten Werken wird Sprache sehr sparsam eingesetzt. Gleiches gilt für „Bin-Jip“; es handelt sich sozusagen um einen „modernen Stummfilm“. Dieser Begriff wird in einem späteren Teil der Arbeit noch genauer erläutert und definiert. Im Anschluss an eine Einführung in die Handlung „Bin-Jips“, werden die verschiedenen Stilmittel des Films herausgearbeitet und analysiert. Abschließend soll speziell darauf eingegangen werden, wie die „Stille“ des Films auf den Betrachter wirkt und welche Gefühle durch sie hervorgerufen werden. Gleichzeitig wird es interessant sein zu betrachten, an welcher Stelle Sprache eingesetzt wurde und zu welchem Zweck. Am Ende der Arbeit folgt ein Fazit.
2 Vom Stummfilm zum Tonfilm
Sucht man nach den Anfängen des bewegten Bildes, wird an einigen Stellen bis auf das 17. Jahrhundert zurück verwiesen. Jedoch ist am Ende der Recherche klar, dass der wirkliche Beginn der Ära des Films auf das Jahr 1895 datiert werden kann. Am 1. November 1895 präsentierten die Brüder Skladanowsky die weltweit erste öffentliche Aufführung von einigen kurzen Filmen. Insgesamt hatte die in Berlin stattgefundene Vorstellung lediglich eine Länge von 15 Minuten, dieser Umstand tat der Faszination der Menschen jedoch keinen Abbruch. Beinahe zeitgleich zu den aus Berlin Pankow stammenden Brüdern Skladanowsky, entwickelten auch die in Frankreich geborenen Brüder Lumiére eine Methode, um einzelne Bilder in einen filmischen Ablauf zu bringen. Sie erfanden den Cinématographen (im deutschen: Kinematographen), welcher gleichzeitig als Aufnahme-, Wiedergabe- und Kopiergerät eingesetzt werden konnte. Die Brüder Lumiére hatten den ersten öffentlichen Auftritt mit dem Cinématographen am 28. Dezember 1895 in Paris. Da die Erfindung der beiden Franzosen vielseitiger und handlicher war, setzte sie sich zum einen durch und zum anderen ihren Siegeszug gegenüber der deutschen, Bioskop genannten Apparatur, in den folgenden Jahren fort.[1] Fanden zu Beginn lediglich vereinzelt filmische Aufführungen in verschiedenen Varieté-Theatern in Europa statt, wurde im März 1897 bereits das erste feste Kino in Paris eröffnet. Kurz darauf, am 28 Dezember 1897 wurde der Film zum Industriezweig. Die Brüder Charles und Emile Pathé gründeten die Firma Cinema zur Produktion eigener Filme. Die Entwicklung von der Photographie zum bewegten Bild beschränkte sich jedoch keines Falls auf Frankreich und Deutschland. Ebenso experimentierten Erfinder Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien und den USA mit Geräten zur Aufnahme und Wiedergabe bewegter Bilder. Schon sehr früh wurde von den Filmproduzenten nach einer Möglichkeit gesucht aufgenommene Filme mit Ton zu unterlegen. Hierzu sollten der Kinematograph, sowie der Phonograph miteinander kombiniert werden. Das erste Tonfilm-Experiment wurde am 30. April 1904 einem internationalen Publikum präsentiert. Eine Verbindung zwischen dem Filmprojektor und einem Grammophon bewerkstelligte, dass beide Geräte gleichzeitig in Gang gesetzt werden konnten und Bild und Ton relativ synchron zueinander liefen. Die Kombination der beiden Apparaturen setze sich jedoch nicht durch, da die mangelnde technische Qualität der Tonwiedergabe sich gegenüber dem lauten Knattern des Projektors kaum behaupten konnte. Ferner kam hinzu, dass den Zuschauern an, zwar „stummen“, dafür aber raschen und aufregenden Bildern mehr gelegen war, als an filmischen Produktionen mit Dialogen, da diese zu dem damaligen Zeitpunkt noch eine statische Kamera erforderten und somit weit weniger „Aktion“ beinhalteten. Ein weiterer Versuch die filmischen Bilder mit Ton zu unterlegen wurde im September 1922 in Berlin uraufgeführt. Der Film „Der Brandstifter“ gilt als erster Spielfilm mit integrierter Lichttonspur. Der Tonfilm konnte sich jedoch auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchsetzen. Es heißt, die Filmproduzenten lehnten ihn weniger aus technischen, als viel mehr aus künstlerischen Gründen ab und vertraten mehrheitlich die Meinung, dass der Stummfilm in seinen Ausdrucksmöglichkeiten dem Tonfilm in jeder Hinsicht überlegen sei.
Erst am 6. Oktober 1927 und somit fast 32 Jahre nach der offiziellen „Stunde Null“ der Filmgeschichte, beginnt der Tonfilm seinen endgültigen Siegeszug. Der von Warner Bros. Produzierte Film „Der Jazzsänger“ lieferte mit einem 250 Worte umfassenden Monolog den ersten Sprechbeitrag und gleichzeitig einen weiteren Meilenstein der Filmgeschichte.[2] In den folgenden Jahren löste die neue Technik nach und nach die Alte ab. Die Zahl der Tonfilmkinos stieg rasant an, während die Anzahl der Stummfilmkinos schrumpfte. Das Publikum war letztendlich so begeistert, dass keine Firma an der neuen, aber extrem kostenintensiven Technik, vorbei kam. Der Tonfilm war nicht etwa eine weitere Option neben dem Stummfilm, sondern er ersetzte diesen rasch und vollständig. Was der Ton an positiven Neuerungen für Wochenschau, dokumentarische Werke und Nachrichten Sendungen mit sich brachte, begrenzte er jedoch bei dem Aspekt der Filmkunst. Aufgrund dessen, dass die Technik noch in den Kinderschuhen steckte, hatten Schauspieler und Regisseure beim drehen eines Tonfilms einen wesentlich geringeren künstlerischen Handlungsspielraum, als beim Dreh eines Stummfilms. So mussten beispielsweise die Schauspieler darauf achten, dass sie ihren Text ausschließlich in die Richtung sprachen, in jener sich das Mikrophon befand und die Regisseure waren gezwungen auf Schnitte und anspruchsvolle Montagetechnik zu verzichten, da vertonte Aufnahmen nachträglich nicht mehr bearbeitet werden konnten. Im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte entwickelte sich (und entwickelt sich fortlaufend) die Tontechnik weiter, wurde ausgefeilter und qualitativ immer hochwertiger, bis sie zu dem geworden ist, was wir gegenwärtig mit Dolby Digital bezeichnen. Die oben beschriebenen Probleme der zwanziger und dreißiger Jahre des vergangen Jahrhunderts gehören, unter Anderem durch neue Methoden der Vertonung bis hin zum kabellosen Mikrophon, der Vergangenheit an. Wie später zu sehen sein wird, haben Weiterentwicklungen und neue Verfahrensmethoden den Film nicht nur technisch vorangebracht, sondern das Medium selbst hat sich verändert.
Die Eckdaten der Entwicklung des Films, sowie im Speziellen, die der Entstehung des Tonfilms, sind nun bekannt. Es wurde bereits angesprochen, dass der Tonfilm nicht nur Begeisterung, sondern ebenfalls einige negative Kritiker auf den Plan rief. Weshalb es die schlechten Kritiken für den Ton gab, liegt, zumindest für die frühen Jahre des Films, auf der Hand. Die Schauspieler und Regisseure wurden durch die schlechte Vertonungstechnik stark eingeschränkt. Jedoch waren die technischen Defizite nicht der alleinige Grund für die negativ ausfallende Kritik, denn auch in den folgenden Jahren gab es Stimmen, die sich, zwar weniger gegen den Gebrauch von Ton als Stilmittel, sondern viel mehr gegen die Vorherrschaft von Dialogen in Filmen, aussprachen. Die Gründe und der Ursprung dieser Meinungen der Kritiker soll im folgenden Teil erörtert werden.
2.1 Sprache und ihre Bedeutung im und für den Film
Die frühen Filmaufführungen als stumm zu bezeichnen, ist im Grunde genommen paradox, denn stumm waren die Aufführungen nie. Es war in den Anfangsjahren des Films lediglich technisch nicht möglich eine synchrone Tonspur der Filmaufnahme zu erzeugen. Aus diesem Grunde griffen die Veranstalter der damaligen Zeit auf Orchester oder Filmerklärer zur akustischen Begleitung zurück. Das Orchester spielte, zum einen, um die lauten Geräusche der Projektoren zu übertönen, zum anderem, um das Gezeigte musikalisch zu unterlegen. Die Aufgabe des Filmerklärers bestand darin, das Publikum über die Handlung und die Dialoge des Film zu informieren.[3] Die Rolle des Kinobesuchers war in den Anfangsjahren des Kinos ebenso wenig mit der des heutigen Zuschauers zu vergleichen, wie das Medium Film selbst. Denn auch das Kinopublikum war alles andere als „stumm“ und glich dem heutigen Zuschauer in seinem Verhalten nicht im geringsten. Das damalige Publikum war sehr präsent, es wurde spontan geklatscht, gelacht, mitgesungen, geflüstert oder gerufen.[4] Ferner ist es treffender, den Film selbst, wie es bereits von Michael Chion vorgeschlagen wurde, nicht als stumm, sondern vielmehr als „Taubfilm“ zu bezeichnen, da die Schauspieler in den Filmen häufig kein „stummes Schauspiel“ aufführten, sondern der Ton lediglich nicht gehört werden konnte.[5] Abgesehen von den externen Mitteln Filme kommunikativer zu machen, ihnen eine Melodie zu geben bzw. sie zu erklären, blieben sie doch aus technischer Sicht weiterhin tonlos. Um die Defizite der tonlosen Informationsübermittlung zu überwinden, bedienten sich die Regisseure u.A. der Methode der „übertriebenen Darstellung“, welche jedoch schon früh in der Kritik stand:
Die althergebrachte Pantomime strebte danach, Ideen durch Bewegungen mitzuteilen, so als ob die Personen taub, und stumm wären. Zwar floss auch die natürliche Handlung des stummen Lichtspiels in die Entwicklung der Geschichte ein, doch einzelne Gedanken wurden durch unnatürliche Handbewegungen angedeutet. Wenn zum Beispiel ein Schauspieler dem anderen anzuzeigen wünschte, er wolle etwas trinken, so bildete er mit der Hand die Form eines Bechers nach, und er vollzog dann die Bewegung des Trinkens. Diese Art Pantomime sieht man immer noch zu häufig beim Spiel in Filmen, doch es gibt eine Tendenz, davon abzugehen. Dahinter steht der Gedanke, dass ein Film um so überzeugender auf die Zuschauer wirkt, je näher er dem wirklichen Leben zu sein scheint. Der moderne Regisseur von Rang wird nun die Pantomime so weit als möglich meiden und zum Beispiel den Wunsch zu trinken andeuten, indem er den Darsteller eine plausible Handlung ausführen lässt, welche dieses vermittelt.(...)[6]
[...]
[1] Leisen, Johannes (Hrsg.). Der Cinèmatograph. 35Millimeter: Texte zur internationalen Filmkunst. http://www.35millimeter.de/filmgeschichte/frankreich/1895/der-cinematograph.42.htm (27.04.2009).
Leisen, Johannes (Hrsg.). Erste Filmvorführung der Skladanowskys. 35Millimeter: Texte zur internationalen Filmkunst. http://www.35millimeter.de/filmgeschichte/deutschland/1895/erste-filmvorfuehrung-der-skladanowskys.41.htm (27.04.2009).
[2] Die historischen Daten des Abschnitts stammen aus: Beier/Kopka/Michatsch/(u.A.): Die Chronik des Films. Gütersloh/München 1994, S.8ff.
[3] Eine ausführliche Beschreibung des Arbeitsfeldes des Filmerklärers und speziell der Japanischen Kultur des Benshis findet sich in: Lewinsky, Marianne: Eine verrückte Seite. Stummfilmund filmische Avangarde in Japan, Zürich 1997, S. 107ff.
[4] Vgl. Wahl, Chris: Das Sprechen des Spielfilms. Über die Auswirkungen von hörbaren Dialogen auf Produktion und Rezeption, Ästhetik und Internationalität der siebten Kunst. Trier 2005, S.5.
[5] Ebd., S.3.
[6] KINtop S. 37. Zitiert nach: Frank Woods, »Spectators Comments«, New York Dramatic Mirror, vol. 62 no. 1612, 13. 11. 1909, S. 15.
- Quote paper
- Karen Jost (Author), 2009, Die Sprache der Stille, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134411