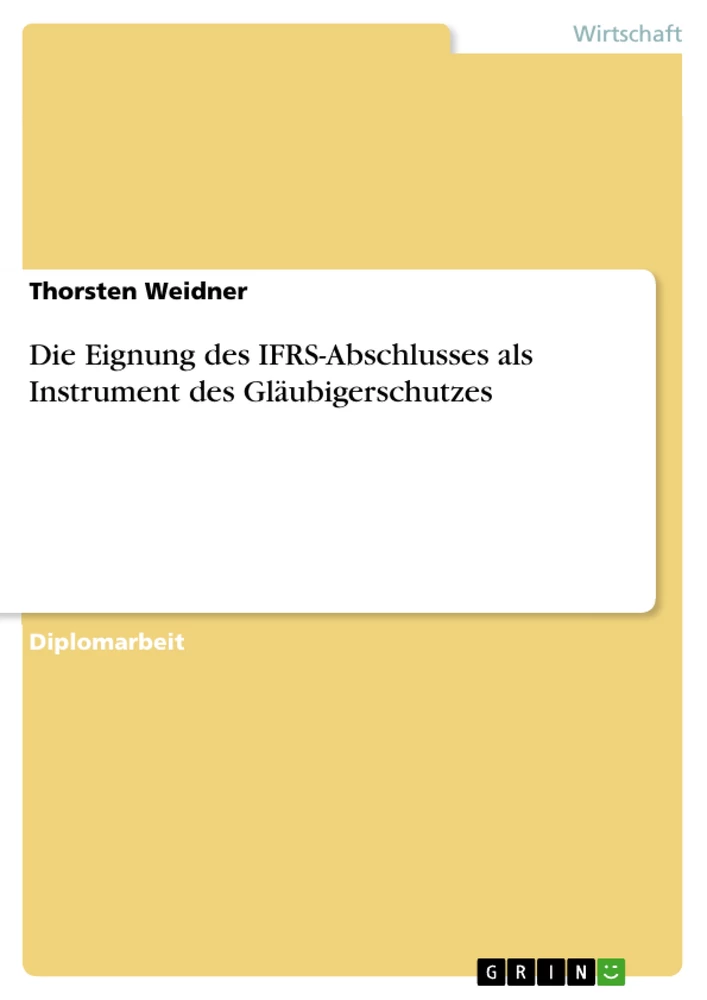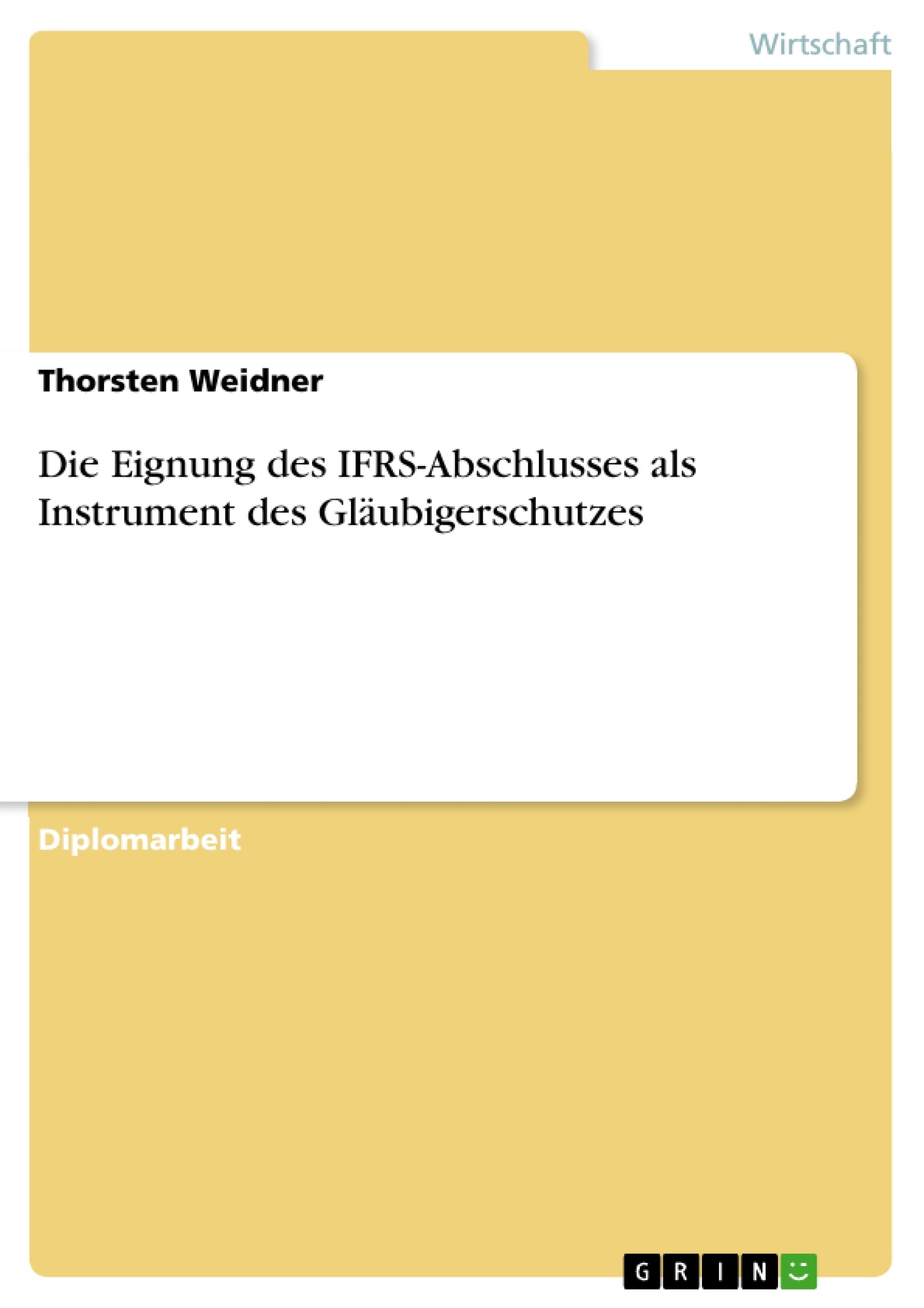„IFRS-Jahresabschlüsse sind prinzipiell auch für Ausschüttungszwecke geeignet“, bescheinigt eine KPMG-Studie im Auftrag der EU-Kommission zur Kapitalerhaltung. Jedoch zeigt die Studie ebenfalls auf, dass es insbesondere aufgrund der Fair Value-Bewertung ohne Sicherungsmaßnahmen zu hohen, bestandsgefährdenden Ausschüttungen kommen kann. Die in jüngster Zeit entbrannte Reformdebatte um die Änderung des europäischen Kapitalschutzsystems beschäftigt sich vor allem mit der Frage, inwiefern die IAS/IFRS dem Gläubigerschutz dienen und somit Grundlage für die Ausschüttungsbemessung sein können. Gleichzeitig ist eine zunehmende Zurückdrängung des HGB – als rechnungsmäßige Grundlage der Kapitalerhaltung – durch die IFRS zu beobachten. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auf die anhaltende Kritik an der mangelnden Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die europäische IAS-Verordnung den Mitgliedstaaten die Verwendung von IFRS im Einzelabschluss für die Bestim-mung der Ausschüttungen ermöglicht. Während eine Vielzahl der EU-Staaten dies bereits praktiziert, erlaubt Deutschland den IFRS-Einzelabschluss lediglich für Informationszwecke. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die IFRS einen wirksamen Schutzbeitrag für Gläubiger leisten können. Dieser setzt neben einer Ge-winnermittlungskonzeption, die als Begrenzung unangemessener Vermögensausschüttungen herangezogen werden kann, auch einen effektiven informationellen Gläubigerschutz voraus.
Mit der vorliegenden Arbeit soll die Eignung der IFRS zur Erfüllung eines effektiven Gläubigerschutzes untersucht werden. Dazu werden eingangs die sich gegenüberstehenden Gläubigerschutzkonzepte dargestellt. Im Anschluss stellt sich die Frage, ob die Vorschriften des IASB im Besonderen und Rechnungslegungsinformationen im Allgemeinen dazu geeignet sind, Gläubigern entscheidungsnützliche Angaben zu vermitteln und so einen Beitrag zu einem wirksamen informationellen Gläubigerschutz leisten können. Sodann wird aus ökonomischer Sicht die Bedeutung und Wirkung von Ausschüttungsbegrenzungen erläutert. Hierbei wird geprüft, ob bilanzielle Ausschüttungsrestriktionen und eine vorsichtige Bilanzierungsweise dem Gläubigerschutz nützlich sind. Darauf aufbauend wird beurteilt, ob die IFRS eine gläubiger-schützende Ausschüttungsbemessungsfunktion erfüllen und damit Grundlage für bereits bestehende gesellschaftsrechtliche Höchstausschüttungsregeln sein können.
Inhaltsverzeichnis
1 Problemstellung
2 Gläubigerschutz- und Informationsfunktion
2.1 Institutioneller Gläubigerschutz durch bilanzielle Kapitalerhaltung
2.2 Informationeller Gläubigerschutz
3 IFRS: Gläubigerschutz durch Information?
3.1 Anforderungen der Gläubiger an informative Rechnungslegung
3.1.1 Entscheidungsnützlichkeit der Informationen
3.1.2 Abbau der Informationsasymmetrie
3.1.3 Prognose des Schuldendeckungspotentials
3.2 Ergänzung durch vertraglichen Gläubigerschutz
3.3 Beurteilung der Schutzwirkung
4 Gläubiger-Eigner-Konflikt in haftungsbeschränkten Unternehmen: Zur Notwendigkeit bilanzieller Ausschüttungsrestriktionen
4.1 Gläubigerrisiken durch Agency-Probleme
4.1.1 Gläubigerschädigende Investitionsanreize
4.1.2 Liquidations- und fremdfinanzierte Ausschüttungen
4.2 Ökonomische Wirkungen bilanzieller Ausschüttungsrestriktionen
5 Eignung der IFRS-Rechnungslegung für die bilanzielle Kapitalerhaltung
5.1 Analyse ausgesuchter IAS/IFRS
5.1.1 Aktivierung von Entwicklungskosten
5.1.2 Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge
5.1.3 Gewinnrealisierung bei langfristiger Auftragsfertigung
5.1.4 Passivierungskonzeption nach IFRS
5.1.5 Fair Value-Bewertung und Ausschüttungsbemessung
5.2 Gläubigerschützende Anpassung der IFRS-Bilanz
5.2.1 Ausschüttungssperren und erhöhte Rücklagenbildung
5.2.2 Situative Ausschüttungsbegrenzung – Idee eines Solvenztests
6 Fazit
7 Thesenförmige Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Problemstellung
„IFRS-Jahresabschlüsse sind prinzipiell auch für Ausschüttungszwecke geeignet“[1], bescheinigt eine KPMG-Studie im Auftrag der EU-Kommission zur Kapitalerhaltung.[2] Jedoch zeigt die Studie ebenfalls auf, dass es insbesondere aufgrund der Fair Value-Bewertung ohne Sicherungsmaßnahmen zu hohen, bestandsgefährdenden Ausschüttungen kommen kann.[3] Die in jüngster Zeit entbrannte Reformdebatte um die Änderung des europäischen Kapitalschutzsystems beschäftigt sich vor allem mit der Frage, inwiefern die IAS/IFRS[4] dem Gläubigerschutz dienen und somit Grundlage für die Ausschüttungsbemessung sein können.[5] Gleichzeitig ist eine zunehmende Zurückdrängung des HGB – als rechnungsmäßige Grundlage der Kapitalerhaltung – durch die IFRS zu beobachten.[6] Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auf die anhaltende Kritik an der mangelnden Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zurückzuführen.[7] Hinzu kommt, dass die europäische IAS-Verordnung[8] den Mitgliedstaaten die Verwendung von IFRS im Einzelabschluss für die Bestimmung der Ausschüttungen ermöglicht. Während eine Vielzahl der EU-Staaten dies bereits praktiziert,[9] erlaubt Deutschland den IFRS-Einzelabschluss lediglich für Informationszwecke.[10] Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die IFRS einen wirksamen Schutzbeitrag für Gläubiger leisten können. Dieser setzt neben einer Gewinnermittlungskonzeption, die als Begrenzung unangemessener Vermögensausschüttungen herangezogen werden kann, auch einen effektiven informationellen Gläubigerschutz voraus.
Mit der vorliegenden Arbeit soll die Eignung der IFRS zur Erfüllung eines effektiven Gläubigerschutzes untersucht werden. Dazu werden eingangs die sich gegenüberstehenden Gläubigerschutzkonzepte dargestellt. Im Anschluss stellt sich die Frage, ob die Vorschriften des IASB im Besonderen und Rechnungslegungsinformationen im Allgemeinen dazu geeignet sind, Gläubigern entscheidungsnützliche Angaben zu vermitteln und so einen Beitrag zu einem wirksamen informationellen Gläubigerschutz leisten können. Sodann wird aus ökonomischer Sicht die Bedeutung und Wirkung von Ausschüttungsbegrenzungen erläutert. Hierbei wird geprüft, ob bilanzielle Ausschüttungsrestriktionen und eine vorsichtige[11] Bilanzierungsweise dem Gläubigerschutz nützlich sind. Darauf aufbauend wird beurteilt, ob die IFRS eine gläubigerschützende Ausschüttungsbemessungsfunktion erfüllen und damit Grundlage für bereits bestehende gesellschaftsrechtliche Höchstausschüttungsregeln sein können.
Angesichts der zu verzeichnenden Regelungsdichte der IFRS muss im Rahmen dieser Arbeit auf eine Untersuchung der Gläubigerschutzwirkung sämtlicher Einzelregelungen verzichtet werden. Das besondere Augenmerk gilt aber den Normen, die möglicherweise einen wesentlichen Einfluss auf den Gläubigerschutz aufweisen und daher näher zu betrachten sind. Außen vor bleiben auch die Beurteilung einer möglichen steuerlichen Zahlungsbemessungsfunktion der IFRS sowie die Wirksamkeit anderer Gläubigerschutzinstrumente, wie z.B. Mindestkapitalziffer oder Aktienrückkaufvorschriften.
2 Gläubigerschutz- und Informationsfunktion
2.1 Institutioneller Gläubigerschutz durch bilanzielle Kapitalerhaltung
Das gegenwärtige europäische System des gesellschaftlichen Kapitalschutzes soll die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft, ausgelöst durch eine ökonomisch ungerechtfertigte Ausschüttung an beschränkt haftende Gesellschafter, vermeiden. Die Grundkonzeption der Kapitalaufbringung und -erhaltung regelt die Zweite gesellschaftsrechtliche Richtlinie (Kapitalrichtlinie) aus dem Jahr 1976[12], die in den Mitgliedstaaten der EU umgesetzt wurde. In Deutschland sind Rechnungslegung und Gesellschaftsrecht eng miteinander verbunden. Dieses Recht beinhaltet eine Vielzahl von Schutzvorschriften für Interessensgruppen, insbesondere für Gläubiger und Eigner. Konflikte zwischen diesen sollen durch die Rechnungslegung gemildert werden. So haben nach § 29 Abs. 1 Satz 2 GmbHG die Gesellschafter einer GmbH Anspruch auf den Bilanzgewinn. Für die Aktiengesellschaft gilt § 57 Abs. 3 AktG, wonach „unter die Aktionäre nur der Bilanzgewinn verteilt werden“ darf. Der nach § 158 AktG ermittelte Bilanzgewinn wird durch die Bilanzierungs- und Bewertungsregeln des Handelsrechts bestimmt, welche besonders durch das Vorsichts-, Realisations- und Imparitätsprinzip geprägt sind.[13] Die Beachtung der handelsrechtlichen GoB bewirkt, dass Chancen und Risiken asymmetrisch berücksichtigt werden.[14] Eine übervorsichtige Bilanzierung durch die „informationsfeindlichen“[15] GoB ist aus Sicht des Gesetzgebers wenig bedenklich, da das Ausschüttungspotential für die Eigner nicht verloren geht, sondern nur zeitlich nach hinten verlagert wird.[16] Begründet wird dies außerdem mit dem Risiko, dass zu hoch ausgeschüttete Beträge die Haftungssubstanz des Unternehmens aufzehren können. Ein weiterer Grund ist, dass die Eigner nach Leistung ihrer Einlage nicht mehr haften.[17] Der Gläubigerschutz nimmt im deutschen Bilanzrecht damit eine Vorrangstellung ein.
Die Effektivität des Gläubigerschutzes durch die handelsrechtliche bilanzielle Gewinnermittlung und die anknüpfenden Gewinnverwendungsregeln wird durch stark vergangenheitsbezogene Werte der Bilanz eingeschränkt. Ob die Gesellschaft in Zukunft fähig sein wird ihre Gläubigeransprüche zu bedienen, lässt sich somit anhand des Jahresabschlusses nicht mit letzter Gewissheit voraussagen.[18] Aus diesem Grund verlangt der Gesetzgeber ein bestimmtes Mindestkapital und eine gesetzliche Rücklage, deren Schutzwirkung in der Literatur angezweifelt wird.[19] Durch Gewinnverwendungsregeln wird dem Gläubigerschutzgedanken zusätzlich Rechnung getragen. Gläubiger sollen vor zu hohen Ausschüttungen geschützt werden, indem der Jahresüberschuss gegebenenfalls um Beträge zu kürzen ist, die in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden müssen (§ 150 Abs. 1 und 2 AktG). Bestimmte „unsichere“ Aktivposten, sog. Bilanzierungshilfen, sind ausschüttungsgesperrt.[20] Schließlich haben Vorstand und Aufsichtsrat bei der Feststellung des Jahresabschlusses die Möglichkeit bis zu 50% des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen (§ 58 Abs. 2 AktG).
Fraglich ist, ob das System der gesellschaftsrechtlichen Kapitalerhaltung auch mit Übernahme der IFRS in den Einzelabschluss beibehalten werden könnte. Das traditionell kontinental-europäische System der bilanzgestützten Kapitalerhaltung sieht sich derzeit zunehmend durch die Innovationen bei der Rechnungslegung in Frage gestellt. Die wachsende Hinwendung zu einer informationsorientierten Rechnungslegung, namentlich der IFRS, nährt die Befürchtung, dass den traditionellen Kapitalschutzregeln das rechnungsmäßige Fundament entzogen wird.[21]
Gegenwärtig wird die Notwendigkeit eines Gläubigerschutzes durch Kapitalerhaltung häufig hinterfragt.[22] Angesichts einer durchschnittlichen Konkursquote von 3 bis 4% bei nicht bevorrechtigten Forderungen, werden Zweifel an der Wirksamkeit des Gläubigerschutzkonzepts durch vorsichtige Bilanzierung geäußert.[23] Neben der Inflexibilität und Ineffizienz der Kapitalschutzregeln, die die Finanzierungsfreiheit der Gesellschaft einschränken,[24] gilt vor allem die Möglichkeit der Legung stiller Reserven, die ebenso still wieder aufgelöst werden können, als gläubigerschädigend.[25] Der im Folgenden dargestellte informationelle Gläubigerschutz stellt die radikalste Alternativkonzeption zur bilanziellen Kapitalerhaltung dar. Es gilt herauszuarbeiten, ob ein solcher Schutz durch Information die Nachteile des institutionellen Gläubigerschutz durch bilanzielle Kapitalerhaltung beseitigt und den Anforderungen eines wirksamen Gläubigerschutzsystems genügt.
2.2 Informationeller Gläubigerschutz
Informationeller Gläubigerschutz zielt darauf ab, die Gläubigerstellung durch eine verbesserte Rechnungslegungsinformation über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Schuldnerunternehmens zu verbessern.[26] Gläubiger sollen auf Basis dieser Informationen die Möglichkeit erhalten, die Liquidität und Solvenz aktueller und potentieller Schuldnerunternehmen zu beurteilen.[27] Die Zielsetzung der IFRS ist es, „Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (…) zu geben, die für einen weiten Adressatenkreis bei dessen wirtschaftlichen Entscheidungen nützlich sind“[28]. Die Ausrichtung der IFRS auf die Informationsfunktion als übergeordnetes Ziel,[29] lässt somit vermuten, dass sie generell für einen Gläubigerschutz durch Information – einen Schutz durch Informationsversorgung – geeignet sind.[30] Gläubiger sind primär an Informationen interessiert, inwieweit das Schuldnerunternehmen in der Lage ist, die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungszahlungen fristgerecht leisten zu können, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz und der dabei dann eintretende Kreditverlust ist.[31] Sofern sich auf Basis der IFRS-Rechnungslegung ein informationeller Gläubigerschutz realisieren ließe, der in etwa eine gleichwertige Schutzwirkung wie der institutionelle Gläubigerschutz erreicht, wäre letzterer möglicherweise überflüssig.[32]
Für einen Wechsel zu einem informationellen Gläubigerschutzkonzept und gegen zwingende Kapitalerhaltungsregeln, die im europäischen und deutschen Raum äußerst streng ausgeprägt sind, wird angeführt, dass diese aufgrund der zunehmenden Transparenz und Effizienz der Kapitalmärkte hinfällig sind. Die Kapitalerhaltungsregeln entsprächen einem veralteten europäischen Gläubigerbild. Der Gläubiger als „Objekt paternalistischer Fürsorge“[33] sei nicht in der Lage, das Risiko seiner Kapitalbeiträge selbst einzuschätzen. Im Gegensatz dazu steht das angloamerikanische Bild des zu rationalen Entscheidungen befähigten Gläubigers, der anhand unverzerrter Informationen Kreditvergabeentscheidungen selbstverantwortlich bewältigt.[34] Diese unterschiedliche Sicht auf den Gläubiger ist dadurch begründet, dass sich die Kapitalmärkte in den USA sehr viel früher entwickelt haben als in Kontinentaleuropa. Während in den USA die Eigenkapitalfinanzierung dominierte, waren deutsche Unternehmen in der Vergangenheit vorwiegend fremdfinanziert.[35] Investitionen wurden relativ selten durch Kapitalerhöhungen finanziert. Anpassungsprozesse führten aber dazu, dass auf europäischen Kapitalmärkten die Eigenkapitalgeber an Bedeutung gewannen und sich eine Aktienkultur entwickelte.[36] Der Übergang des Kapitalmarkts von einer fremdkapitalorientierten zu einer eigenkapitalorientierten Unternehmensfinanzierung stellt somit den Hintergrund für eine notwendige Umstellung auf ein informationelles Gläubigerschutzkonzept dar.[37]
3 IFRS: Gläubigerschutz durch Information?
3.1 Anforderungen der Gläubiger an informative Rechnungslegung
3.1.1 Entscheidungsnützlichkeit der Informationen
Grundvoraussetzung für einen informationellen Gläubigerschutz sind entscheidungsnützliche Informationen über die aktuellen oder potentiellen Schuldnerunternehmen. Jahresabschlussinformationen sind entscheidungsnützlich, wenn sie entscheidungsrelevant und hinreichend verlässlich sind.[38] Informationen sind für Gläubiger dann relevant, wenn sie ihre wirtschaftlichen Entscheidungen bei der Kreditvergabe beeinflussen. Relevanz und Verlässlichkeit stehen aber gewissermaßen in einem Austauschverhältnis. So ist die Information über die Fähigkeit des Schuldners zukünftige Cashflows zu generieren für Gläubiger relevanter, als die Information über den Cashflow des abgeschlossenen Geschäftsjahrs, sie ist jedoch weniger verlässlich. Diese beiden Qualitätskategorien stehen regelmäßig in einem „immanenten Spannungsverhältnis“[39] zueinander. Relevante Informationen benötigen aber ein Mindestmaß an Verlässlichkeit. Ihre glaubwürdige Darstellung und ihre intersubjektive Nachprüfbarkeit sind notwendige Bedingungen für Relevanz.[40]
Vielfach wird bezweifelt, ob die IFRS dem Erfordernis der Objektivierung und Willkürfreiheit gerecht werden. Kritisiert wird insbesondere die Fair Value-Bewertung durch Bewertungsmodelle bei fehlenden beobachtbaren Marktpreisen und die daraus resultierende Ausweitung der Ermessensspielräume.[41] Rechnungslegungsinformationen verfügen aus Sicht der Gläubiger über Entscheidungsrelevanz, wenn sie als Grundlage für Prognosen dienen, vor allem bei der Einschätzung über die Fähigkeit des Unternehmens seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Bilanzen sind für den Kalkül der Gläubiger nützlich, wenn deren Aktiv- und Passivposten auf das Vorhandensein von Ein- und Auszahlungspotentialen hinweisen.[42] Ein informationeller Gläubigerschutz auf Basis der IFRS setzt daher eine informative Aktivierungs- und Passivierungskonzeption voraus und sollte demzufolge zum Ansatz all derjenigen Positionen führen, die Ein- oder Auszahlungspotentiale verkörpern.
3.1.2 Abbau der Informationsasymmetrie
Schuldner besitzen gegenüber ihren Gläubigern naturgemäß einen Informationsvorsprung über ihre eigene finanzielle Situation. Das Management des Schuldnerunternehmens hat einen Anreiz, über künftig erwartete Zahlungsströme unvollständig zu informieren, um so günstigere Konditionen auszuhandeln. Für Gläubiger besteht das erhöhte Risiko der Auswahl eines Schuldners mit hoher Kreditausfallwahrscheinlichkeit (adverse selection).[43] Der informationelle Gläubigerschutz dient der Reduktion vorvertraglicher Informationsasymmetrien zwischen Fremdkapitalgeber und -nehmer durch prognosetaugliche Informationen über die Höhe, Zeitpunkt des Anfalls und das Risiko künftiger Zahlungsströme.[44] Die IFRS mit dem vorrangigen Ziel der Informationsvermittlung versuchen die ex ante bestehende Informationsasymmetrie zu reduzieren. Kreditgeber sind durch bessere Information in der Lage, potentielle Kreditnehmer zu beurteilen.[45]
Ein überwiegend zu Fair Values aufgestellter IFRS-Abschluss könnte ein geeignetes Instrument zur Schätzung künftiger Cashflows sein und damit einen Beitrag zu einem informationellen Gläubigerschutz leisten. Fair Values haben durchaus einen Bezug zu künftigen Zahlungsströmen. Als Beispiel dient die Wertminderung auf den erzielbaren Betrag nach IAS 36. Danach ist der erzielbare Betrag der niedrigere Wert aus Nutzungswert und Fair Value abzüglich Veräußerungskosten, dem sog. Nettoveräußerungswert.[46] Bei Annahme rationalen Verhaltens des Managements wird der Vermögenswert tatsächlich weiter im Unternehmen eingesetzt, wenn sein Nutzungswert den Nettoveräußerungswert übersteigt. Umgekehrt ist er zu veräußern. In beiden Konstellationen sind folglich die jeweils erzielbaren Zahlungsmittelzuflüsse in der Bilanz zutreffend wiedergegeben.[47] In anderen Fällen der Fair Value-Bewertung fehlt der Zahlungsstrombezug. Als Beispiel dienen hier Finanzinstrumente, die als „available for sale“[48] klassifiziert wurden sowie Immobilien, die zur Erzielung von Mieteinnahmen gehalten werden.[49] Aufgrund der fehlenden Veräußerungsabsicht, weisen ihre Fair Value-Bewertung in Form von Marktwerten (und nicht zu Ertragswerten) nur zufällig einen Bezug zu künftigen Cashflows auf.[50]
Bei Kreditvergabeentscheidungen spielt die Einschätzung der Schuldendeckungsfähigkeit der potentiellen und derzeitigen Schuldnerunternehmen eine entscheidende Rolle. Im Folgenden wird analysiert, ob der IFRS-Abschluss präzise und zeitnahe Informationen zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlage für Gläubiger liefert. Zudem wird beurteilt, ob Rechnungslegungsinformationen grundsätzlich als Prognoseinstrument geeignet sind.
3.1.3 Prognose des Schuldendeckungspotentials
Das Schuldendeckungspotential kann entweder dynamisch oder statisch interpretiert werden. Erstere beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, Auszahlungsverpflichtungen im Zeitablauf zu decken, während eine statische Betrachtung das Ausmaß beurteilt, inwieweit der Schuldner durch Zerschlagung seines Vermögens seinen Verpflichtungen nachkommen kann.[51] Gläubigern steht zur Prognose des Schuldendeckungspotentials und deren Entscheidungskalkül meist nur der Jahresabschluss des potentiellen Schuldnerunternehmens zur Verfügung. Eine Bilanz auf Basis der traditionellen handelsrechtlichen Rechnungslegung liefert grundsätzlich stark vergangenheitsbezogene und durch die Betonung des Vorsichtsprinzips verzerrte Informationen.[52] Dies wirkt sich negativ auf die Prognoseeignung von Rechnungslegungsinformationen aus. Im Vergleich zum handelsrechtlichen Abschluss kann der IFRS-Abschluss einen zusätzlichen Informationsnutzen für Gläubiger erzielen, wenn aus ihm vermehrt zukünftige Ein- und Auszahlungspotentiale abgeleitet werden können.
Das Rahmenkonzept zu den IAS benennt Adressaten und deren Informationsbedürfnisse. Danach sind „Kreditgeber interessiert an Informationen, anhand derer sie beurteilen können, ob ihre Darlehen und die damit verbundenen Zinsen bei Fälligkeit gezahlt werden“[53]. Die Interessen der Gläubiger und der Investoren sind im Grunde gleichgerichtet.[54] Gläubiger unterscheiden sich aber von Investoren typischerweise dadurch, dass ihr Erfolgspotential von vornherein eingeschränkt ist. Sie erhalten eine fixe Verzinsung, während der Kapitaleinsatz der Eigner in Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg vergütet wird.[55] Daher interessieren sie sich weniger für zukünftige Wachstumspotentiale und Chancen des Schuldnerunternehmens, als für Werte wie Sicherheit und Stabilität.[56] Vorrangiges Informationsinteresse der Gläubiger ist somit die Beurteilung der Fähigkeit der aktuellen und potentiellen Schuldnerunternehmen, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.[57] Zahlungsansprüche der Gläubiger sind ausfallbedroht, wenn die Zahlungsüberschüsse des Schuldnerunternehmens nicht ausreichen, um ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen. Eine Fair Value-Bilanz, zeigt das Schuldendeckungspotential zutreffender als eine Bilanz auf Basis des Anschaffungskostenprinzips, falls die Fair Values als Marktwerte im Sinne von hypothetischen Veräußerungswerten (exit values) interpretiert werden.[58]
Grundsätzlich informieren Bilanzen nur über einen Teil der künftigen Zahlungen. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten sind bis zur Aufstellung des Jahresabschluss nicht mehr zahlungswirksam.[59] Baraufwendungen, wie z.B. Löhne der nächsten Rechnungsperiode sucht man in Bilanzen vergebens. Außerdem sind deren Fälligkeitszeitpunkte und Liquiditätsaussichten nur grob erkennbar.[60] Dieses Informationsinteresse lässt sich letztendlich nur mit Hilfe von Finanzplänen befriedigen. Bilanz und GuV können bestenfalls mittelbar ein Beitrag dazu leisten.[61] Ein IFRS-Abschluss auf Grundlage von Fair Values könnte jedoch grundsätzlich besser geeignet sein als ein handelsrechtlicher Abschluss das Schuldendeckungspotential marktnäher abzubilden, da Fair Values vermehrt an zukünftige Zahlungsströme anknüpfen.[62] Jedoch ist einzuwenden, dass auf unvollkommenen Märkten Fair Values wenig verlässlich sind und es dadurch fraglich ist, ob diese in den Kapitalvergabekalkül der Gläubiger einfließen.[63] Ferner führt eine erfolgswirksame Fair Value-Erhöhung eines Vermögensgegenstands lediglich zu einem zahlungsunwirksamen Ertrag, der für kurzfristige Zins- und Tilgungsauszahlungen an Gläubiger nicht zur Verfügung steht.[64] Schließlich darf der Nutzen einer Bilanz bei Kreditwürdigkeitsprüfungen nicht überschätzt werden. Die Einschätzung der Risiken einer Kreditvergabe erfolgt nicht nur durch Bilanz und GuV. Weitere Informationen wie z.B. über das Geschäftsmodell eines Unternehmens besitzen eine hohe Entscheidungsrelevanz für die Gläubiger und können aus Bilanzen nicht herausgelesen werden.[65]
3.2 Ergänzung durch vertraglichen Gläubigerschutz
In den USA wird der (unzureichende) informationelle Gläubigerschutz regelmäßig durch zusätzliche Sicherungsinstrumente flankiert. Vertragliche Nebenabreden (sog. covenants) können in Form von Restriktionen, die den Handlungsspielraum des Schuldners für die Dauer des Kredits eingrenzen, vorliegen. Hierzu zählen typischerweise Realsicherheiten, wie Garantien, Sicherungsübereignungen oder Restriktionen auf Grundlage der Rechnungslegung.[66] US-amerikanische Kreditverträge beinhalten vor allem auch sog. dividend covenants, die unmittelbar die Ausschüttung an die Anteilseigner beschränken.[67] Des Weiteren werden financial und accounting covenants vereinbart. Erstere fordern die Einhaltung bestimmter finanzwirtschaftlicher Kennzahlen und beschränken so die Fremdkapitalneuaufnahme, während accounting covenants die Basisrechnungslegung in eine individuelle Vertragsrechnungslegung überleiten, welche gläubigerschützende Anpassungen enthalten kann.[68] Die Ausgestaltung und allgemeine Verbreitung von covenants in Kreditverträgen in der Praxis könnte möglicherweise Aufschluss über die Schutzbedürftigkeit der Gläubiger in weniger regulierten Rechtssystemen geben. Empirische Studien zeigen, dass covenants in Rechtssystemen ohne zwingende Kapitalerhaltungsregeln wie den USA, den Regeln des HGB ähneln.[69]
Eine Ursache für die fehlende Eignung der US-GAAP, welche mit den IFRS vergleichbar sind, zur Ausschüttungsbegrenzung wird vor allem in der regelmäßigen Vereinbarung von accounting covenants gesehen.[70] In Kreditverträgen wird die US-GAAP derart modifiziert, dass die Aktiva tendenziell niedriger bewertet werden und zu einem späteren Gewinnausweis führen. Dies führt zu der Vermutung, dass der Markt nach vorsichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften verlangt, wenn sie nicht regulativ verordnet wurden.[71] Vielfach wird deshalb in der Ausgestaltung der covenants ein Beleg für die Notwendigkeit bilanzieller Kapitalerhaltung gesehen.[72] Im Umkehrschluss wird daraus geschlossen, dass die vom Vorsichtsprinzip geprägte deutsche Rechnungslegung ein zweckmäßiges Gläubigerschutzinstrument darstellt.[73] Dieser Argumentation ist zunächst entgegenzuhalten, dass die Differenzen zwischen den gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften überwiegen.[74] Des Weiteren bezweifelt Ewert die Aussagefähigkeit der empirischen Erkenntnisse über die grundsätzliche Vorteilhaftigkeit vorsichtiger Bilanzierung für den Gläubigerschutz.[75] Während die Studie von Leftwich[76], auf die regelmäßig Bezug genommen wird,[77] lediglich zehn Kreditverträge mit Versicherungsunternehmen untersuchte, zeigen andere Studien eine enorme Bandbreite der vereinbarten Parameter auf.[78] Außerdem liegen die Untersuchungszeiträume der Studien zu weit in der Vergangenheit, so dass aus ihnen keine aktuellen Kreditvergabepraktiken abgeleitet werden können.[79] Neuere Studien dokumentieren vielmehr einen Rückgang von dividend covenants in Kreditverträgen.[80]
Als Nachteil des informationellen Gläubigerschutzes und der dadurch notwendigen zusätzlichen Schutzklauseln in Kreditverträgen wird angeführt, dass eben diese Vereinbarungen erstens nicht unerhebliche Transaktionskosten für die Vertragsparteien verursachen und sie zweitens lediglich von verhandlungsstarken Gläubigern durchsetzbar sind.[81] Zwar profitieren alle anderen Gläubiger über das Phänomen des Trittbrettfahrerverhaltens (free riding)[82] gleichermaßen von den in den covenants enthaltenen Ausschüttungsschranken und sonstigen gläubigerschützenden Maßnahmen. Im Krisenfall werden Großgläubiger jedoch eine vorzeitige Begleichung der eigenen Ansprüche eher durchsetzen können.[83] Transaktionskosten entstehen durch Verhandlung, Durchsetzung und spätere Überwachung der Einhaltung der covenants.[84] Die Kosten schätzt Ewert allerdings als gering ein, da Kreditverträge für gewöhnlich ohnehin unternehmensspezifische Klauseln enthalten.[85] Ferner weist Ballwieser darauf hin, dass sich bei vertraglichen Lösungen Musterverträge entwickeln können, die zwar ähnlich schematisch wie eine gesetzliche Lösung sind, aber in Bezug auf Transaktionskosten eine positive Wirkung entfalten können.[86]
3.3 Beurteilung der Schutzwirkung
Die Schutzwirkung eines informationellen Gläubigerschutzes hängt maßgeblich von einem umfassenden Potentialausweis und einer prognosefähigen Gewinngröße ab. Es ist zweifelhaft, ob die IFRS diesem Maßstab gerecht werden. Der IFRS-Abschluss erfasst Ein- und Auszahlungspotentiale eines Unternehmens nicht vollständig. Ansatzlücken innerhalb der Aktiva bestehen insbesondere bei immateriellen Vermögenswerten. Vor allem das Definitionskriterium der Beherrschung[87] verhindert den Ansatz einer Reihe von Werten, wie z.B. Kundenloyalität, Kundenlisten, Werbefeldzüge und Mitarbeiter-Know-how.[88] Außerdem bedingt das Merkmal der Identifizierbarkeit[89] die Nichtaktivierung weiterer immaterieller Werte, die sich nicht eindeutig vom Goodwill trennen lassen. Zu nennen sind hier insbesondere Standortvorteile, Kundenzufriedenheit, Lieferantenbeziehungen.[90] Für selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte in der Forschungsphase besteht ein Aktivierungsverbot.[91] In der Entwicklungsphase setzt ihre Aktivierung die kumulative Erfüllung bestimmter Kriterien voraus.[92] Darüber hinaus zeigen die Buchwerte der immateriellen Vermögenswerte im Falle einer Aktivierung regelmäßig nicht ihren wahren ökonomischen Wert. Dies liegt unter anderem daran, dass in der Praxis die Neubewertungsmethode bei der Folgebewertung faktisch keine Relevanz besitzt.[93] Auf der Passivseite des IFRS-Abschlusses werden Auszahlungspotentiale vor allem deshalb nicht passiviert, weil der wirtschaftliche Nutzenabfluss im Zusammenhang mit der Erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung wahrscheinlich sein muss.[94] Somit kann festgehalten werden, dass die IFRS eine vollständige Erfassung der Vermögenswerte und Schulden als zukünftige Ein- und Auszahlungspotentiale verhindern und in dieser Hinsicht keinen umfassenden Gläubigerschutz durch Information gewährleisten.
[...]
[1] Vgl. KPMG-Pressemitteilung vom 01.02.2008 zur KPMG-Studie im Auftrag der EU-Kommission zur Kapitalerhaltung, abrufbar unter: http://www.kpmg.de/6378.htm, [Stand: 01.04.2008].
[2] Vgl. KPMG-Studie im Auftrag der EU-Kommission zur Kapitalerhaltung: Feasibility study on an alternative to the capital maintenance regime established by the Second Company Law Directive, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/internal_market/company/capital/index_de.htm, [Stand: 01.04.2008].
[3] Vgl. KPMG-Pressemitteilung, a.a.O.
[4] Im Folgenden verkürzt: IFRS.
[5] Zur Übersicht über die Reformvorschläge für das europäische Kapitalschutzsystem vgl. Pellens, Bernhard/Jödicke, Dirk/Schmidt, André: Reformbestrebungen zum Gläubigerschutz, in: Der Konzern, 5. Jg. (2007), S. 427-435, hier S. 430-432.
[6] Vgl. Schön, Wolfgang: Die Zukunft der Kapitalaufbringung/-erhaltung, in: Der Konzern, 2. Jg. (2004), S. 162-170, hier 164.
[7] Vgl. Herzig, Norbert: Notwendigkeit und Umsetzungsmöglichkeiten eines gespaltenen Rechnungslegungsrechts (Handels- und Steuerbilanz), in: KoR, 1. Jg. (2001), S. 154-159, hier S. 155.
[8] Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.7.2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, ABl. EG Nr. L 243/1 vom 11.9.2002.
[9] Vgl. KPMG-Pressemitteilung, a.a.O.
[10] Vgl. § 325 Abs. 2a HGB.
[11] Nach herrschender Meinung spiegelt sich eine vorsichtige Bilanzierungsweise vor allem in einer asymmetrischen Behandlung von Chancen und Risiken und in einem späten Gewinnrealisationszeitpunkt wider, vgl. hierzu Leffson, Ulrich: Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 7. Aufl., Düsseldorf 1987, S. 467.
[12] Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976, Amtsblatt Nr. L 026 vom 31/01/1977, S. 0001 – 0013.
[13] Vgl. Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus J./Merkt, Hanno: Kommentierung zu § 252, in: Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus (Hrsg.): Handelsgesetzbuch, 31. Aufl., München 2003, Tz. 10-14.
[14] Vgl. zur Diskrepanz von Informationsfunktion und Ausschüttungsbemessung Schön, Wolfgang: Gesellschafter-, Gläubiger- und Anlegerschutz im Europäischen Bilanzrecht, in: ZGR, 29. Jg. (2000), S. 706 – 742, hier S. 706f.
[15] Steiner, Eberhard/Gross, Beatrix: Auswirkungen des Bilanzrechtsreformgesetzes auf die Rechnungslegung, in: StuB, 6. Jg. (2004), S. 551-558, hier S. 552.
[16] Vgl. Wagenhofer, Alfred/Ewert, Ralf: Externe Unternehmensrechnung, Berlin u.a. 2003, S. 185-187.
[17] Vgl . Schildbach, Thomas: Der handelsrechtliche Jahresabschluß, 6. Aufl., Berlin 2000, S. 32.
[18] Vgl. Veil, Rüdiger: Kapitalerhaltung – Das System der Kapitalrichtlinie versus situative Ausschüttungssperren, in: Marcus Lutter (Hrsg.): Das Kapital der Aktiengesellschaft in Europa, ZGR Sonderheft 17, Berlin 2006, S. 91-113, hier S. 105.
[19] Vgl. Bezzenberger, Tilmann: Das Kapital der Aktiengesellschaft, Köln 2005, S. 192.
[20] Vgl. Schildbach, Thomas: a.a.O., S.165-170.
[21] Vgl. Schön, Wolfgang: a.a.O., S. 164.
[22] So besonders deutlich von Böcking, Hans-Joachim/Dutzi, Andreas: Gläubigerschutz durch IFRS-Rechnungslegung im Jahresabschluss und ergänzenden Solvenztest, in: Krawitz, Norbert (Hrsg.): Rechnungslegung nach internationalen Grundsätzen, ZfB, 76. Jg. (2006), Special Issue 6, S. 1-23.
[23] Vgl. Merkt, Hanno: IFRS und die Folgen für den Kapitalschutz im Gesellschaftsrecht, in: Börsig, Clemens/Wagenhofer, Alfred (Hrsg.): IFRS in Rechnungswesen und Controlling, Frankfurt am Main u.a. 2006, S. 89-109, hier S. 97.
[24] Vgl. Jungmann, Carsten: Solvenztest– versus Kapitalschutzregeln – Zwei Systeme im Spannungsfeld von Gläubigerschutz und Finanzierungsfreiheit der Kapitalgesellschaft, in: ZGR, 35. Jg. (2006), S. 638-682, hier 641.
[25] Kübler, Friedrich: Institutioneller Gläubigerschutz oder Kapitalmarkttransparenz? – Rechtsvergleichende Überlegungen zu den „stillen Reserven“, in: ZHR, 159. Jg. (1995), S. 550-566, hier S. 560.
[26] Vgl. Kübler, Friedrich: a.a.O., S. 560.
[27] Vgl. Niehues, Michael: EU-Rechnungslegungsstrategie und Gläubigerschutz, in: WPg, 54. Jg. (2001), S. 1209-1222, hier S. 1210.
[28] IAS-Framework, Tz. 12.
[29] Vgl. IAS-Framework, Tz. 12.
[30] Vgl. Niehues, Michael: a.a.O.: S. 1219.
[31] Vgl. Lange, Christoph: Jahresabschlussinformationen und Unternehmensbeurteilung, Stuttgart 1989, S. 16.
[32] Vgl. Merschmeyer, Marc: Die Kapitalschutzfunktion des Jahresabschlusses und Übernahme der IAS/IFRS für die Einzelbilanz, Frankfurt 2005, S. 273.
[33] Kübler, Friedrich: a.a.O., S. 555.
[34] Vgl. Kübler, Friedrich: a.a.O., S. 555.
[35] Vgl. Herzig, Norbert/Watrin, Christoph: Rechnungslegung und Marktkontrolle – Nachwort zum ersten Schmalenbach-Gutenberg-Symposium, in: Frese, Erich/Hax, Herbert (Hrsg.): Das Unternehmen im Spannungsfeld von Planung und Marktkontrolle, ZfbF Sonderheft 44, Düsseldorf 2000, S. 133-161, hier S. 141f.
[36] Vgl. Sprissler, Wolfgang: Gläubigerschutz durch Kapitalerhaltung?, in: IDW (Hrsg.): Kapitalmarktorientierte Unternehmensüberwachung, Düsseldorf 2001, S. 85-102, hier S. 89.
[37] Vgl. Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft: Zur Fortentwicklung des deutschen Bilanzrechts, in: BB, 57. Jg. (2002), S. 2372-2381, hier S. 2375.
[38] Vgl. IAS-Framework, Tz. 24-46.
[39] Baetge, Jörg/Zülch, Henning: Fair Value-Accounting, in: BFuP, 53. Jg. (2001), S. 543-562, hier S. 559.
[40] Vgl. Pfaff, Dieter/Kukule, Wilfried: Wie fair ist der fair value?, in: KoR, 6. Jg. (2006), S. 542-549, hier S. 542.
[41] Vgl. Streim, Hannes/Bieker, Marcus/Esser, Maik: Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen durch Fair Values – Sackgasse oder Licht am Horizont?, in: BFuP, 55. Jg. (2003), S. 457-479, hier S. 473; vgl. ferner Baetge, Jörg/Zülch, Henning/Matena, Sonja: Fair Value-Accounting – Ein Paradigmenwechsel auch in der kontinentaleuropäischen Rechnungslegung? (Teil B) –, in: StuB, 4. Jg. (2002), S. 417-422, hier 419f.
[42] Streim, Hannes/Esser, Maik: Rechnungslegung nach IAS/IFRS – Ein geeignetes Instrument zur Informationsvermittlung?, in: StuB, 6. Jg. (2003), S. 836-840, hier S. 837.
[43] Vgl. Baetge, Jörg/Lienau, Achim (2005a): Der Gläubigerschutzgedanke im Mixed Fair Value-Modell des IASB, in: Schneider, Dieter u.a. (Hrsg.): Kritisches zu Rechnungslegung und Unternehmensbesteuerung, Festschrift zur Vollendung des 65. Lebensjahres von Theodor Siegel, Berlin 2005, S. 65–86, hier S. 67.
[44] Streim, Hannes/Bieker, Marcus/Esser, Maik: a.a.O., S. 470.
[45] Lienau, Achim: Gläubigerschutz durch Solvency Tests auf der Basis eines IFRS-Abschlusses, in: KoR, 8. Jg. (2008), S. 79-88, hier S. 81.
[46] Vgl. IAS 36.18.
[47] Vgl. Thiele, Stefan: Zeitbewertung und Rechnungslegungsgrundsätze, in: Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (Hrsg.): Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung – Festschrift zum 70. Geburtstag von Jörg Baetge, Düsseldorf 2007, S. 625-644, hier S. 636.
[48] IAS 39.46.
[49] Vgl. IAS 40.30.
[50] Vgl. Thiele, Stefan: a.a.O., S. 636.
[51] Vgl. Lange, Christoph: a.a.O., S. 16.
[52] Vgl. Ballwieser, Wolfgang: Zum Nutzen handelsrechtlicher Rechnungslegung, in: Ballwieser, Wolfgang u.a. (Hrsg.): Rechnungslegung – warum und wie – Festschrift für Hermann Clemm, München 1996, S. 1-25, hier S. 9.
[53] IAS-Framework, Tz. 9 (c).
[54] Vgl. Kahle, Holger: Bilanzieller Gläubigerschutz und internationale Rechnungslegungsstandards, in: ZfB, 72. Jg. (2002), S. 695-710, hier S. 706.
[55] Vgl. Burger, Anton/Burchhart, Anton: Bietet eine investororientierte Rechnungslegung den besseren Gläubigerschutz?, in: BB, 55. Jg. (2000), S. 2197-2200, hier S. 2199.
[56] Vgl. Merschmeyer, Marc: a.a.O., S. 276.
[57] Vgl. Weiss, Heinz-Jürgen/Heiden, Matthias: Shareholder und Bondholder – Zwei Welten oder Partner?, in: BB, 55. Jg. (2000), S. 35-39, hier S. 37.
[58] Vgl. Streim, Hannes/Esser, Maik: a.a.O., S. 839.
[59] Vgl. Leffson, Ulrich: a.a.O., S. 73.
[60] Vgl. Moxter, Adolf: Bilanzlehre, 2. Aufl., Wiesbaden 1982, S. 224f.
[61] Vgl. Streim, Hannes/Esser, Maik: a.a.O., S. 837.
[62] Vgl. Thiele, Stefan: a.a.O., S. 636.
[63] Vgl. Baetge, Jörg/Lienau, Achim (2005a): a.a.O., S. 77.
[64] Vgl. Baetge, Jörg/Lienau, Achim (2005a): a.a.O., S. 76.
[65] Vgl. Wohlgemuth, Frank: IFRS: Bilanzpolitik und Bilanzanalyse – Gestaltung und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen, Berlin 2007, hier S. 30.
[66] Vgl. Ewert, Ralf/Wagenhofer, Alfred: Aspekte ökonomischer Forschung in der Rechnungslegung und Anwendung auf Ausschüttungsbemessung und Unabhängigkeit des Prüfers, in: BFuP, 55. Jg. (2003), S. 603-622, hier S. 607.
[67] Vgl. Herzig, Norbert/Watrin, Christoph: a.a.O., S. 149.
[68] Vgl. Velte, Patrick: Reformierung des Kapitalerhaltungssystems auf der Basis von covenants, in: StuB, 9. Jg. (2007), S. 639-644, hier S. 640.
[69] Vgl. Kahle, Holger (2002): a.a.O., S. 701.
[70] Vgl. Velte, Patrick: a.a.O., S. 644.
[71] Vgl. Ewert, Ralf/Wagenhofer, Alfred: a.a.O., S. 606.
[72] Vgl. Kuhner, Christoph: Zur Zukunft der Kapitalerhaltung durch bilanzielle Ausschüttungssperren im Gesellschaftsrecht der Staaten Europas, in: ZGR, 34. Jg. (2005), S. 753-787, hier S. 784.
[73] Vgl. Kahle, Holger (2002): a.a.O., S. 701f.
[74] Vgl. Niehues, Michael: a.a.O., S. 1215.
[75] Vgl. Ewert, Ralf/Wagenhofer, Alfred: a.a.O., S. 609f.
[76] Vgl. Leftwich, Richard: Accounting Information in Private Markets: Evidence from Private Lending Agreements, in: The Accounting Review, 58. Jg. (1983), S. 23-42.
[77] Zum Beispiel durch Schildbach, Thomas: Rechnungslegung nach US-GAAP – ein Fortschritt für Deutschland?, in: Ballwieser, Wolfgang u.a. (Hrsg.): Rechnungslegung und Steuern international, ZfbF Sonderheft 40, Düsseldorf u.a. 1998, S. 55-81, hier S. 79 f.
[78] Vgl. Ewert, Ralf/Wagenhofer, Alfred: a.a.O., S. 610.
[79] Vgl. Richard, Marc: Kapitalschutz der Aktiengesellschaft Eine rechtsvergleichende und ökonomische Analyse deutscher und US-amerikanischer Kapitalschutzsysteme, Frankfurt am Main u.a. 2007, S. 202.
[80] Vgl. Richard, Marc: a.a.O., S. 202.
[81] Vgl. Kahle, Holger (2002): a.a.O., S. 705.
[82] Vgl. Kuhner, Christoph: a.a.O., S. 763.
[83] Vgl. Wüstemann, Jens/Bischof, Jannis/Kierzek, Sonja: Internationale Gläubigerschutzkonzeptionen, in: BB, 62. Jg. (2007), Special 5/2007 (Beilage zu Heft 17), S. 13-19, hier S. 15.
[84] Vgl. Richard, Marc: a.a.O., S. 169.
[85] Vgl. Ewert, Ralf/Wagenhofer, Alfred: a.a.O., S. 611.
[86] Vgl. Ballwieser, Wolfgang: Gläubigerschutz durch bilanzielle Kapitalerhaltung, in: Der Konzern, 5. Jg. (2007), S. 419-421, hier S. 421.
[87] Vgl. IAS 38.13.
[88] Schruff, Lothar/Haaker, Andreas: Immaterielle Vermögenswerte, in: Ballwieser, Wolfgang u.a. (Hrsg.): Wiley-Kommentar zur internationalen Rechnungslegung nach IFRS 2007, 3. Auflage, Weinheim 2007, Abschnitt 9, Tz. 19.
[89] Vgl. IAS 38.11.
[90] Vgl. Streim, Hannes/Bieker, Marcus/Esser, Maik: Der schleichende Abschied von der Ausschüttungsbilanz – Grundsätzliche Überlegungen zum Inhalt einer Informationsbilanz, in: Dirrigl, Hans u.a. (Hrsg.): Steuern, Rechnungslegung und Kapitalmarkt: Festschrift für Franz W. Wagner zum 60. Geburtstag, 1. Aufl., Wiesbaden 2004, S. 229-244, hier S. 232.
[91] Vgl. IAS 38.54.
[92] Vgl. IAS 38.57.
[93] Vgl. Pellens, Bernhard/Fülbier, Rolf Uwe/Gassen, Joachim: Internationale Rechnungslegung, 6. Auflage, Stuttgart 2006, S. 277.
[94] Vgl. IAS 37.23.
- Quote paper
- Thorsten Weidner (Author), 2008, Die Eignung des IFRS-Abschlusses als Instrument des Gläubigerschutzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134297